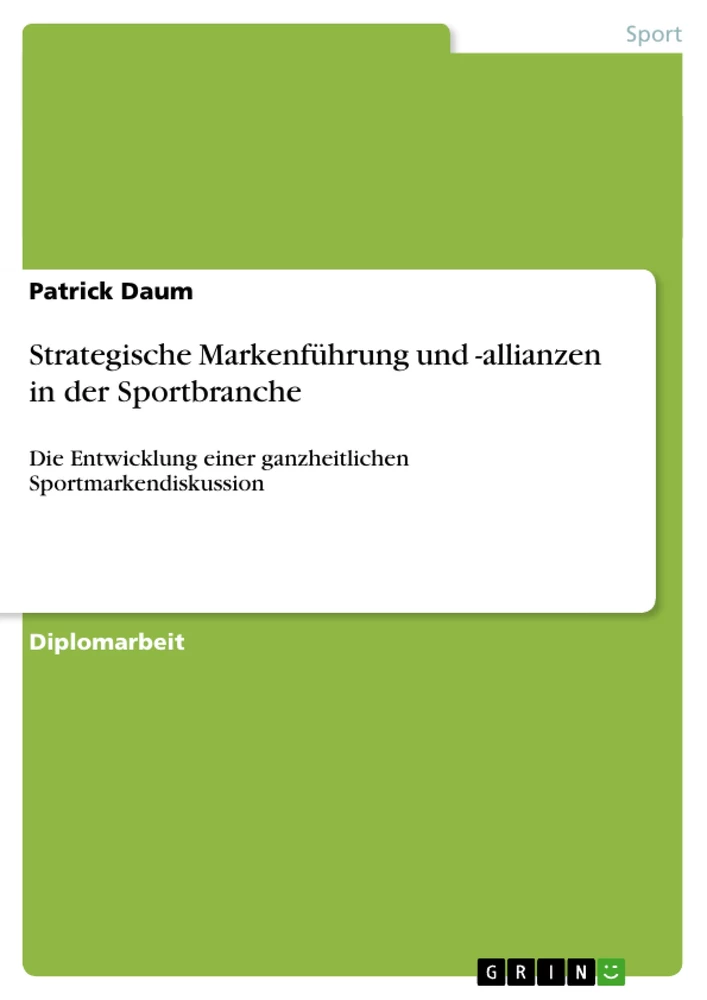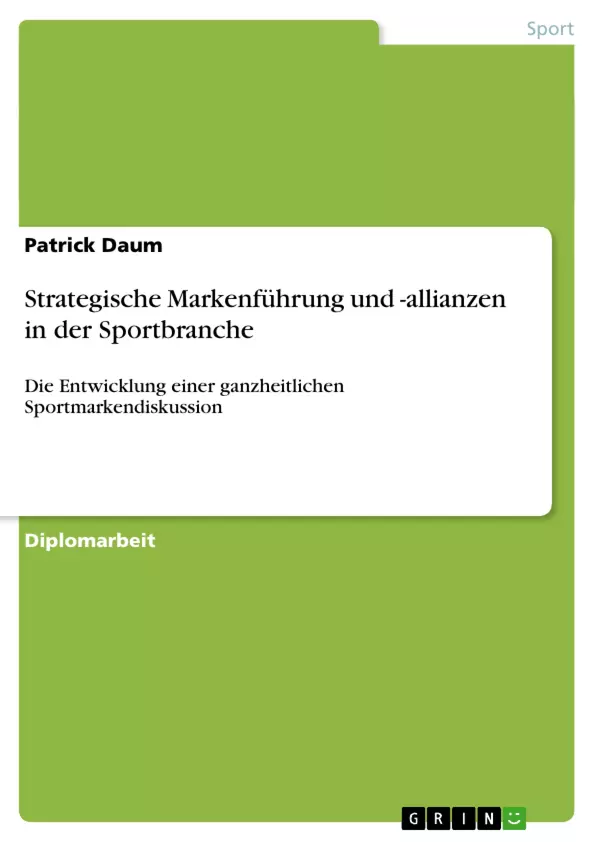„Entities such as the National Basketball Association (NBA), FC Bayern München, Maccabi Tel Aviv, the International Olympic Commitee (IOC), FIFA, Asics and David Beckham are a few examples of sports brands. (Apostolopou-lou/Gladden 2007, S. 187).
Längst hat die strategische Markenführung auf diversen Ebenen der Sportbranche Einzug gehalten. In der vorliegenden Arbeit wird, auf Grundlage des „Drei-Sportsektoren-Modells“, eine ganzheitliche Sportmarkendiskussion entwickelt.
Zunächst wird der Begriff der „Sportmarke“ theoretisch hergeleitet, um anschließend diese Definition empirisch zu überprüfen. Somit kann die Gesamtheit aller sportspezifischen Marken abgegrenzt, näher analysiert und systematisiert werden. Die Betrachtung der strategischen Bedeutung der Markenführung für einzelne Ebenen der Sportbranche führt schließlich zur Konzeption eines Sportmarken - Allianzen – Modells. Dieses bildet die verschiedenen Interaktionsformen zwischen den einzelnen Teilbereichen der Sportmarken ab und zeigt somit auf, wie innerhalb der Sportbranche Synergieeffekte durch Markenpartnerschaften genutzt werden.
Ein Überblick über die Sportmarketing - Literatur zeigt, dass durchweg lediglich spezielle Ebenen der Sportbranche auf deren Markenführung isoliert untersucht werden. Speziell sportspezifische Marken profitieren jedoch vielmehr voneinander, indem sie nicht selten in strategischen Markenpartnerschaften auftreten. Eine systematisierte, zusammenhängende Betrachtung der Markenführung aller sportnaher Organisationen scheint jedoch bisher in der gegenwärtigen Forschungsdiskussion keine Beachtung zu finden. Die vorliegende Arbeit schafft eine ganzheitliche Sportmarkendiskussion, welche die Interaktion zwischen den verschiedenen Bereichen der Sportmarken näher beleuchtet. Mit der Entwicklung eines Sportmarken - Allianzen - Modells werden Teilbereiche der Sportmarken nicht nur isoliert betrachtet, sondern vielmehr die diversen Interaktionen innerhalb und zwischen den verschiedenen Formen der Sportmarken strukturiert dargestellt. Sowohl Markenkooperationen z.B. zwischen Real Madrid und David Beckham, Porsche und adidas, dem FC Bayern München und der Hypovereinsbank als auch zwischen Nike und Apple oder zwischen Sportverbänden können in die erarbeitete Systematik eingeordnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Thematik
- Fragestellung und Zielsetzung
- Struktureller Aufbau der Arbeit
- Grundlagen der Markenführung
- Ganzheitliche Definition des Markenbegriffs
- Das Markenverständnis innerhalb dieser Arbeit
- Der Entstehungsprozess einer Marke
- Die beiden Ebenen einer Marke
- Der Mehrwert einer starken Marke
- Aus Anbietersicht
- Aus Nachfragersicht
- Die Ziele der Markenführung
- Markenarten
- Konsumgütermarken
- Investitionsgütermarken
- Dienstleistungsmarken
- Der Mensch als Marke
- Markenallianzen
- Co – Branding
- Ingredient Branding
- Die Sportbranche
- Sportselbstorganisation
- Staat und Sportförderung
- Markt und Sportwettbewerb
- Entwicklungstendenzen innerhalb der Sportbranche
- Leistungen der Sportbranche
- Empirische Analyse zur Markenbildung in der Sportbranche
- Definition des Begriffs „Sportmarke“
- Untersuchungsziel
- Untersuchungsdesign
- Durchführung der Untersuchung
- Ergebnisse der Untersuchung
- Diskussion der Ergebnisse
- Systematisierung der Sportmarken
- Differenzierung nach der Art der erbrachten Leistung
- Differenzierung nach der Art der Markierung
- Differenzierung nach der geografischen Reichweite
- Differenzierung nach der Zielsetzung der Organisation
- Differenzierung nach der verbraucherbezogenen Reichweite
- Differenzierung nach dem Bezug zum Sport
- Strategische Bedeutung der Markenführung für Organisationen der Sportbranche
- Sportmarken im engeren Sinne
- Sportler
- Gemeinnützige Sportvereine
- Profisportclubs
- Gemeinnützige Sportverbände
- Professionelle Sportligen
- Sportevents
- Sportmarken im weiteren Sinne
- Sportartikelhersteller
- Sportfachhandel
- Sportarenen
- Sportmedien
- Auswirkungen der Entwicklungstendenzen innerhalb der Sportbranche auf die Sportmarkenführung
- Sportmarken - Allianzen
- Innerhalb der Sportmarken im engeren Sinne
- Innerhalb der Sportmarken im weiteren Sinne
- Zwischen Sportmarken im engeren und Sportmarken im weiteren Sinne
- Zwischen Sportmarken und Nicht-Sportmarken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die strategische Markenführung und -allianzen in der Sportbranche. Sie verfolgt das Ziel, eine ganzheitliche Sportmarkendiskussion zu entwickeln, indem sie den Begriff der "Sportmarke" präzisiert, alle sportspezifischen Marken analysiert und systematisiert, die Bedeutung der Markenführung für verschiedene Ebenen der Sportbranche beleuchtet und ein Sportmarken-Allianzen-Modell konzipiert, das die Interaktion zwischen den verschiedenen Ebenen der Sportmarken darstellt.
- Präzisierung des Begriffs "Sportmarke"
- Systematisierung der Sportmarken
- Strategische Bedeutung der Markenführung in der Sportbranche
- Sportmarken-Allianzen-Modell
- Entwicklungstendenzen im Sportmarkenmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und erläutert die Fragestellung und Zielsetzung. Anschließend werden die Grundlagen der Markenführung in Bezug auf den Sport beleuchtet, wobei der Fokus auf dem Markenbegriff, dem Entstehungsprozess, dem Mehrwert und den Zielen der Markenführung liegt. Die Arbeit behandelt auch verschiedene Markenarten und Markenallianzen, insbesondere Co-Branding und Ingredient Branding.
Kapitel 3 beleuchtet die Sportbranche anhand des Drei-Sportsektoren-Modells und betrachtet die Sektoren Sportselbstorganisation, Staat und Sportförderung sowie Markt und Sportwettbewerb. Die Entwicklungstendenzen im Sport, wie z.B. die Privatisierung, werden analysiert.
Kapitel 4 entwickelt eine eigene Sportmarkendiskussion, indem es den Begriff der "Sportmarke" theoretisch definiert und empirisch überprüft. Es untersucht, ob und in welchem Ausmaß Marken in der Psyche der Konsumenten sportspezifische Vorstellungsbilder hervorrufen.
Kapitel 5 systematisiert die Sportmarken anhand verschiedener Differenzierungsmerkmale, wie z.B. Art der erbrachten Leistung, Art der Markierung, geografische Reichweite, Zielsetzung der Organisation, verbraucherbezogene Reichweite und Bezug zum Sport.
Kapitel 6 untersucht die strategische Bedeutung der Markenführung für verschiedene Ebenen der Sportbranche, sowohl für Sportmarken im engeren Sinne (Sportler, Vereine, Verbände, Ligen, Events) als auch für Sportmarken im weiteren Sinne (Sportartikelhersteller, Sportfachhandel, Sportarenen, Sportmedien). Darüber hinaus werden die Auswirkungen von Entwicklungstendenzen innerhalb der Sportbranche auf das Sportmarkenmanagement betrachtet.
Kapitel 7 widmet sich dem Thema Sportmarken-Allianzen und analysiert die vielfältige Interaktion zwischen den verschiedenen Ebenen der Sportmarken, unter anderem durch das Sportmarken-Allianzen-Modell. Die Arbeit erläutert die verschiedenen Kooperationsformen zwischen Sportmarken und Nicht-Sportmarken.
Schlüsselwörter
Sportmarke, Markenführung, Sportbranche, Markenallianz, Co-Branding, Ingredient Branding, Sportselbstorganisation, Staat und Sportförderung, Markt und Sportwettbewerb, Entwicklungstendenzen, Sportler, Vereine, Verbände, Ligen, Events, Sportartikelhersteller, Sportfachhandel, Sportarenen, Sportmedien, Sponsoring, Merchandising, Medienpräsenz.
- Quote paper
- Patrick Daum (Author), 2007, Strategische Markenführung und -allianzen in der Sportbranche, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84222