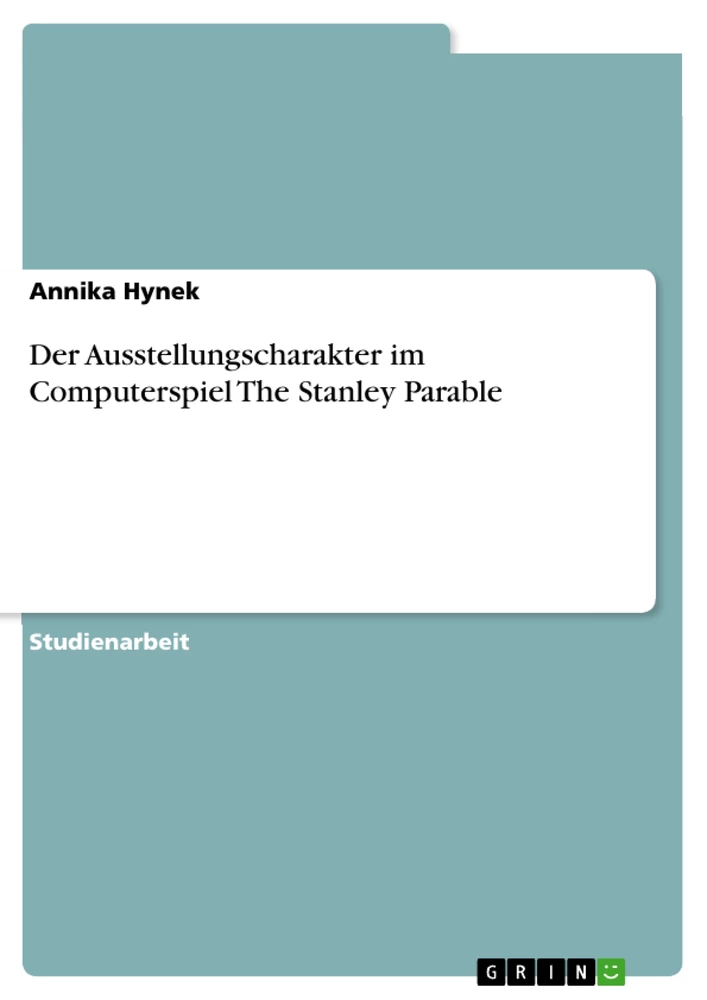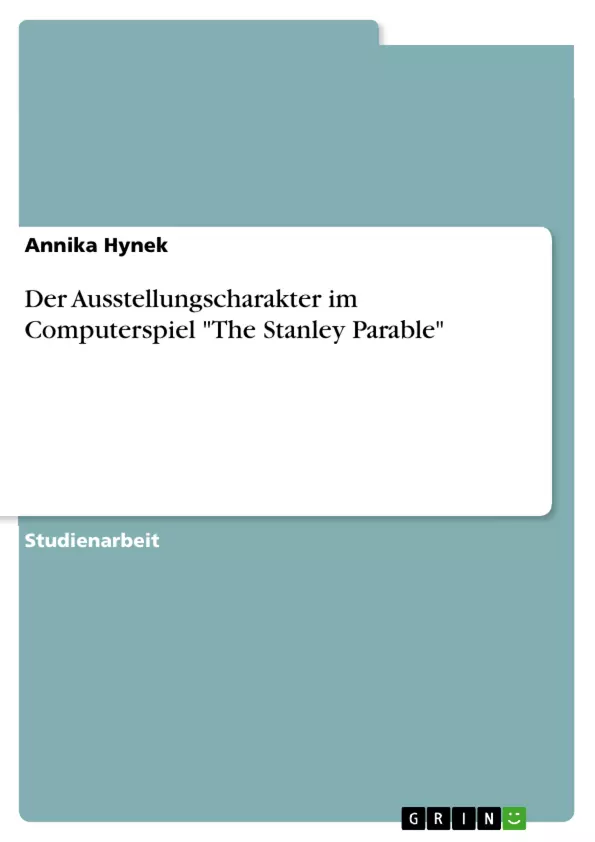Die vorliegende Arbeit untersucht, ob "The Stanley Parable" als eine Ausstellung über Videospiele verstanden werden kann. Die These ist hierbei, dass die Selbstreflexivität des Spiels einen Ausstellungscharakter erzeugt und das zentrale Thema bzw. die Fragestellung dieser Ausstellung die Entscheidungsfreiheit von Spieler*innen in Videospielen ist.
Ausstellungen über Videospiele stehen oftmals vor dem Problem, geeignete Ausstellungsformen und -objekte zu finden, die dem ausgestellten Medium gerecht werden. Das liegt vor allem an einer Eigenschaft von Computerspielen, die Britta Neitzel beschreibt: „Ein Spiel muss gespielt werden, um ein Spiel zu sein. Und es ist nur so lange ein Spiel, wie es gespielt wird, ansonsten verbleibt es ein Regelwerk oder eine Handlungsanweisung“.
Nicole Carpenter vertritt in einem Beitrag auf der Gaming-Website Polygon die Meinung, dass die meisten Videospiele aufgrund ihres Sammlungsaspekts Eigenschaften von Museen aufweisen. Sie bezieht sich auch auf Museen, die innerhalb von Computerspielen dargestellt werden: „video games are museums, and the museums in these games are reflections of the games they’re in“. Diese Aussage findet sich im Museumslevel des Computerspiels "The Stanley Parable" (Galactic Cafe 2013) bestätigt.
"The Stanley Parable" erzählt die Geschichte des Büroangestellten Stanley, der in einem großen Bürokomplex arbeitet und eines Tages feststellt, dass er keine Arbeitsanweisungen mehr über den Computer erhält und seine Kolleg*innen verschwunden sind. Die Spieler*in spielt Stanley aus der Egoperspektive. Begleitet wird die Spieler*in von den Kommentaren eines namenlosen Erzählers, der nicht körperlich zu sehen ist, jedoch trotzdem homodiegetische Tendenzen aufweist. Interessant bei dem Spiel ist die Möglichkeit, den Wegvorgaben des Erzählers zu widersprechen, indem alternative Pfade gegangen werden können, und somit von der linearen Erzählung abzuweichen. So kann man insgesamt dreizehn ‚harte Enden‘ und neun ‚endähnliche Ergebnisse‘ erreichen. Auf einem dieser Wege kann die Spieler*in auch zu einem Museumslevel gelangen, in dem Elemente aus dem Spiel "The Stanley Parable" ausgestellt sind. Die metareferenziellen Spielereien und selbstreflexiven Momente des Spiels veranlassen Bradley J. Fest dazu, "The Stanley Parable" als ein Videospiel über Videospiele zu bezeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Museum und Ausstellung im zeitgenössischen Kontext
- Ausstellungsformen
- Videospiele in Museen
- Museen in Videospielen
- Selbstreflexivität als Ausstellungsform in The Stanley Parable
- Das Museum in The Stanley Parable
- The Stanley Parable als Ausstellung über Videospiele
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob das Computerspiel The Stanley Parable als eine Ausstellung über Videospiele verstanden werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Selbstreflexivität des Spiels einen Ausstellungscharakter erzeugt und das zentrale Thema bzw. die Fragestellung dieser Ausstellung die Entscheidungsfreiheit von Spieler*innen in Videospielen ist.
- Ausstellungsformen und -objekte für Videospiele
- Der Kunststatus von Videospielen
- Museale Ausstellungen von Videospielen
- Museen innerhalb von Videospielen
- Selbstreflexivität in The Stanley Parable als Ausstellungsform
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Problematik der Ausstellung von Videospielen in Museen und stellt die These auf, dass The Stanley Parable als eine Ausstellung über Videospiele verstanden werden kann.
- Museum und Ausstellung im zeitgenössischen Kontext: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über Museen und Ausstellungen im zeitgenössischen Kontext, beleuchtet verschiedene Ausstellungsformen und diskutiert die Bedeutung des Sammelns und Ausstellens im Kontext von Videospielen.
- Selbstreflexivität als Ausstellungsform in The Stanley Parable: Dieser Abschnitt analysiert das Spiel The Stanley Parable und untersucht, inwiefern es als eine Ausstellung über Videospiele verstanden werden kann. Dabei wird auch das In-Game-Museum analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Videospiele in Museen, Museen in Videospielen, Ausstellungsdesign, Kunststatus von Videospielen, Selbstreflexivität, Spieler*innen-Entscheidungsfreiheit, The Stanley Parable, Metareferenz, Ausstellungscharakter.
- Arbeit zitieren
- Annika Hynek (Autor:in), 2021, Der Ausstellungscharakter im Computerspiel "The Stanley Parable", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268774