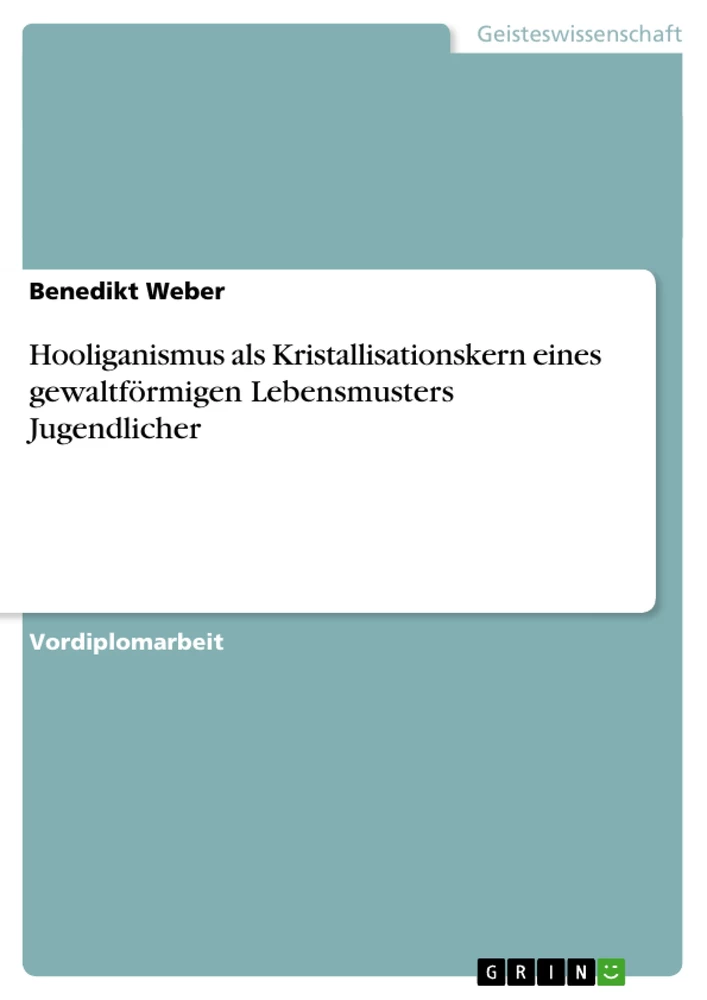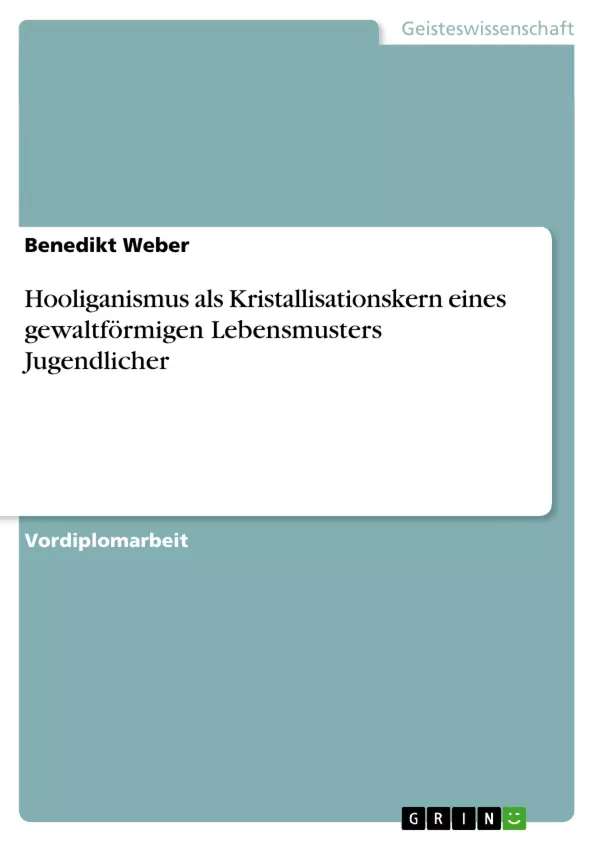Gewalttätige Jugendliche wurden zuletzt in der Öffentlichkeit, vor allem im Rahmen der Landestagswahl in Hessen, sehr stark diskutiert. Zudem ist, vor allem in ostdeutschen Stadien, immer wieder von Hooliganübergriffen die Rede. Dabei scheint vielen Menschen nicht klar zu sein, dass es nicht nur erwachsene Männer sind, die dort zuschlagen, sondern oftmals jene gewalttätige Jugend. Diese Arbeit soll zunächst das Phänomen „Hooliganismus“ beschreiben um dann in einem weiteren Schritt einen Erklärungsansatz für die Jugendgewalt und deren Kristallisation im Hooliganismus liefern. Dabei möchte ich in dieser Einleitung zunächst einen Überblick über den thematischen Aufbau dieser Arbeit geben und eine geeignete Definition für den Gewaltbegriff im Kontext der Jugenddelinquenz und des Hooliganismus finden. Im zweiten Punkt, möchte ich in einem klassifikatorischen Ansatz eine Trennung der Fanlandschaft aus soziologischer Sicht beschreiben um dann in Punkt drei expliziert auf die gewaltaffinen Fangruppen der Ultras und der Hooligans einzugehen. Im Hauptteil möchte ich zunächst eine erste Brücke zwischen den Merkmalen der delinquenten Jugendkultur der Unterschicht und der Subkultur der Hooligans schlagen (Punkt vier) um dann im letzten Punkt Erklärungsansätze für jugendliche Gewalt und deren Kristallisation im Hooliganismus zu erläutern.
Da der Gewaltbegriff vielseitig diskutiert und definiert wird, möchte ich zunächst klar umreißen, von was die Rede ist, wenn im Folgenden der Terminus „Gewalt“ auftaucht [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung und Gewaltbegriff
- 2. Differenzierung der Fanlandschaft im Fußball
- 3. Spezifische Fangruppen
- 3.1 Ultras
- 3.2 Hooligans
- 4. Kristallisationspunkte einer delinquenten Jugendkultur der Unterschicht
- 5. Wert-, Sinnkrise und Erlebnisarmut - Gründe für die Gewalttätigkeit Jugendlicher
- 5.1 Werteverlust
- 5.2 Sinnkrise
- 5.3 Erlebnisarmut
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hooliganismus als Ausdruck jugendlicher Gewalt und sucht nach Erklärungen für dessen Entstehung und Kristallisation. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Phänomens und der Analyse der sozialen und individuellen Faktoren, die zur Gewalttätigkeit beitragen.
- Definition und Einordnung von Gewalt im Kontext von Jugenddelinquenz und Hooliganismus
- Differenzierung der Fanlandschaft im Fußball und Charakterisierung gewaltbereiter Gruppen (Ultras und Hooligans)
- Verbindung zwischen Jugendkultur der Unterschicht und Hooligan-Subkultur
- Analyse von Wert-, Sinnkrise und Erlebnisarmut als mögliche Ursachen jugendlicher Gewalt
- Erklärungsansätze für die Kristallisation jugendlicher Gewalt im Hooliganismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung und Gewaltbegriff: Der einleitende Abschnitt definiert den Gewaltbegriff im Kontext der Studie, fokussiert auf physische Gewalt im Hooliganismus. Er skizziert den Aufbau der Arbeit und positioniert den Hooliganismus als Manifestation jugendlicher Gewalt, die besonders im Kontext ostdeutscher Fußballstadien in Erscheinung tritt. Die Arbeit beabsichtigt, das Phänomen zu beschreiben und Erklärungsansätze zu liefern, indem sie die Fanlandschaft differenziert und die Verbindung zu einer delinquenten Jugendkultur der Unterschicht herstellt. Die Definition von Gewalt wird dabei auf körperliche Schädigung zwischen Individuen eingegrenzt, wobei psychische und strukturelle Gewaltformen eine untergeordnete Rolle spielen. Die Überschreitung gesellschaftlicher Normen durch physische Gewalt wird als zentraler Aspekt des Hooliganismus hervorgehoben. Die Motive hinter der Gewalt werden anhand des Modells von Wilhelm Heitmeyer (expressive, instrumentelle, regressive und autoaggressive Gewalt) erläutert und für den Kontext des Hooliganismus relevant gesetzt.
2. Differenzierung der Fanlandschaft im Fußball: Dieses Kapitel differenziert die Fanlandschaft im Fußball anhand der Typologie von Heitmeyer und Peter. Es wird gezeigt, dass Fans nicht homogen sind und sich nicht allein anhand gesellschaftlicher Schichten kategorisieren lassen. Die Typologie unterscheidet zwischen konsumorientierten Fans (Fußball als austauschbares Freizeitangebot), fußballzentrierten Fans (Fußball als zentraler Bestandteil der sozialen Identität) und erlebnisorientierten Fans (Fußball als Mittel zur Spannungserzeugung und Ablenkung vom Alltag). Die Einteilung basiert auf der Bedeutung von Fußball für die alltägliche Lebensweise, den Identitätsbestrebungen und dem Wunsch nach sozialer Anerkennung und Zugehörigkeit. Die Kapitel betont die Nicht-Homogenität der Fans und dient als Grundlage für die spätere Analyse gewaltbereiter Gruppen.
Schlüsselwörter
Hooliganismus, Jugendgewalt, Fußballfans, Subkultur, Delinquenz, Unterschicht, Wertkrise, Sinnkrise, Erlebnisarmut, Gewaltbegriff, Fanlandschaft, Ultras, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Hooliganismus als Ausdruck jugendlicher Gewalt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Hooliganismus als Ausdruck jugendlicher Gewalt und sucht nach Erklärungen für dessen Entstehung und Kristallisation. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Phänomens und der Analyse der sozialen und individuellen Faktoren, die zur Gewalttätigkeit beitragen. Besonders im Kontext ostdeutscher Fußballstadien wird der Hooliganismus als Manifestation jugendlicher Gewalt betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Problemstellung und Gewaltbegriff; 2. Differenzierung der Fanlandschaft im Fußball; 3. Spezifische Fangruppen (Ultras und Hooligans); 4. Kristallisationspunkte einer delinquenten Jugendkultur der Unterschicht; 5. Wert-, Sinnkrise und Erlebnisarmut - Gründe für die Gewalttätigkeit Jugendlicher; 6. Fazit.
Wie wird der Gewaltbegriff definiert?
Der Gewaltbegriff wird auf körperliche Schädigung zwischen Individuen eingegrenzt. Psychische und strukturelle Gewaltformen spielen eine untergeordnete Rolle. Die Überschreitung gesellschaftlicher Normen durch physische Gewalt wird als zentraler Aspekt des Hooliganismus hervorgehoben. Die Motive hinter der Gewalt werden anhand des Modells von Wilhelm Heitmeyer (expressive, instrumentelle, regressive und autoaggressive Gewalt) erläutert.
Wie wird die Fanlandschaft im Fußball differenziert?
Die Fanlandschaft wird anhand der Typologie von Heitmeyer und Peter differenziert. Es werden konsumorientierte, fußballzentrierte und erlebnisorientierte Fans unterschieden, basierend auf der Bedeutung von Fußball für die alltägliche Lebensweise, die Identitätsbestrebungen und den Wunsch nach sozialer Anerkennung und Zugehörigkeit. Die Nicht-Homogenität der Fans wird betont.
Welche Rolle spielen Ultras und Hooligans?
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf spezifische Fangruppen, insbesondere Ultras und Hooligans. Es beschreibt die Charakteristika dieser Gruppen und deren Beitrag zum Phänomen des Hooliganismus.
Welche sozialen und individuellen Faktoren werden als Ursachen für Hooliganismus betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Hooliganismus und einer delinquenten Jugendkultur der Unterschicht. Wert-, Sinnkrise und Erlebnisarmut werden als mögliche Ursachen jugendlicher Gewalt und damit als Faktoren für die Entstehung von Hooliganismus analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hooliganismus, Jugendgewalt, Fußballfans, Subkultur, Delinquenz, Unterschicht, Wertkrise, Sinnkrise, Erlebnisarmut, Gewaltbegriff, Fanlandschaft, Ultras, Soziologie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Hooliganismus als Ausdruck jugendlicher Gewalt zu beschreiben und Erklärungsansätze für dessen Entstehung und Kristallisation zu liefern. Sie analysiert die sozialen und individuellen Faktoren, die zur Gewalttätigkeit beitragen.
- Arbeit zitieren
- Benedikt Weber (Autor:in), 2008, Hooliganismus als Kristallisationskern eines gewaltförmigen Lebensmusters Jugendlicher, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/93678