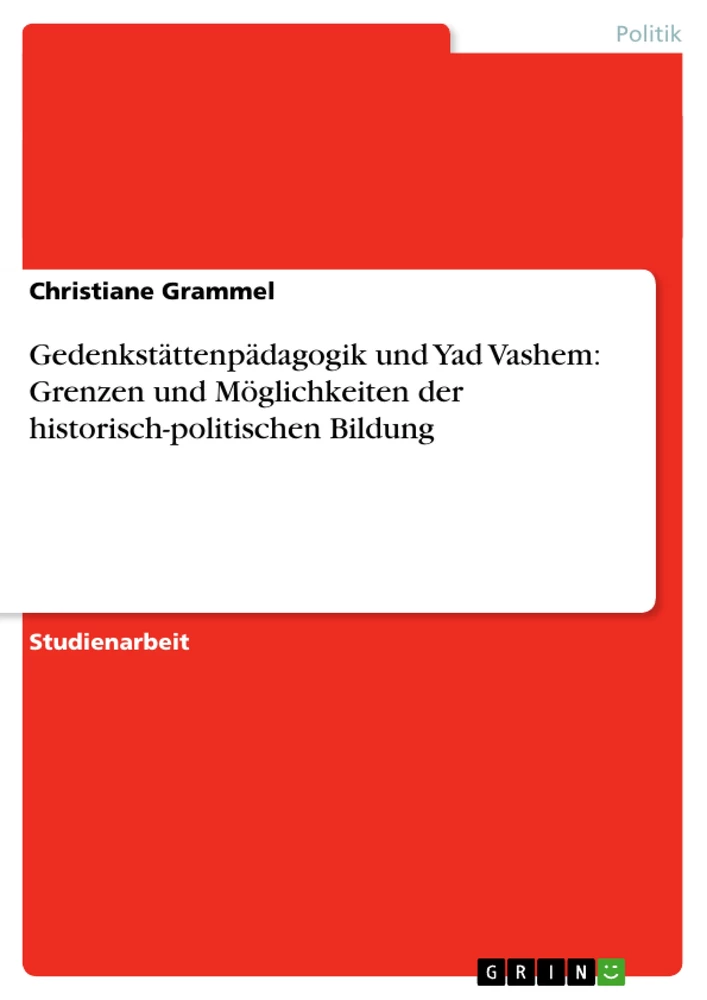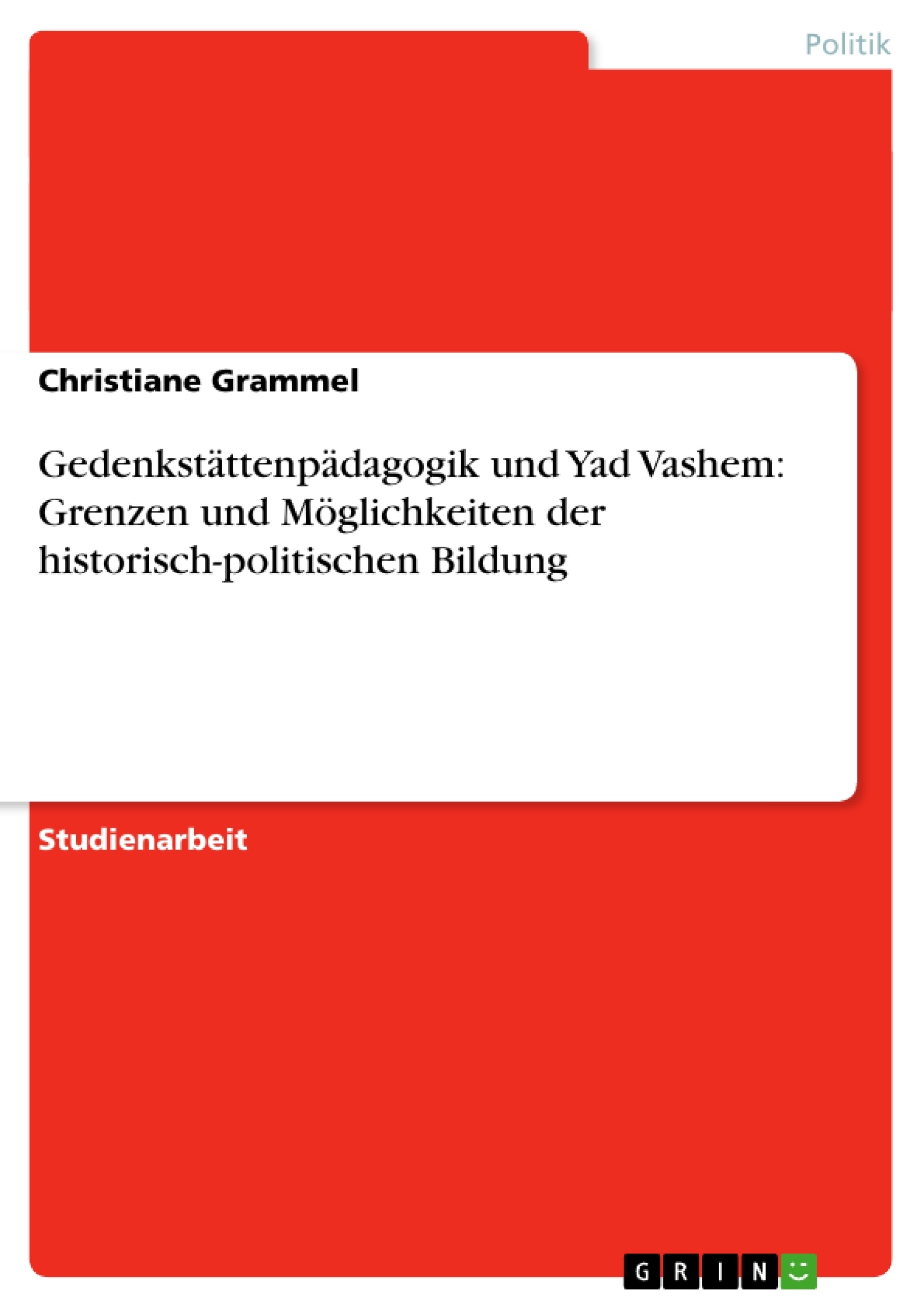Das Jahr 2005 markiert einen neuen Punkt in Deutschlands Geschichte. 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Shoah, dem Holocaust, der Judenverfolgung und –ermordung, erinnert die vereinte Bundesrepublik der schrecklichen Verbrechen des Naziregimes. Mittels Gedenkfeiern, Ansprachen, großen Reden und aufwändigen Filmen (Der Untergang, Sophie Scholl, Speer und Er) wurde des 60. Jahrestags des Kriegsendes gedacht. Es scheint, als hätte das Interesse am dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte wieder zugenommen. Die Faszination an der „Banalität des Bösen“ ist ungebrochen.
Am 11. Mai 2005, einen Tag vor dem „Jerusalem-Tag“, wurde das jahrelang umstrittene neue Mahnmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. Es ist die einzige Gedenkstätte in Deutschland, die nicht an einem authentischen Ort des Geschehens steht, wobei natürlich Berlin, und in diesem Fall speziell die Nähe zum Reichstag und Brandenburger Tor symbolischen Charakter erreicht (Plaketten, Hinweisschilder oder Installationen, die an einzelnen Orten an jüdisches Leben erinnern sind andere Typen des Gedenkens und hier nicht relevant). Doch die Stimmen der Besucher dieser Gedenkstätte sind kritisch. Was sollen die 2700 Betonstelen symbolisieren? Auch Äußerungen wie „Das ist alles so lange her, was hab ich mit dem Holocaust zu tun?“ und „Brauchen wir wirklich noch eine Gedenkstätte?“ wurden gehört. Auch diese kritischen, z.T. unreflektierten Stimmen spiegeln die kontemporäre Haltung v.a. von Jugendlichen zum Holocaust wider. Wie ist dieser zu begegnen?
Eine Antwort heißt politische Bildung (oder auch historisch-politische Bildung), die v.a. im Klassenzimmer den Jugendlichen beibringen soll, sich mit der Vergangenheit auseinander zu setzten. In den Achtzigerjahren, als die Jugend eine noch tiefere Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Vergangenheit forderte, entstand die Museumspädagogik und mit ihr die Gedenkstättenpädagogik. Ihre Aufgabe definiert Tomasz Kranz folgendermaßen: „Sie sollen im Großen und Ganzen Nachdenken und Diskurs stimulieren, und im Einzelnen zur Entwicklung der Fähigkeit beitragen, in moralische und existentielle Selbstreflexion einzutreten, und somit die Empfindsamkeit und Wachsamkeit gegenüber allen Formen von Intoleranz, Xenophobie und anderen für die Demokratie gefährlichen Tendenzen in der Gesellschaft wecken“ ( Kranz, 1998: 28) .
Diese Arbeit soll die Möglichkeiten sowie die Grenzen der Wirksamkeit von Gedenkstätten und Gedenkstättenpädagogik aufdecken und behandeln. Als besonderes Beispiel soll die zentrale Gedenkstätte Yad Vashem im Mittelpunkt stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand dieser Arbeit
- Gedenkstätten und Gedenkstättenpädagogik – Eine Einführung
- Gedenkstätten – verschiedenen Typen
- Ziele und Aufgaben von Gedenkstätten
- Gedenkstätten und Erinnerungskultur in der BRD – historischer Überblick
- Gedenkstättenpädagogik
- Yad Vashem
- Entstehungsgeschichte, Ziele und Aufgaben
- Gedenkorte in Yad Vashem
- Das Tal der Gemeinden
- Die Allee der Gerechten unter Völkern
- Das Denkmal für die ermordeten Kinder
- Das Museum und die Halle der Namen
- Lernen in Yad Vashem
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Wirksamkeit von Gedenkstätten und Gedenkstättenpädagogik. Sie untersucht die Grenzen und Möglichkeiten, die diese Einrichtungen für die historisch-politische Bildung bieten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die zentrale Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
- Die Bedeutung von Gedenkstätten für die Erinnerungskultur
- Die Rolle der Gedenkstättenpädagogik in der historisch-politischen Bildung
- Die Geschichte und die Ziele der Gedenkstätte Yad Vashem
- Die unterschiedlichen Gedenkorte innerhalb von Yad Vashem
- Lernmöglichkeiten und pädagogische Ansätze in Yad Vashem
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit erläutert die verschiedenen Typen von Gedenkstätten und deren Ziele sowie Aufgaben. Er beleuchtet den Wandel der Erinnerungskultur in der Bundesrepublik Deutschland und zeigt die Bedeutung von Gedenkstätten als Lernorte auf. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung von Gedenkstätten von "Mahnmälern" hin zu "Denk-Stätten" und "Lernorten".
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Gedenkstätte Yad Vashem. Hier werden Entstehungsgeschichte, Ziele und Aufgaben der Einrichtung sowie die einzelnen Gedenkorte innerhalb des Komplexes vorgestellt.
Schlüsselwörter
Gedenkstätten, Gedenkstättenpädagogik, historisch-politische Bildung, Erinnerungskultur, Holocaust, Yad Vashem, Museumspädagogik, Zeitzeugen, Lernorte, Erinnern, Mahnen, Bildung, Demokratie, Toleranz, Intoleranz.
- Arbeit zitieren
- Christiane Grammel (Autor:in), 2005, Gedenkstättenpädagogik und Yad Vashem: Grenzen und Möglichkeiten der historisch-politischen Bildung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80697