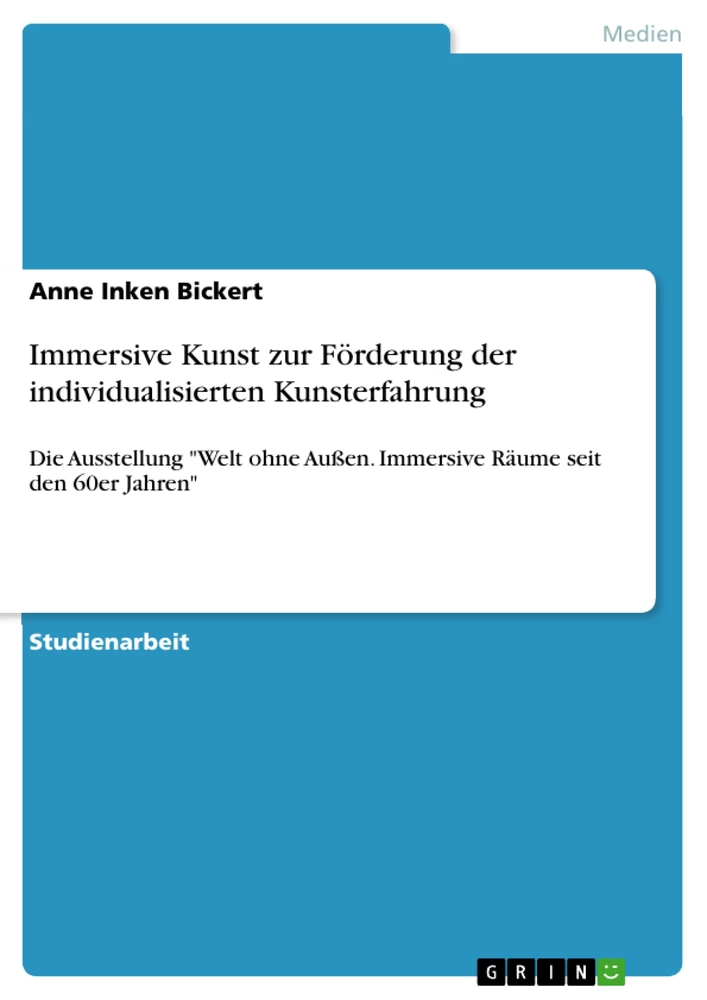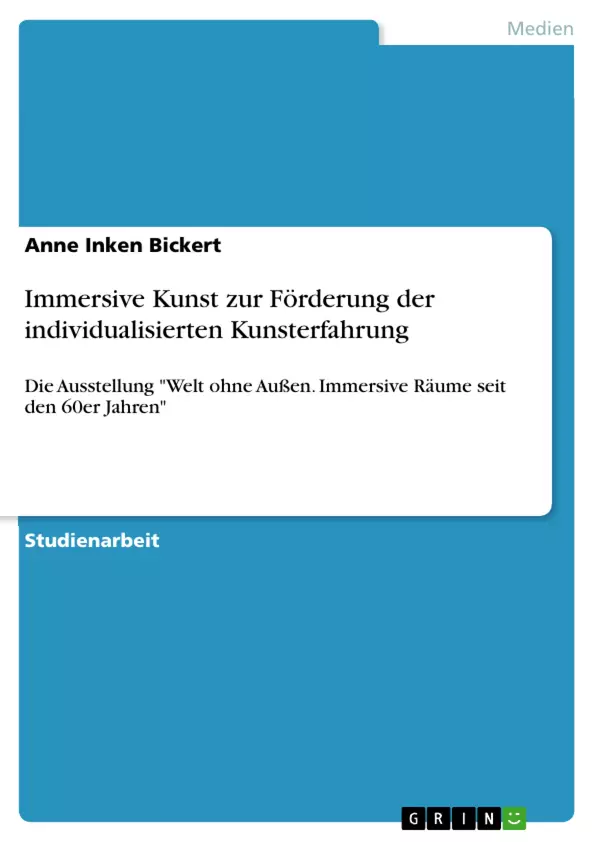In dieser Arbeit widmet sich der Autor der Frage, inwiefern sich die immersiven Inszenierungspraktiken in der Ausstellung "Welt ohne Außen. Immersive Räume seit den 60er Jahren" auf die individuelle Kunsterfahrung von Besuchern auswirken.
Hierfür beschreibt der Autor zunächst die Inszenierung der "Welt ohne Außen". Anschließend wird analysiert, wodurch sich der individuelle Ereignischarakter einzelner Kunstwerke sowie der Ausstellung als Gesamtkonzept, konstituiert. Ziel ist es aufzuzeigen, weshalb sich die Ausstellung von anderen Ausstellungen unterscheidet und darüber hinaus einen kurzen Einblick in die Entwicklung des Ausstellungsformats und den Wandel des klassischen Verhältnisses zwischen Kunstbetrachter und Kunstobjekt hin zum modernen Ansatz der immersiven Inszenierung zu geben. Außerdem soll erläutert werden, in welcher Form die Subjekt-Objekt-Relation bei immersiver Kunst neu verhandelt wird, sodass es überhaupt zu einer individuellen Kunsterfahrung kommen kann.
Die Ausstellung "Welt ohne Außen. Immersive Räume seit den 60er Jahren", welche im Martin Gropius Bau in Berlin zu sehen war, zeichnet sich als Gegenentwurf zur klassischen Ausstellung aus. Sie stellt das Bedürfnis der individualisierten Kunsterfahrung in den Mittelpunkt. Nicht nur das Werk, sondern auch dessen Ereignischarakter, seine Performativität, werden ausgestellt. Im Vordergrund steht die sinnliche Erfahrbarkeit der ausgewählten Kunstwerke.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Welt ohne Außen. Immersive Räume seit den 60er Jahren
- 2.1 Mein Gang durch die Ausstellung - Erinnerungsprotokoll
- 3.0 Vom Werk zum Ereignis
- 4.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, wie immersive Inszenierungsstrategien in Ausstellungen zur Förderung der individualisierten Kunsterfahrung beitragen können. Am Beispiel der Ausstellung „Welt ohne Außen. Immersive Räume seit den 60er Jahren“ im Martin Gropius Bau in Berlin wird die Entwicklung des klassischen Ausstellungsformats und die Subjekt-Objekt-Relation in der immersiven Kunst beleuchtet.
- Entwicklung des klassischen Ausstellungsformats
- Subjekt-Objekt-Relation in der immersiven Kunst
- Individuelle Kunsterfahrung
- Performativität und Ereignischarakter von Kunstwerken
- Haptische und physische Wirkung von Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung
Der Text beginnt mit einer Kritik an der traditionellen Ausstellungsform, die den Besucher*innen eine passive Rolle zuweist und das Potenzial der individuellen Kunsterfahrung versäumt. Die Ausstellung „Welt ohne Außen“ wird als Gegenentwurf präsentiert, der die sinnliche Erfahrbarkeit von Kunstwerken und die individuelle Erfahrung in den Vordergrund stellt.
2.0 Welt ohne Außen. Immersive Räume seit den 60er Jahren
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Ausstellung „Welt ohne Außen“, die vom 08.06.2018 bis zum 05.08.2018 im Martin Gropius Bau in Berlin gezeigt wurde. Die Ausstellung wurde von Thomas Oberender und Tino Sehgal kuratiert und präsentiert 13 Elemente aus verschiedenen Kunstdisziplinen ab den 60er Jahren.
2.1 Mein Gang durch die Ausstellung - Erinnerungsprotokoll
Der Autor beschreibt seine persönlichen Erfahrungen während seiner Besuche der Ausstellung und konzentriert sich dabei auf die Arbeit von Doug Wheeler aus dem Jahr 1969. Diese Installation, die einen weißen Raum mit einem Quadrat aus Leuchtstoffröhren zeigt, evoziert ein Gefühl von Orientierungslosigkeit und Benommenheit, das besonders intensiv ist, wenn man sich allein im Raum befindet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: immersive Inszenierung, individuelle Kunsterfahrung, klassische Ausstellungsform, Welt ohne Außen, Martin Gropius Bau, Performativität, Ereignischarakter, haptische Wirkung, Doug Wheeler, Leuchtstoffröhren, Orientierungslosigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Immersiven Kunst
Was war das Besondere an der Ausstellung „Welt ohne Außen“?
Sie fungierte als Gegenentwurf zur klassischen Ausstellung, indem sie die sinnliche Erfahrbarkeit und den Ereignischarakter von Kunst in den Mittelpunkt stellte.
Wie verändert immersive Kunst das Verhältnis zwischen Betrachter und Werk?
Die klassische Distanz wird aufgehoben; der Besucher wird Teil des Werks, was zu einer individualisierten und performativen Kunsterfahrung führt.
Welches Kunstwerk wird im Text detailliert beschrieben?
Der Autor beschreibt eine Installation von Doug Wheeler aus dem Jahr 1969, die durch Licht und Raum Orientierungslosigkeit erzeugt.
Wo und wann fand die untersuchte Ausstellung statt?
Die Ausstellung war von Juni bis August 2018 im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen.
Was bedeutet „Performativität“ im Kontext dieser Arbeit?
Es beschreibt, dass nicht nur das statische Objekt, sondern der Akt des Erlebens und die haptische Wirkung des Raumes die eigentliche Kunst darstellen.
- Arbeit zitieren
- Anne Inken Bickert (Autor:in), 2018, Immersive Kunst zur Förderung der individualisierten Kunsterfahrung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/511336