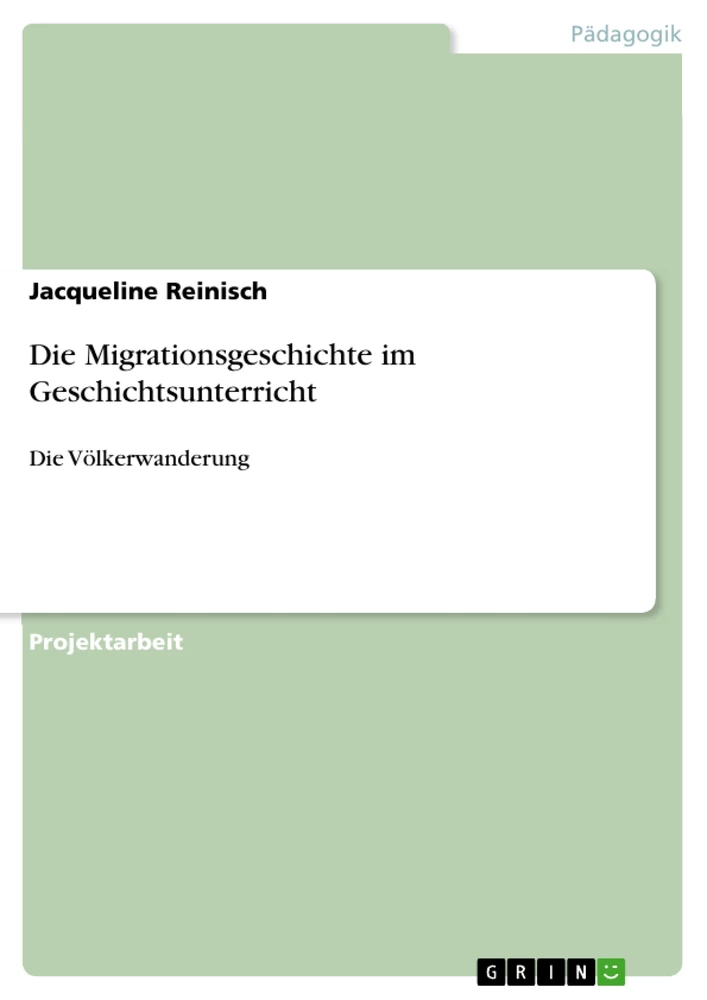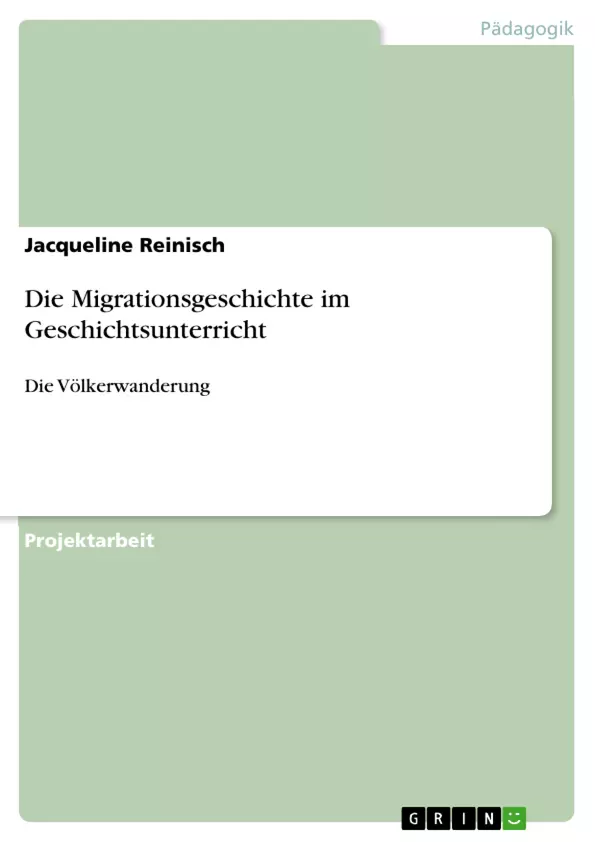In seinem Aufsatz „Europäische Geschichte im Unterricht einer Migrationsgesellschaft. Neue curriculare Akzente und die aktuellen Lehrpläne der Bundesländer“ behandelt Vadim Oswalt die These, ob die Geschichte der Herkunftsländer von Migrantenkindern vergleichsweise in den Geschichtsunterricht einzubeziehen sei und verknüpft diese mit den derzeit gültigen Lehrplänen.
Hierbei sind zwei Tendenzen im Aufbau ersichtlich: die Tendenz des chronologischen Durchgangs und die Tendenz zur Gegenwartsorientierung mit Behandlung von Schlüsselproblemen und der Geschichtskultur. Die Vielfalt der Modernisierung und der verkürzte Abstand zwischen diesen erschweren den Einsatz von vergleichenden Analysen. Herausforderungen bestünden unter anderem in der Alltags- und Sozialgeschichte, der Geschichtskultur, der außereuropäischen Geschichte und in gesellschaftlichen Fragen, wie Globalisierung und Migration. Vor allem die Balance zwischen starkem Reduktionismus und „Wir machen alles, aber nichts richtig“ stelle in der Erstellung von Bildungsplänen eine große Schwierigkeit dar. Die Lehrpläne bestünden weitgehend aus gegenwartsorientierten Längsschnittthemen und gingen daher mit der Gesamttendenz zum fächerübergreifenden Lernen, da Einheiten zum Kulturaustauch oder Migration bereits in einigen Lehrplänen als Pflicht enthalten seien. Dennoch sei der chronologische Durchgang hierdurch nicht ersetzt, sondern durch einzelne Einschübe auf verschiedene Weise ergänzt
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung der fachdidaktischen Diskussion zum Thema „Migrationsgeschichte“
- Vadim Oswalt - Europäische Geschichte im Unterricht einer Migrati-onsgesellschaft
- Beschreibung der Projektarbeit
- Auswahl und didaktische Analyse des Themas
- Ablauf der Projektarbeit
- Materialanalyse
- Angesprochene Kompetenzen
- Reflexion der Ausarbeitung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektarbeit beschäftigt sich mit der Einbindung von Migrationsgeschichte in den Geschichtsunterricht, speziell anhand des Themas der Völkerwanderung und der Wikinger. Die Arbeit verfolgt das Ziel, didaktische Ansätze für die Vermittlung von Migrationsgeschichte zu untersuchen und eine konkrete Unterrichtssequenz für die sechste bis siebte Jahrgangsstufe zu entwickeln.
- Die Bedeutung von Migrationsgeschichte im Geschichtsunterricht
- Die Einbeziehung der Herkunftsländer von Migrantenkindern im Unterricht
- Die Entwicklung eines Raumbewusstseins und die Konstruktion von "Mental maps"
- Die didaktische Umsetzung der Völkerwanderung am Beispiel der Wikinger
- Die Analyse verschiedener Strukturierungskonzepte im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit analysiert die fachdidaktische Diskussion zum Thema Migrationsgeschichte anhand des Aufsatzes von Vadim Oswalt. Oswalt beleuchtet die Integration von Herkunftsländern von Migrantenkindern in den Geschichtsunterricht und die Herausforderungen bei der Integration von Migrationsgeschichte in die bestehenden Lehrpläne.
Der zweite Teil konzentriert sich auf die Beschreibung der Projektarbeit. Hier werden die Auswahl des Themas „Völkerwanderung“ und dessen didaktische Analyse, sowie der Ablauf der Projektarbeit und die verwendeten Materialien vorgestellt. Die Arbeit erläutert zudem, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler durch die Projektarbeit erwerben sollen.
Schlüsselwörter
Migrationsgeschichte, Geschichtsunterricht, Völkerwanderung, Wikinger, Raumbewusstsein, Mental maps, Didaktik, Lehrplan, Unterrichtssequenz, Strukturierungskonzepte, Fallanalyse, Stationenarbeit.
- Quote paper
- Jacqueline Reinisch (Author), 2015, Die Migrationsgeschichte im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/436278