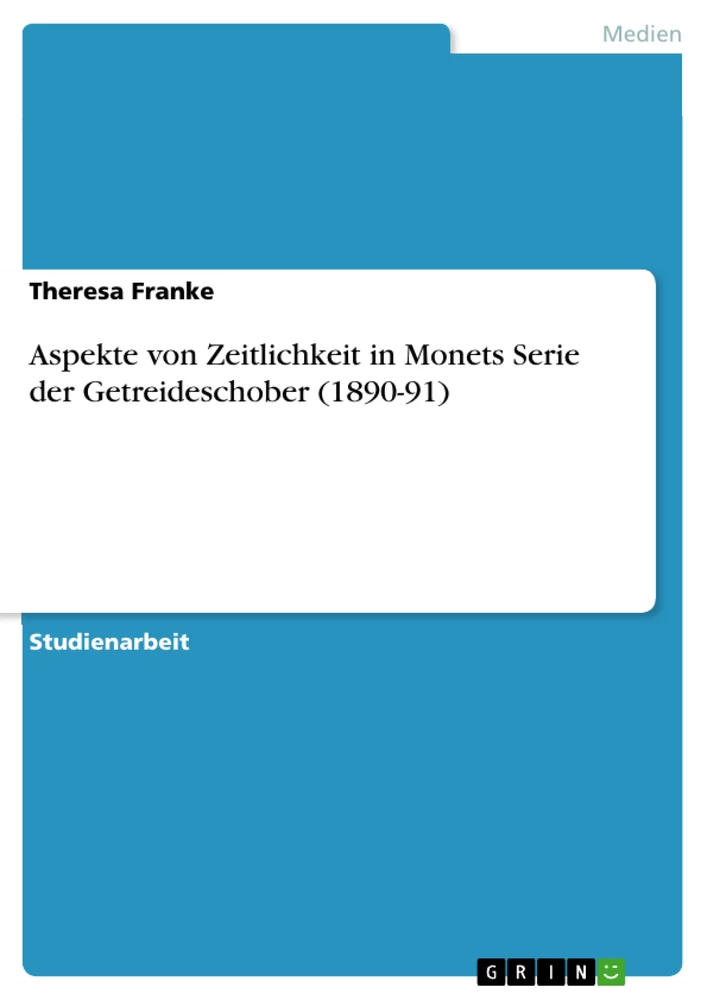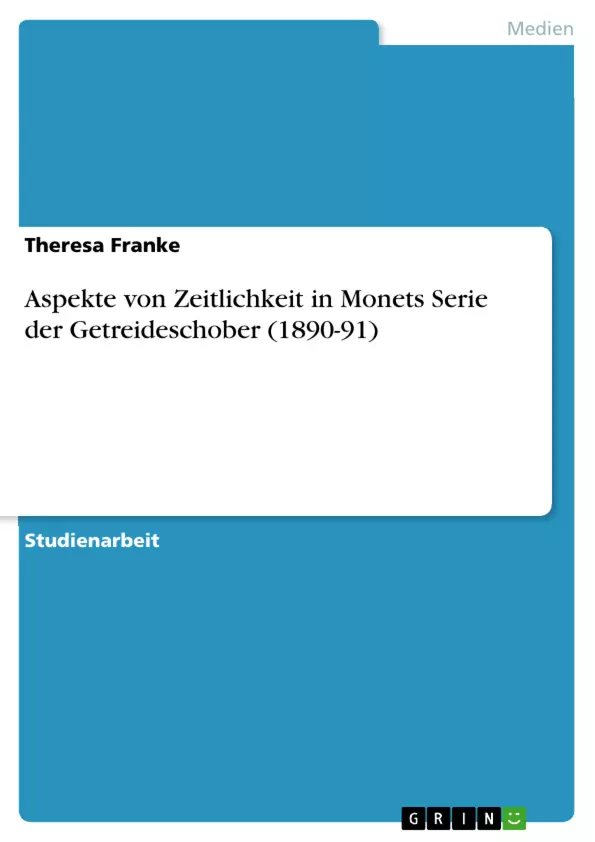Die vorliegende Arbeit untersucht Aspekte der Zeitlichkeit in Monets Serie der Getreideschober. Darstellungen von Zeitlichkeit gab es in verschiedensten Formen bereits seit Beginn der Malerei, doch wurden sie erst in den letzten 30 Jahren zum Gegenstand kunsthistorischer Untersuchungen. Schon in antiken Skulpturen und später in der christlichen Malerei, wurde Zeitlichkeit ins Bild gesetzt, um mythologische oder biblische Erzählungen darzustellen. Dabei spielte die Frage eine Rolle, wie man eine kontinuierliche Handlung oder einen Ablauf in einem einzigen Gemälde oder einer Skulptur zeigen könne. Auch in den nachfolgenden Epochen verlor das Thema nicht an Bedeutung und jede Strömung fand eigene Ausdrucksweisen und Symboliken. Zahlreiche Theoretiker unterschieden verschiedene Methoden und gaben Anweisungen zur Untersuchung eines Gemäldes in Hinsicht auf seine Zeitlichkeitsaspekte.
Mit dem Malen von Bilderserien oder -reihen umgingen einige Künstler schon früh das Problem, nur den einen einzigen Moment darstellen zu müssen, der stellvertretend für eine ganze Handlung steht. Auch Claude Monet, einer der Meister des Impressionismus, der dessen namengebendes Gemälde schuf, malte in den Jahren 1890 und ´91 eine Bilderserie, die nicht nur zu einem Wendepunkt in seiner Malerei werden sollte, sondern auch die „Voraussetzung für die Entstehung der Serie als spezifisch modernes künstlerisches Verfahren“ war. Die Impressionisten hatten sich der Impression verschrieben: dem ersten Eindruck des Malers vor dem Gegenstand und seiner subjektiven Wahrnehmung. In Monets Serie sollte keine kontinuierliche Abfolge oder Handlung mehr dargestellt werden, sondern der Fokus lag auf einer flüchtigen Momentaufnahme und dem Erlebnis des Malers in der freien Natur. Es handelte sich um 15 Bilder von Getreideschobern zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Abgesehen davon meint man hier keine Darstellung von Zeitlichkeit ausmachen zu können, nur Studien desselben Objekts unter verschiedenen Bedingungen des Lichts.
Dennoch scheint diese Serie Aspekte von Zeitlichkeit darzustellen, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Es stellen sich Fragen wie: Wie konstituiert sich die Wahrnehmung der Zeit anhand dieser Bilder? Und welche anderen Faktoren spielen eine Rolle bei der Untersuchung der Zeitlichkeitsaspekte?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- 1. Impressionismus
- 1.1 Mythos der Impression
- 2. Die Serie der Getreideschober
- 2.1 Das Thema der Getreideschober
- 3. Monets Serialität
- 4. Aspekte der Zeitlichkeit
- 4.1 Motivisch
- 4.2 Arbeitsweise
- 4.2.1 Pinselduktus und optische Phänomene
- 4.3 Erinnerung
- 4.4 Fragmentierung der Zeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aspekte der Zeitlichkeit in Claude Monets Serie der Getreideschober (1890-91). Ziel ist es, die werkimmanente Darstellung von Zeitlichkeit zu analysieren und die Rolle von Monets Arbeitsweise und der impressionistischen Ästhetik zu beleuchten.
- Die Darstellung von Zeitlichkeit in der impressionistischen Malerei
- Monets Serie der Getreideschober als Beispiel für seriale Kunst
- Der Einfluss von Licht und Wahrnehmung auf die Darstellung von Zeit
- Die Rolle von Monets Arbeitsweise im Kontext der Zeitlichkeit
- Die Fragmentierung von Zeit in Monets Bildern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Darstellung von Zeitlichkeit in der Malerei ein und stellt die Serie der Getreideschober von Claude Monet als zentralen Untersuchungsgegenstand vor. Sie betont die kunsthistorische Relevanz des Themas und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, welcher die Aspekte der Zeitlichkeit werkimmanent analysieren will. Die Einleitung positioniert die Arbeit im Kontext des Seminars „Darstellung von Zeitlichkeit in Gemälden. Exemplarische Positionen 1300-1900“ und verweist auf die Notwendigkeit einer genaueren Untersuchung der Entstehung und Bedeutung der Serie für Monets Werk und die Entwicklung der modernen Kunst.
1. Impressionismus: Dieses Kapitel beschreibt den Impressionismus als internationale Kunstströmung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es beleuchtet die namengebende Betonung der subjektiven Impression des Gesehenen und die damit verbundenen Techniken wie die Fragmentierung von Pinselstrichen, die Verwendung reiner Farben und das Malen en plein air. Der Fokus liegt auf der Erfassung von Lichtwirkungen und dem Momentanen, inspiriert auch von der Fotografie. Das Kapitel diskutiert die Besonderheiten des impressionistischen Stils im Kontext der Landschaftsmalerei und der Darstellung des modernen Lebens.
1.1 Mythos der Impression: Dieser Abschnitt befasst sich mit der paradoxen Problematik des Impressionismus: die flüchtige Impression auf der Leinwand festzuhalten, obwohl der Malprozess selbst Zeit benötigt. Er analysiert die Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf unmittelbare Wahrnehmung und der Realität des Malprozesses mit Ölfarben und mehreren Farbschichten. Der Abschnitt zitiert zeitgenössische Kritiker wie Jules Laforgue und Félix Fénéon, um die Debatte um die Entstehung und die Bedeutung der „Impression“ zu verdeutlichen und zeigt, wie sich äußere und innere Wahrnehmungsbedingungen während des Malens verändern.
Schlüsselwörter
Impressionismus, Claude Monet, Getreideschober, Zeitlichkeit, Serialität, Wahrnehmung, Licht, Pinselduktus, Malerei, moderne Kunst, Bilderserie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Zeitlichkeit in Monets Getreideschober-Serie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Zeitlichkeit in Claude Monets Serie der Getreideschober (1890-91). Im Fokus steht die werkimmanente Darstellung von Zeit und die Rolle von Monets Arbeitsweise und der impressionistischen Ästhetik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Darstellung von Zeitlichkeit in der impressionistischen Malerei; Monets Getreideschober-Serie als Beispiel serialer Kunst; den Einfluss von Licht und Wahrnehmung auf die Zeitdarstellung; Monets Arbeitsweise im Kontext der Zeitlichkeit; und die Fragmentierung der Zeit in Monets Bildern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit den Kapiteln "Impressionismus" (inkl. Unterkapitel "Mythos der Impression"), "Die Serie der Getreideschober", "Monets Serialität", und "Aspekte der Zeitlichkeit" (mit Unterkapiteln zu Motivisch, Arbeitsweise, Erinnerung und Fragmentierung der Zeit), sowie ein Fazit.
Was wird im Kapitel "Impressionismus" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Impressionismus als Kunstströmung, beleuchtet die Betonung subjektiver Impressionen, die verwendeten Techniken (Fragmentierung, reine Farben, Pleinairmalerei) und die Erfassung von Licht und Momentanen. Es diskutiert den impressionistischen Stil im Kontext der Landschaftsmalerei und der Darstellung des modernen Lebens.
Was ist der Inhalt des Unterkapitels "Mythos der Impression"?
Dieser Abschnitt analysiert die paradoxe Problematik, flüchtige Impressionen auf der Leinwand festzuhalten, trotz des zeitaufwändigen Malprozesses. Er untersucht die Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf unmittelbare Wahrnehmung und der Realität des Malprozesses und zitiert zeitgenössische Kritiker.
Wie wird die Zeitlichkeit in Monets Getreideschober-Serie dargestellt?
Die Arbeit untersucht die werkimmanente Darstellung der Zeitlichkeit in Monets Serie, indem sie die Rolle von Licht, Wahrnehmung, Monets Arbeitsweise (Pinselduktus, mehrere Farbschichten) und die Fragmentierung der Darstellung analysiert. Die Serie dient als Beispiel für seriale Kunst und zeigt die Verknüpfung von äußeren und inneren Wahrnehmungsbedingungen während des Malprozesses.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Impressionismus, Claude Monet, Getreideschober, Zeitlichkeit, Serialität, Wahrnehmung, Licht, Pinselduktus, Malerei, moderne Kunst, Bilderserie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Analyse der werkimmanenten Darstellung von Zeitlichkeit in Monets Getreideschober-Serie und die Beleuchtung der Rolle von Monets Arbeitsweise und der impressionistischen Ästhetik.
- Arbeit zitieren
- Theresa Franke (Autor:in), 2013, Aspekte von Zeitlichkeit in Monets Serie der Getreideschober (1890-91), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/337594