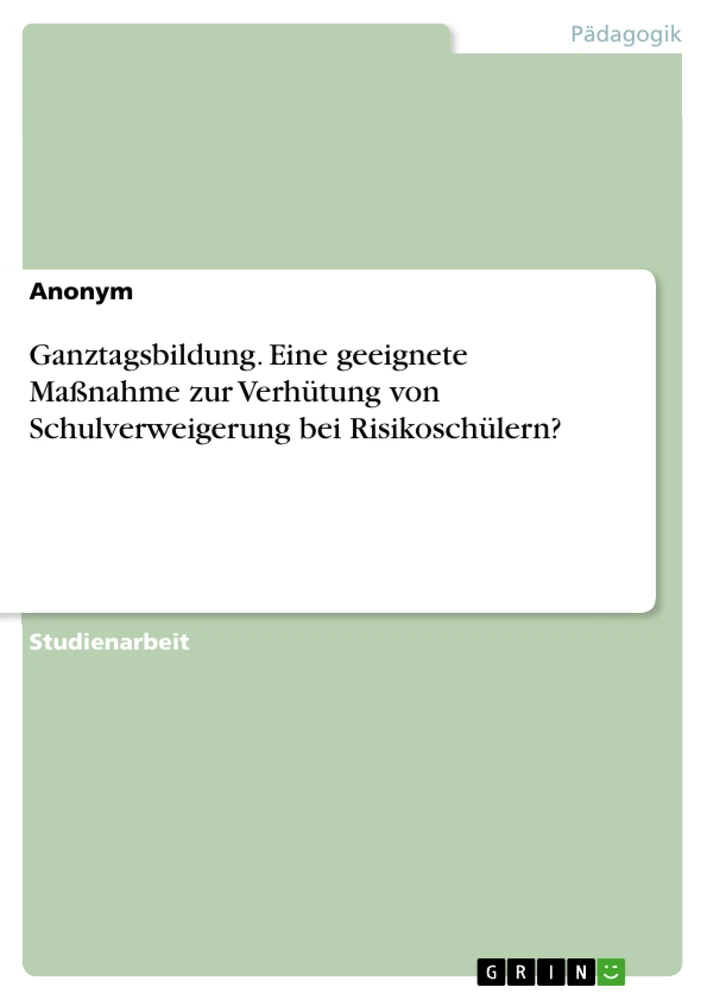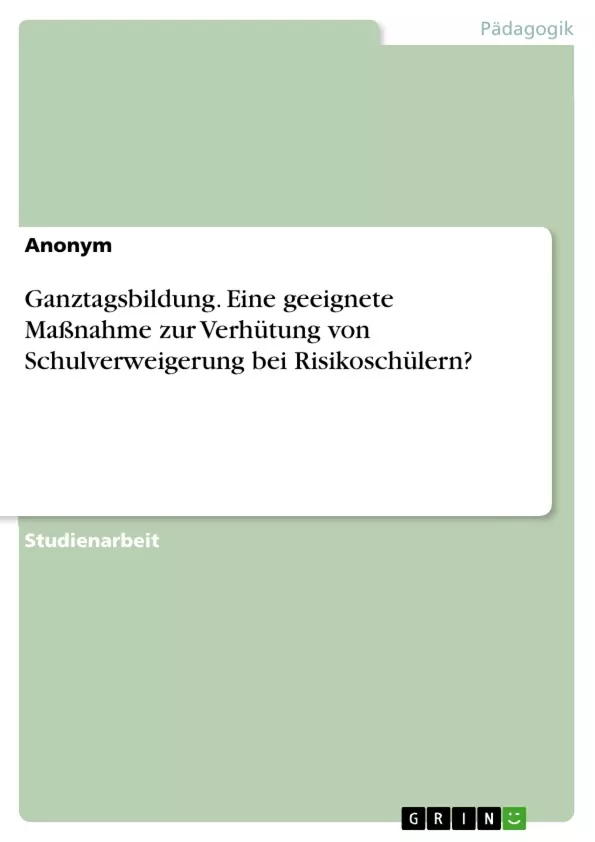Wie kann das Konzept Ganztagsschule "Risikoschülern" konkret helfen Entwicklungs- und Lernbarrieren zu überwinden? Diese Frage wird in der vorliegenden Hausarbeit geklärt.
Das Konzept der Ganztagsschule findet in Deutschland nicht erst seit 2003 Beachtung, sondern wurde bereits zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts durch Reformpädagogen vertreten und führte 1904 schließlich zur Gründung der ersten Ganztagsschule in Deutschland, der Waldschule in Charlottenburg.
Das Konzept Ganztagsschule strebt damals wie heute keine reine Stundenvermehrung an, sondern Inhalte wie Jugendpflege, Sozialpädagogik, Mittagessen und Mittagsruhe, Sport und Spiel, Werkstatt, Labor und Bibliothek sowie Förderung der Schülerinitiative und soll die Institution Schule zu einem Ort jugendgemäßen Lebens und Arbeitens machen. Aber welches Klientel profitiert von den Rahmenbedingungen der Ganztagsschule? Vor PISA und den aktuellen Bildungsreformen wurden die Begrifflichkeiten Ganztagsschule und Ganztagsbildung im Kontext leistungsschwacher, unterrichtsmüder, delinquenter und schulschwänzender Schüler diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Definitionen
- Ganztagsbildung
- Risikoschüler
- Schulverweigerung
- Empirische Befunde
- Merkmale von Ganztagsschulen und deren Auswirkungen auf Risikoschüler
- Definitionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Ganztagsschulen auf Risikoschüler und untersucht, wie das Konzept der Ganztagsbildung dazu beitragen kann, Entwicklungs- und Lernbarrieren dieser Schüler zu überwinden. Der Fokus liegt dabei auf der Definition und Abgrenzung der Begriffe „Ganztagsbildung“, „Risikoschüler“ und „Schulverweigerung“, der empirischen Untersuchung der Relevanz von Förderung für Risikoschüler sowie der Darstellung von Beispielen, wie Risikoschüler konkret vom Ganztagsschulkonzept profitieren können.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Ganztagsbildung“, „Risikoschüler“ und „Schulverweigerung“
- Empirische Untersuchung der Relevanz von Förderung für Risikoschüler
- Analyse der Auswirkungen von Ganztagsschulen auf Risikoschüler
- Beispiele für die Förderung von Risikoschülern im Ganztagsbetrieb
- Potenziale und Herausforderungen der Ganztagsbildung im Kontext der Risikoschülerförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Ganztagsbildungskonzepts in Deutschland, ausgehend von den Reformpädagogen des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu den aktuellen Reformbemühungen im Kontext der PISA-Studien. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Ganztagsbildung und dem Konzept der Risikoschüler her, das in den PISA-Studien aufgekommen ist.
- Hauptteil: Der Hauptteil beschäftigt sich mit der Definition der zentralen Begriffe „Ganztagsbildung“, „Risikoschüler“ und „Schulverweigerung“. Dabei werden verschiedene Ansätze und Perspektiven auf die Definition dieser Begriffe beleuchtet und die spezifischen Herausforderungen im Kontext der Risikoschülerförderung herausgestellt. Des Weiteren werden empirische Befunde präsentiert, die den Einfluss von Ganztagsschulen auf die Lernleistung und die Entwicklung von Risikoschülern beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselfragen der Ganztagsbildung, Risikoschüler, Schulverweigerung, Bildungsdefizite, Fördermöglichkeiten und empirische Befunde. Sie analysiert die Präventivwirkung von Ganztagsschulmodellen in Bezug auf die Schulverweigerung und beleuchtet die Bedeutung der Förderung von Risikoschülern im Kontext der Ganztagsbildung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Ganztagsbildung. Eine geeignete Maßnahme zur Verhütung von Schulverweigerung bei Risikoschülern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/319213