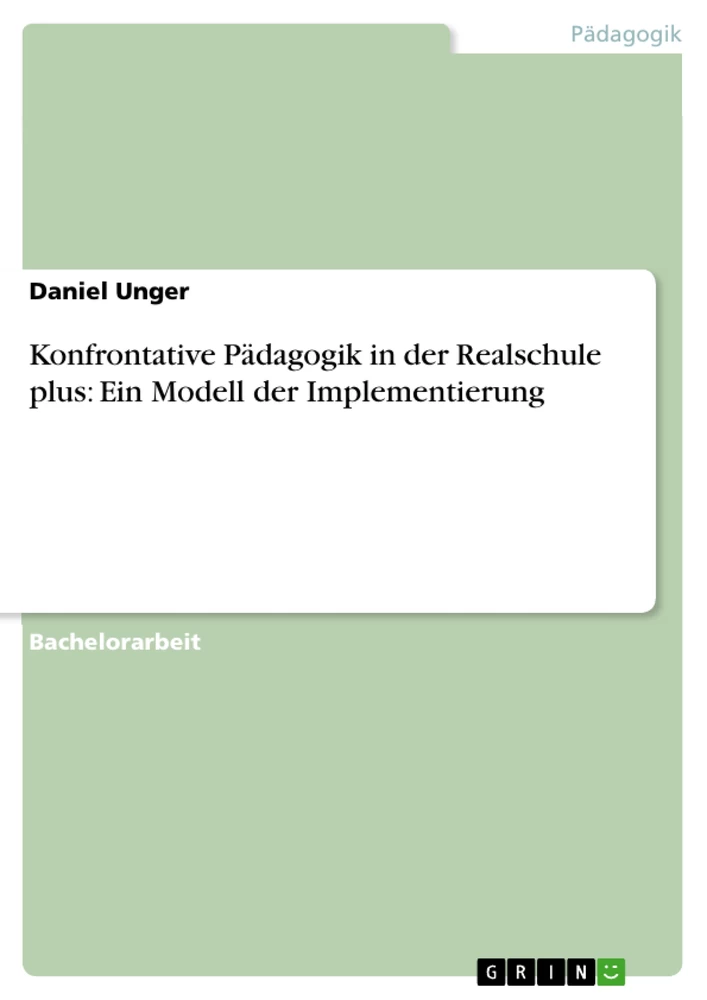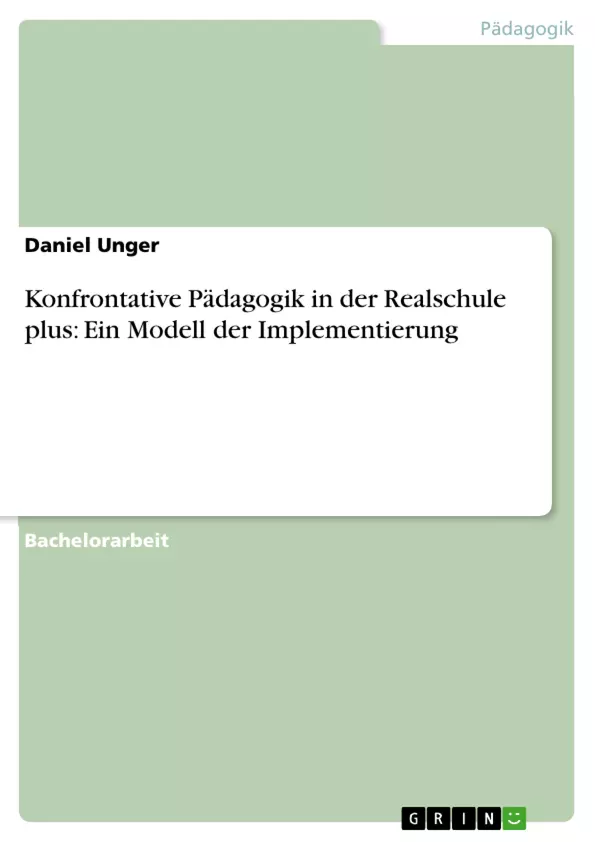Gegenstand der vorliegenden Bachelorarbeit ist die Konfrontative Pädagogik und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Schule mit dem Schwerpunkt der Realschule plus. Die Kon-frontative Pädagogik ist eine Methode aus der Straffälligenhilfe und hat ihren Ursprung in den amerikanischen Bootcamps. Sie existieren seit 1983 und sind nach dem Vorbild militärischer Grundausbildungslager eingerichtet worden. In Deutschland wurden sie später in verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit erprobt und findet heutzutage auch in anderen Bereichen, z.B. in der Schulpädagogik, Anwendung. Seit ihrem Bestehen polarisiert die Konfrontative Pädagogik. Sie sorgt in der Fachöffentlichkeit aufgrund ihrer Leitlinien für erhebliche Irritation und ihre Methoden und Wirkungen werden sehr unterschiedlich bewertet. Die in Deutschland in den letzten 10-15 Jahren drastisch angestiegene Jugendgewalt verlangte lautstark nach alternativen pädagogischen Lösungen und Methoden. Seitdem erfreut sich die Konfrontative Pädagogik wachsender Beliebtheit und ihr Ansehen ist gestiegen. In Deutschland existieren mittlerweile verschiedene Schulen, die konfrontative Ansätze in ihr schulisches Gesamtkonzept integriert haben und in enger Kooperation zu externen Institutionen wie der Jugendhilfe stehen. Anwendungsformen der konfrontativen Pädagogik sind beispielsweise das Anti-Aggressivitäts-Training (AAT), das Coolness-Training (CT) oder das Konfrontative soziale Training (KST). In meiner Bachelorarbeit befasse ich mich zu Beginn mit den Merkmalen der Konfrontativen Pädagogik und zeige auf, wo ihre Anwendungsbereiche liegen. In diesem Zusammenhang gehe ich ebenfalls auf ihre historische und aktuelle Entwicklung in Deutschland ein. Anschließend thematisiere ich ihre Ursprünge und erläutere vertiefend die Merkmale amerikanischer Bootcamps anhand exemplarischer Einrichtungen. Daraufhin erörtere ich die normativen Rahmenbedingungen, die im Hinblick auf eine Anwendung in der Schule bestehen. Kernthema und zugleich Motivation meiner Arbeit ist es herauszufinden, inwiefern die Ziele der Konfrontativen Pädagogik mit den Zielen der normativen Vorgaben der Schule übereinstimmen und inwiefern eine Anwendung in der Schule realisierbar ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Konfrontative Pädagogik
2.1 Begriffsdefinition und allgemeine Merkmale
2.2 Historische und aktuelle Entwicklung
2.3 Anwendungsbereiche
3 Boot camps
3.1 Gesellschaftliche und kriminalpolitische Hintergründe
3.2 Begriffsdefinition und allgemeine Merkmale
3.3 Entwicklung und Status Quo
3.4 Einrichtungsbeispiel
4 Konfrontative Pädagogik in der Schule
4.1 Normative Rahmenbedingungen
4.2 Grundsätzliche Strategien und Ziele
4.3 Ziele der Konfrontativen Pädagogik – Normative Vorgaben
4.4 Konfrontative Programme für die Realschule plus
5 Modellprojekt
6 Fazit und Handlungsperspektiven
7 Literaturverzeichnis
8 Abbildungsverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konfrontative Pädagogik?
Es ist eine pädagogische Methode, die ursprünglich aus der Straffälligenhilfe stammt und darauf abzielt, aggressives Verhalten durch klare Grenzen und direkte Konfrontation mit dem eigenen Handeln zu korrigieren.
Wo liegen die Ursprünge dieser Methode?
Die Wurzeln liegen in den US-amerikanischen Bootcamps der 1980er Jahre, die nach militärischem Vorbild zur Disziplinierung von Jugendlichen eingesetzt wurden.
Welche Programme werden in Schulen wie der Realschule plus genutzt?
Gängige Anwendungen sind das Anti-Aggressivitäts-Training (AAT), das Coolness-Training (CT) und das Konfrontative soziale Training (KST).
Warum wird die Konfrontative Pädagogik kontrovers diskutiert?
Kritiker sehen in den Methoden oft eine Verletzung pädagogischer Grundsätze, während Befürworter sie als notwendige Antwort auf steigende Jugendgewalt betrachten.
Wie lässt sich der Ansatz in den Schulalltag integrieren?
Die Arbeit untersucht, wie konfrontative Ansätze mit den normativen Vorgaben der Schule übereinstimmen und durch Kooperationen mit der Jugendhilfe implementiert werden können.
- Quote paper
- Daniel Unger (Author), 2011, Konfrontative Pädagogik in der Realschule plus: Ein Modell der Implementierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/201116