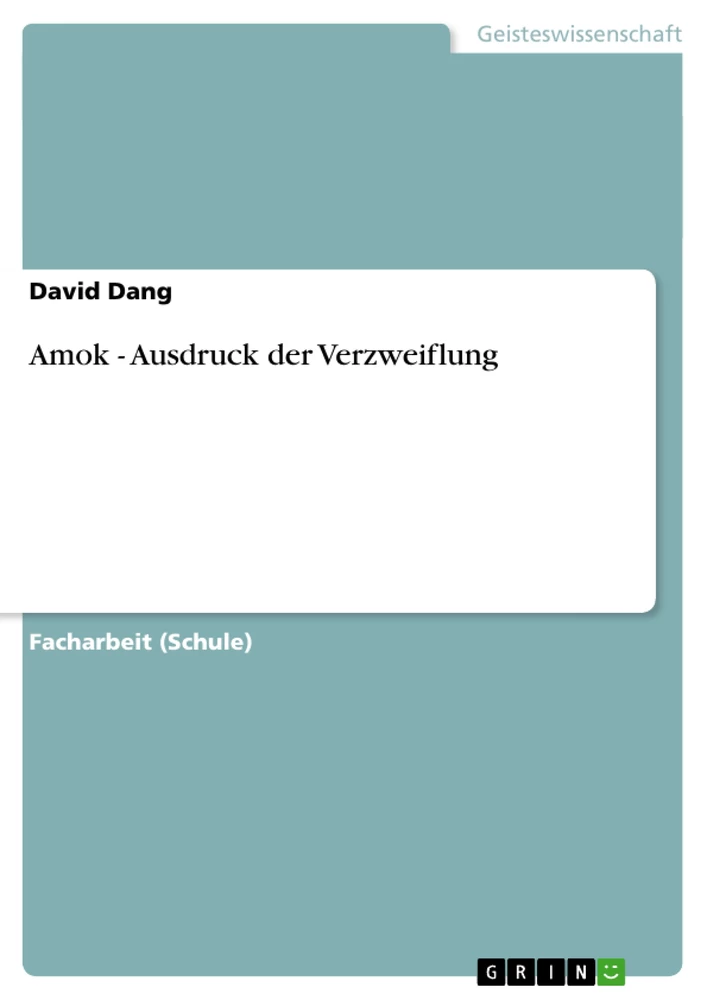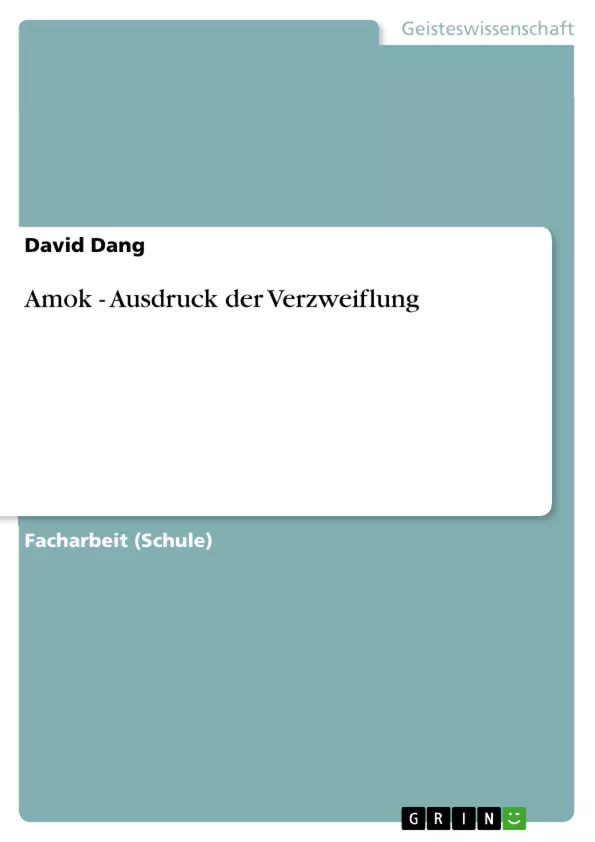„I don‘t like Mondays“. Diese Aussage nannte Brenda Ann Spencer als Grund für ihre schreckliche Tat, die sich am 29. Januar 1979 vor der Grover Cleveland Elementarity School in San Diego ereignete. Zu diesem Zeitpunkt war die Täterin gerade einmal 16 Jahre alt, als sie mit einem Gewehr das elterliche Haus verließ und zwei Menschen erschoss. Eine Tragödie, deren tatsächliche Ursache ein Rätsel bleibt. Der Ausspruch „I don't like Mondays“ unterstreicht die Sinnlosigkeit des Massakers und sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. Aufgrund dieser Tat veröffentlichte Sänger Bob Geldof mit der irischen Popgruppe The Boomtown Rats noch im selben Jahr das Lied „I don’t like Mondays“, welches in den 80-ern zum erfolgreichen Hit wurde.
Schon damals gewann das Thema „Amok“ an Bedeutung und die öffentliche Aufmerksamkeit, vor allem nach einer begangenen Tat. Dieser Effekt der Medien ist heute stärker ausgeprägt als jemals zuvor. Dabei gilt:
Je mehr Opfer ein Amoklauf fordert, desto höher das Medieninteresse.
Statistiken zufolge sind die Fallzahlen von Amoktaten, sowohl im privaten als auch öffentlichen Raum, in den letzten 15 Jahren angestiegen.
Dieser Fakt provoziert die Frage, ob wir uns noch häufiger auf Gewalttaten, wie in Deutschland vor allem zuletzt in Winnenden geschehen, einstellen müssen, die von Schülern begangen werden.
Nachdem mich die erschütternde Nachricht vom Amoklauf in Winnenden erreichte, war ich, wie meine Mitschüler und alle Personen, die ich kenne, schockiert und habe festgestellt, dass ich mich nie mit diesem Thema auseinander gesetzt habe, dass ich kaum Kenntnisse besitze und dass die Berichterstattung in den Medien und die öffentlich geführte Diskussionen mich zunehmend verwirrten. Auch in meiner Klasse hatte ich den Eindruck, dass sich die Schüler gerne näher mit dem Thema auseinander setzen möchten, es dazu jedoch bislang kein Angebot in der Schule gab. Hier sah und sehe ich Nachholbedarf. Somit wählte ich das Thema Amok, insbesondere an Schulen, aus, um mich im Rahmen der Facharbeit intensiver mit dem Themenkomplex befassen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorgeschichte des Amoklaufs
- 2.1 Begriffsbestimmung und Definitionen
- 2.2 Herkunft und Historie
- 2.2.1 Kriegerischer Amok
- 2.2.2 Individueller Amok
- 2.3 Bilanz
- 3. Spezielle Form des Amoks: „School-Shootings“
- 3.1 Etymologie
- 3.2 Definition
- 3.3 Der erweiterte Suizid
- 4. Vergleich von drei Amokläufen
- 4.1 Columbine
- 4.1.1 Vorgeschichte und Tatplanung
- 4.1.2 Tathergang
- 4.1.3 Die Täter Eric Harris und Dylan Klebold
- 4.1.4 Bilanz
- 4.2 Emsdetten
- 4.2.1 Vorgeschichte und Tatplanung
- 4.2.2 Tathergang
- 4.2.3 Der Täter Bastian Bosse
- 4.2.4 Erworbene Waffen
- 4.2.5 Der Abschiedsbrief
- 4.2.6 Bilanz
- 4.3 Winnenden
- 4.3.1 Vorgeschichte und Tatplanung
- 4.3.2 Tathergang
- 4.3.3 Der Täter Tim Kretschmer
- 4.3.4 Der Abschiedsbrief
- 4.3.5 Bilanz
- 4.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Amokläufe
- 5. Die Mythen: Urteil oder Vorurteil?
- 5.1 Mythos I
- 5.2 Mythos II
- 5.3 Mythos III
- 5.4 Mythos IV
- 5.5 „Medienmanipulation“
- 6. Empirischer Abschnitt (Teil 1)
- 6.1 Interview mit Dorothee Dienstbühl
- 6.2 Interview mit Dr. Uwe Füllgrabe
- 7. Empirischer Abschnitt (Teil II)
- 7.1 Methodische Vorgehensweisen
- 7.2 Anmerkung zur Durchführung
- 7.3 Die drei verschiedenen Umfragebögen
- 7.3.1 Bogen I: Schüler von 10-14 Jahre
- 7.3.2 Bogen II: Schüler von 15-17 Jahre
- 7.3.3 Bogen III: Lehrer
- 7.4 Auswertungen der Umfragen
- 7.4.1 Hauptschule
- 7.4.2 Realschule
- 7.4.3 Gymnasium
- 7.4.4 Lehrpersonal
- 7.4.5 Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Phänomen des Amoklaufs, insbesondere im Kontext von „School Shootings“. Ziel ist es, die Vorgeschichte, die Ursachen und die Besonderheiten solcher Taten zu beleuchten und anhand von Fallbeispielen (Columbine, Emsdetten, Winnenden) zu analysieren. Die Arbeit beinhaltet auch einen empirischen Teil mit Interviews und Umfragen, um verschiedene Perspektiven auf das Thema zu erfassen.
- Definition und historische Entwicklung des Amoklaufs
- Vergleichende Analyse verschiedener Amokläufe
- Analyse von Mythen und Vorurteilen im Zusammenhang mit Amokläufen
- Ergebnisse empirischer Untersuchungen zu Schüler- und Lehrerperspektiven
- Der Einfluss der Medienberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Motivation der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Vorgeschichte des Amoklaufs, Definitionen und historische Entwicklungen. Kapitel 3 konzentriert sich auf die spezifische Form der „School Shootings“. Kapitel 4 vergleicht drei bekannte Amokläufe (Columbine, Emsdetten, Winnenden) hinsichtlich ihrer Vorgeschichte, des Tathergangs und der Täterprofile. Kapitel 5 analysiert verbreitete Mythen und Vorurteile im Zusammenhang mit Amokläufen. Der empirische Teil (Kapitel 6 und 7) beschreibt die Methodik und Ergebnisse von Interviews und Umfragen unter Schülern und Lehrern.
Schlüsselwörter
Amok lauf, School Shooting, Gewalt an Schulen, Medienberichterstattung, Täterprofil, Motivforschung, empirische Studie, Jugendgewalt, präventive Maßnahmen.
- Arbeit zitieren
- David Dang (Autor:in), 2010, Amok - Ausdruck der Verzweiflung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/183483