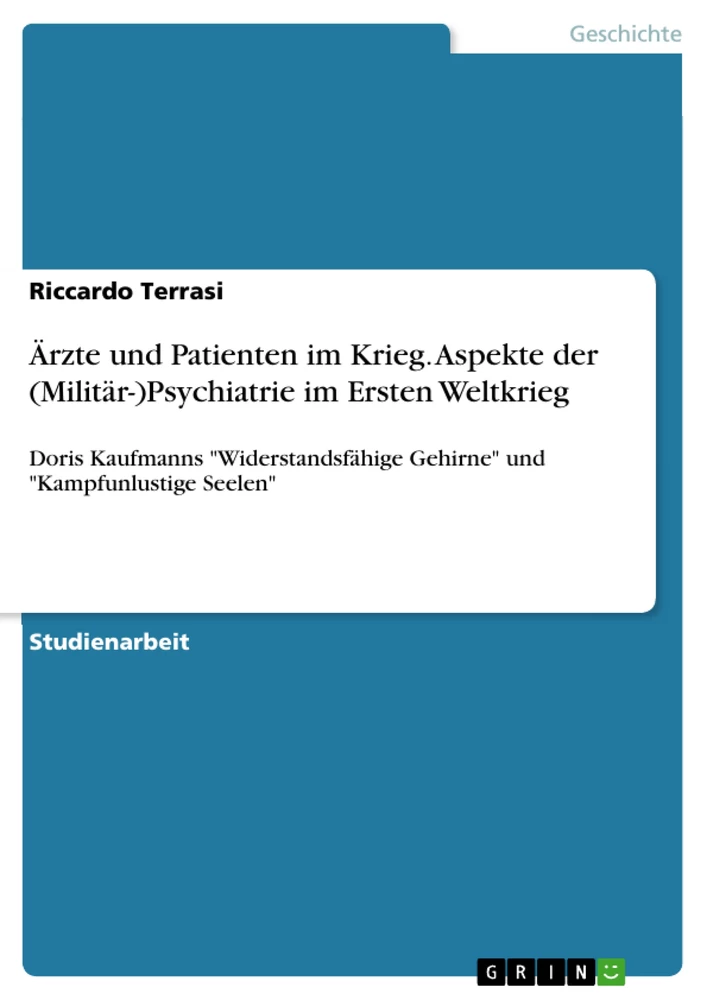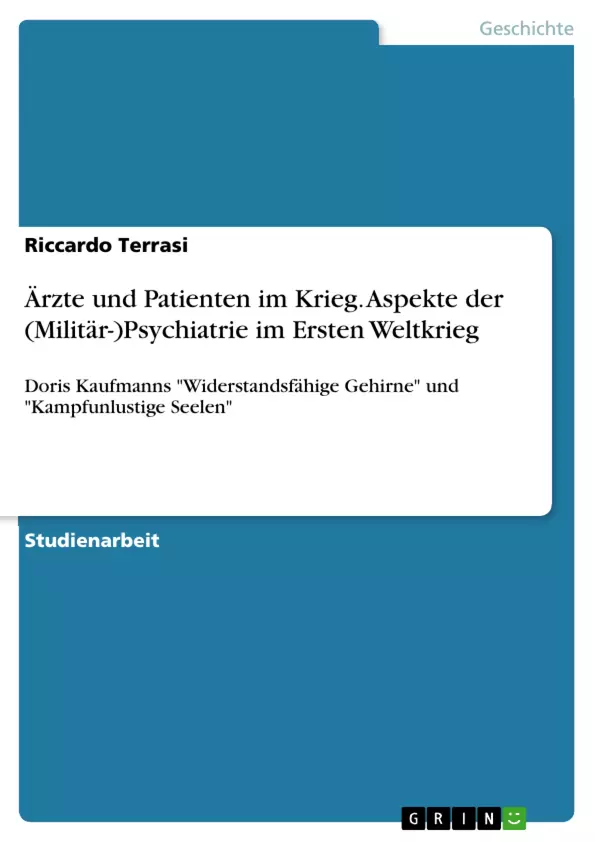Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Psychiatrie während des Ersten Weltkriegs. Es wird die mentalitätsgeschichtliche Frage beleuchtet, inwieweit die Psychiater in ihren Diagnosen gemäß des Zeitgeistes handelten, oder ob sie unter dem Einfluss der politischen gegebenheiten diagnostizierten.
Gestützt wurde sich dabei auf den Aufsatz der Historikerin Doris Kaufmann mit dem Titel ""Widerstandsfähige Gehirne" und "kampfunlustige Seelen". Angereichert wurde sie mit aus der Veranstaltung erhaltenen Informationen und Fachliteratur. Am Ende befindet sich ein Literaturverzeichnis, welches hilfreiche Darstellungen zum Thema enthält.
Inhalt
Einführung
Zur Mentalitäts- und Wissenschaftsgeschichte des I. Weltkriegs
I. Wie wurde psychiatrisches Wissen über den „Faktor Mensch im Krieg“ geschaffen?
II. Die Psychiatrische Sinndeutung des Ersten Weltkriegs und die Interpretation der Kriegserfahrung auf gesellschaftlicher und individueller Ebene nach 1918
Resümee
Literaturverzeichnis
Einführung
Der Erste Weltkrieg ist in einem wesentlichen Punkt von allen vorangegangenen Kriegen unterscheidbar: Zum ersten Mal kam es zu einem massenhaften Auftreten psychischer Erkrankungen bei Soldaten. Die Ursachen für dieses Phänomen waren vielfältig. Im August 1914 war die Mehrheit der deutschen Bevölkerung von einer allgemeinen Kriegsbegeisterung erfasst. Jene Euphorie, die gerne als „August-Erlebnis“[1] bezeichnet wird, musste schon in den ersten Kriegsmonaten einem Gefühl der Ernüchterung weichen. Die Soldaten waren mit falschen Erwartungen in diesen Krieg gezogen, sie rechneten mit einem schnellen Sieg gegen einen unterlegenen Gegner. Doch die Dimension eines „industrialisierten Krieges“ wurde unterschätzt. Modernste Waffentechnik wie Artillerie, Maschinengewehre und Giftgas straften der Vorstellung eines Kampfes „Mann gegen Mann“ bald Lügen. Schon im November erstarrte die deutsche Front im Westen, es war ein Stellungskrieg entstanden. Bewegungslosigkeit, Materialschlachten und Desillusionierung hatten wesentlichen Anteil am Auftreten psychischer Erkrankungen bei Soldaten.
Die Ärzteschaft im Wilhelminischen Reich teilte mit wenigen Ausnahmen die kriegsbejahende Haltung des Volkes. Sie konnte sich in ihrer Argumentation auf eine wissenschaftliche Grundlage stützen, beruhend auf biologistischen und sozialdarwinistischen Ideologien. Der Krieg wurde von vielen als „Reinigung des Volkskörpers“ wahrgenommen, als natürlicher Selektionsprozess, der die Auslese der „minderwertigeren“ Individuen begünstigte und somit eine sinnstiftende Funktion erhielt.[2] Die Mehrheit der Ärzte verstand sich als „unpolitisch“ und nur an der Erforschung naturwissenschaftlicher Wahrheit interessier[3] Ihre Erkenntnisse besaßen eine hohe Glaubwürdigkeit und wurden kaum in Frage gestellt. Sozialdarwinistische und rassenhygienische Ideologien fanden somit Eingang ins kollektive Bewusstsein der Gesellschaft.
Die Arbeit Doris Kaufmanns beschäftigt sich zentral mit der Frage, wie es im 19. und 20. Jahrhundert zu einer Verwissenschaftlichung sozialer Phänomene kommen konnte, an welcher die Psychiatrie maßgeblichen Anteil hatte. Sie schildert ferner explizit die Rahmenbedingungen, die im Ersten Weltkrieg bei der Überantwortung seelisch Verletzter an psychiatrische Einrichtungen bestanden. Auch die Ziele und Ambitionen der Untersuchungen werden erläutert.
Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die Wissenschaftler nach eigenem Ermessen handeln konnten, oder dem Staat als Instrument zur Durchsetzung militärischer Interessen dienen mussten. Lagen den Diagnosen der Psychiater vorwiegend politische Ambitionen zugrunde, hatten sie also keine andere Wahl als „kriegskonforme“ Theorien in die Praxis umzusetzen? Oder Urteilten sie tatsächlich nach eigenem Gewissen, dem damaligen Stand der Forschung entsprechend? Diese Fragen, die für die historische Aufarbeitung der Militärpsychiatrie im Ersten Weltkrieg von hoher Brisanz sind, gilt es zu klären.
In dieser Arbeit wurde sich auf die Darstellung Doris Kaufmanns mit dem Titel: „Widerstandfähige Gehirne“ und „kampfunlustige Seelen“. Zur Mentalitäts- und Wissenschaftsgeschichte des I. Weltkriegs.“ gestützt. Weitere Literatur wurde ergänzend hinzugezogen.
Zur Mentalitäts- und Wissenschaftsgeschichte des I. Weltkriegs
Zu Beginn ihrer Ausführungen gibt Doris Kaufmann eine Zahl des Deutschen Kriegssanitätsberichts von 1914-18, in welchem 613.047 Kriegsteilnehmer aufgeführt werden, die wegen Krankheiten des Nervengebietes in Lazaretten behandelt worden waren.[4] Unter besagte Krankheiten fielen Lähmungen, dauerndes Erbrechen, Taubheit, zeitweilige Stummheit, Blindheit und Delieren[5]. Die Betroffenen Patienten wurden Kriegshysteriker, Kriegszitterer, Schreck-neurotiker oder Kriegsneurotiker genannt.
Die Darstellung Kaufmanns gliedert sich in zwei Teile, die in ihrer Einleitung kurz umrissen werden. Im ersten Abschnitt untersucht die Historikerin, wie sich der Prozess der „Verwissenschaftlichung“ des Sozialen vollzog und welche Rolle wissenschaftliche Experten dabei spielten. Des Weiteren wird geschildert, welches Wissen im Ersten Weltkrieg überhaupt über den „Faktor Mensch“ vorhanden war und ob politische Ambitionen bei psychiatrischen Diagnosen eine übergeordnete Rolle spielten, oder nicht. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der psychiatrischen Sinndeutung und geht der Frage nach, wie das Kriegsgeschehen in der Psychiatrie interpretiert wurde.
In der nun folgenden Schilderung der Rahmenbedingungen des Ersten Weltkriegs wird dieser als „Industrialisierter Krieg“ bezeichnet, der von den Soldaten eine neuartige Disziplinierung verlangte. Neben räumlichen und akustischen Erfahrungen stellte diese eine der Ursachen für psychische Erkrankungen dar.
Einige Autoren[6] interpretierten die Vorgehensweisen der Psychiatrien in erster Linie als Durchsetzung militärischer Interessen, was sich nach ihrer Ansicht vor allem an den harten, an Folter grenzenden Therapiemethoden zeigte. Die Psychiatrien wollten die Patienten innerhalb möglichst kurzer Zeit zurück in den Kriegsdienst schicken, sie werden bei besagten Autoren also vor allem als Instanz zur Sozialdisziplinierung im Dienst militärischer Interessen thematisiert.[7]
Am Ende der Einleitung bezieht Doris Kaufmann Stellung zu diesem Aspekt; sie spricht sich dafür aus, dass die Wissenschaft nicht ausschließlich an die Regierung gebunden war, sondern vor allem gemäß des Zeitgeistes handelte und diagnostizierte. Sie kritisiert an dieser Stelle, dass dieser Faktor in der historischen Arbeit oft unterschätzt wurde und häufig allein die Regierung für die Tätigkeiten der Psychiatrien verantwortlich gemacht wurde. Die Eigenverantwortung, die die wissenschaftlichen Experten übernahmen, fand dagegen kaum Berücksichtigung.
I. Wie wurde psychiatrisches Wissen über den „Faktor Mensch im Krieg“ geschaffen?
Wie von der Mehrheit der Bevölkerung, so wurde auch von den Psychiatrien der Kriegsausbruch 1914 begrüßt, die ihm eine positive Auswirkung auf die „Volksseele“ zusprachen.[8] Der Psychiatrieprofessor Otto Binswanger äußerte sich dahingehend, dass viele psychische Erkrankungen junger Menschen bei Kriegsausbruch zurückgegangen seien. Seine Ansicht musste jedoch bald der Realität weichen und einer seiner Kollegen stellte fest, dass schon zu Beginn des Krieges deutlich wurde, dass bei einigen das „[...] Nervensystem für die Strapazen und Grauen des modernen Krieges schlechterdings nicht ausreicht“.[9] Dass viele Soldaten vor allem durch laute Geräusche Schäden davon trugen, wurde vom Direktor der Tübinger Nervenklinik Robert Gaupp festgestellt. Dieses Thema handelte er in seinem Aufsatz „Hysterie und Kriegsdienst“ ab. Darin erläuterte er, dass die Hauptursache für psychische Erkrankungen im Krieg die lauten Geräusche z. B. das „Platzen“ von Granaten seien.[10]
Um die Jahrhundertwende wurde von der Psychiatrie der Versuch unternommen, die „Hysterie“ psychologisch zu erklären, wobei man zu dem Ergebnis kam, dass es bei einigen Menschen eine verborgene Verletzung des zentralen Nervensystems gäbe. Man nahm bei der Hysterie folglich eine körperlich bedingte Ursache an. Ausgelöst würde diese durch gleichzeitige mechanische und psychische Erschütterung, dies war bereits bei Eisenbahnunfällen beobachtet worden.[11]
Eine körperlich bedingte psychopathische Konstitution (worunter man Schwächezustände und Entwicklungsstörungen des Zentralen Nervensystems verstand) wurde als erblich angesehen. Dieses Defizit galt als charakteristisch für das weibliche Geschlecht,[12] während Männer (in den meisten Fällen Arbeiter) mit derartigen Mängeln als „Declassierte“ bezeichnet wurden.
Bei der Hysterie-Debatte spaltete sich die Ärzteschaft in zwei Lager: die Mehrheit stellte bei Soldaten, die im Krieg mit psychischen Erkrankungen eingewiesen wurden, die Diagnose „Hysterie“. Das Zweite Lager, welches nur eine Minderheit repräsentierte, bezeichnete dagegen die Erkrankungen als „traumatische Neurosen“. Der Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten ist der, dass bei Ärzten, die mit „Hysterie“ argumentierten, eine Simulation des Patienten angenommen wurde. Eingewiesene Soldaten mit der Diagnose „Hysterie“ wurden folglich nicht als tatsächlich krank, sondern als Simulanten gesehen.[13] Bernd Ulrich und Benjamin Ziemann schrieben über das Kriegsjahr 1916: „Soldaten, die nach tagelangem Trommelfeuer die Nerven verloren, galten gemeinhin als Feiglinge oder sogar als Simulanten.“[14]
Die Debatte war in erster Linie ökonomisch motiviert, denn die seit 1883 bestehende gesetzliche Rentenversicherung sah es vor, dass Soldaten, die durch Kriegshandlungen verletzt wurden, Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung hatten.[15] Für den Staat wäre es ökonomisch nicht tragbar gewesen, hätte jeder Patient mit kriegsbedingter Neurose Anspruch auf eine Rente geltend machen können. Somit wurde von den Psychiatrien eine sehr unmenschliche Behandlungsweise durchgeführt, die die „Simulanten“ möglichst schnell zurück an die Front bringen sollte.[16]
Die Beschäftigung mit dem Phänomen der Hysterie stieß auch jenseits der Wissenschaftler bei der einfachen Bevölkerung auf großes Interesse, Kaufmann spricht von einem regelrechten „Mainstream“[17]. Die Psychiatrie beschäftigte sich mit dem Thema als soziales Phänomen, sie ging davon aus, dass das Verhalten eines Menschen Auskunft über seinen Geisteszustand gibt.[18] Wenn man also die Hysterie als soziales Phänomen begriff, konnte man die pseudowissenschaftliche Diskussion auch auf andere gesellschaftliche „Abnormitäten“ ausweiten, wie zum Beispiel auf straffällige Nichtsesshafte, Prostituierte, Unverheiratete Mütter, Künstler und politisch Oppositionelle. Es wurde also vom nicht-gesellschaftskonformen Verhalten eines Menschen auf seinen Geisteszustand geschlossen und „sozialstrukturelle Krisenphänomene wurden in medizinische Krankheitsbilder umgedeutet“.[19] Die Ärzteschaft konnte sich dabei auf eine vermeintlich rationale naturwissenschaftliche Basis stützen, die den Staat als einen sozialen Organismus verstand und sich auf das 1859 von Charles Darwin veröffentlichte Werk „Die Entstehung der Arten“ berief.[20] Soziale und politische Begriffe wurden in einen biologischen Kontext gesetzt.
Die Psychiatrie war um die Jahrhundertwende an der „Rassenhygiene“ beteiligt. Es gab Verbände, die die Bekämpfung von Syphilis, Prostitution und Alkoholismus als Zielsetzung hatten. Psychiater erhielten oft einflussreiche Positionen als Gutachter, auch wurden viele staatliche Irrenanstalten zur Behandlung von Geisteskranken eingerichtet.[21] Man kann die Geschichte der Psychiatrie bis 1914 als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnen. Schon zu Beginn des Krieges kam ihnen die bedeutsame Funktion zu, psychisch erkrankte Soldaten zu untersuchen, was Unterstützung bei der Obersten Heeresleitung fand. Diesbezüglich fuhr Deutschland einen Sonderweg, in anderen Staaten wie Italien, Frankreich oder England wurden Soldaten, die nicht mehr kämpfen konnten oder wollten, vor die Kriegsgerichte gestellt. In Deutschland waren die Militärgerichte mit ausgebildeten Juristen besetzt, die gegebenenfalls Psychiater heranzogen.[22] Der umfassende Einsatz von Militärpsychiatern wird als „scientific community“ bezeichnet.
Schon nach Ablauf des ersten Kriegsjahres waren über 100.000 Soldaten mit Symptomen von Hysterie in den Feld- und Heimatlazaretten behandelt worden. Zunächst wurde angenommen, sie seien durch Granatexplosionen und den Anblick ihrer toten Kameraden an traumatischer Neurose erkrankt, später unterstellte man den zahlreichen Patienten Simulation, eine „Flucht aus dem Krieg in die Krankheit“.[23] Daraufhin kam es zur Anwendung drastischer Therapiemethoden, um den „schwachen Willen“ wiederherzustellen. Zum Einsatz kamen so genannte Ekelkuren, Dunkelarrest, Scheinoperationen sowie Elektroschocks. Die psychiatrische Behandlung sollte der Disziplinierung dienen, sie musste den Patienten schlimmer erscheinen, als das Schlachtgeschehen.
Die Annahme, es würde in hohem Maße simuliert, verstärkte sich noch Ende September 1916, als die psychopathischen Zusammenbrüche an der Front weiter anstiegen. Den meisten warfen die Psychiater eine „wunschbedingte hysterische Symptombildung“ vor um nicht mehr kämpfen zu müssen und eine Rente zu beziehen. Zudem kam es häufig erst im Lazarett zu Symptomen, sodass den Patienten vorgeworfen wurde, sie hätten sich diese bei anderen Behandelten abgeschaut. Die Tatsache, dass Schwerverwundete keine Symptome einer Neurose zeigten, bestätigte natürlich die Theorie, dass viele simulierten, die nicht schwer verletzt waren.
Bei denjenigen Patienten, bei denen tatsächlich von einer kriegsbedingten Neurose ausgegangen wurde, glaubten die Psychiater sie seien von ihrer Beschaffenheit nicht für den Krieg konzipiert. Denn der Krieg wurde als eine menschliche Extremsituation begriffen, der normale Menschen gewachsen seien. Dies läge daran, dass der Mensch mit zwei entscheidenden Materialien ausgestattet sei: erstens „mit einem Gehirn, das seine Anpassungsfähigkeit an äußere Schädigungen in hervorragender Weise unter Beweis stellte“[24] und zweitens ein Nervenapparat, der sich auf Extremsituationen einstellen kann, also eine Abstumpfung bewirkt. Es wurden nicht die Einwirkungen des Krieges verantwortlich gemacht, sondern in erster Linie die Konstitution des Menschen. Ein normaler Mensch könne folglich mit dem Krieg umgehen, ohne psychisch zu erkranken. Die Wissenschaftler gingen sogar noch weiter, indem sie davon sprachen, dass die Kriegsbejahung in jedem gesunden Menschen vorhanden sei und einen natürlichen Mechanismus darstelle, der bei kranken Menschen nicht funktioniere.[25] Dies bedeutet, dass man jedem, der den Krieg nicht befürwortete, eine krankhafte Störung anhängen konnte. „Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit“ sind nach Gaupp Symptome für eine psychopathische Konstitution.[26]
Auch rassistische Ideologien wurden in die Argumentation eingeflochten. So wurde beispielsweise gesagt, dass Polen und Juden eher erkrankten als Deutsche. Soldaten würden ferner eher erkranken, als Offiziere. Dies erscheint nicht verwunderlich, denn die Offizieren waren in der Regel nicht direkt am Kriegsgeschehen beteiligt und ihre Nerven dementsprechend weniger strapaziert.
Eine ähnliche sozialdarwinistische Auffassung vertrat der Psychoanalytiker Karl Abraham, der Kriegsneurotiker für labile, im praktischen Leben gescheiterte Menschen mit verringerter sexueller Aktivität und homosexueller Veranlagung hielt. Auch diese Argumentation ist absolut unhaltbar, denn die sexuelle Aktivität eines Menschen kann kaum wissenschaftlich überprüft oder gar mit der von anderen verglichen werden.
Die wenigen Stimmen, die sich seitens der Wissenschaftler gegen den Krieg erhoben, argumentierten erstaunlicherweise auf gleicher biologistischer Grundlage. Es wurde am Krieg kritisiert, dass es nicht zu einer natürlichen Auslese der Schwächeren komme, sondern gerade diejenigen von schwächerer Konstitution „konserviert“ würden, wohingegen die Fähigsten stürben. Dieses Denkmuster hatte bereits in der eugenischen Bewegung vor 1914 bestanden, doch nun wurde es auch wissenschaftlich untersucht. Das Ergebnis dieser „Untersuchungen“ war, dass Kriegsneurosen nicht durch den Krieg, sondern durch das vermeintlich schlechtere Menschenmaterial entstünden.[27]
Im ersten Teil ihrer Darstellung macht Kaufmann deutlich, dass die Militärpsychiatrie im ersten Weltkrieg entscheidend durch sozialdarwinistische und rassenhygienische Vorstellungen beeinflusst war. Die Übertragung gesellschaftlicher Phänomene auf den naturwissenschaftlichen Sektor entsprach dabei dem Zeitgeist und den Ärzten wurde ein großer Handlungsspielraum gelassen. Die Autorin vertritt die Kernthese, dass das Handeln der Psychiater dem damaligen Stand der Forschung entsprach und nicht wesentlich von der Regierung abhing.
[...]
[1] Vgl. Leidinger: Der Erste Weltkrieg, S. 33.
[2] Vgl. Schmiedebach: Sozialdarwinismus, Biologismus, pazifismus – Ärztestimmen zum Ersten Weltkrieg. In: Bleker: Medizin, S. 99.
[3] Vgl. ebd. S. 98.
[4] Kaufmann: „Widerstandsfähige Gehirne“, S. 206.
[5] Ein Delirium bezeichnet eine starke Bewusstseinsstörung mit Sinnestäuschungen.
[6] Genannt werden Bernd Ulrich und Benjamin Ziemann.
[7] Kaufmann: „Widerstandfähige Gehirne“, S. 208.
[8] Vgl. ebd. S. 209.
[9] Robert Gaupp: Hysterie und Kriegsdienst. In: Kaufmann: „Widerstandsfähige Gehirne“, S. 210.
[10] Ebd.
[11] Kaufmann,: „Widerstandfähige Gehirne“, S. 211.
[12] Die Hysterie (griechisch Hysteria = Gebärmutter) galt als Frauenerkrankung. Während des Ersten Weltkriegs nutzte die Psychiatrie diese Diagnose bei Männern, um sie zu diffamieren.
[13] Vgl. Fischer-Homberger: Der Erste Weltkrieg und die Krise der ärztliche Ethik. In: Bleker: Medizin, S.122.
[14] Ulrich und Ziemann: Das soldatische Kriegserlebnis. In: Münch: Verdun, S. 355.
[15] Vgl. Fischer-Homberger: Der Erste Weltkrieg und die Krise der ärztliche Ethik. In: Bleker: Medizin, S. 127.
[16] Vgl. Ebd. S. 122.
[17] Kaufmann: „Widerstandsfähige Gehirne“, S. 211.
[18] Ebd. S. 212.
[19] Ebd. S. 212.
[20] Schmiedebach: Sozialdarwinismus, Biologismus, Pazifismus – Ärztestimmen zum Ersten Weltkrieg. In: Bleker: Medizin, S.95.
[21] Kaufmann: „Widerstandsfähige Gehirne“, S. 213.
[22] Ebd.
[23] Ebd. S. 214
[24] Bonhoeffer: Die Widerstandsfähigkeit des Gehirns. In: ders: Nervenärztliche Erfahrungen und Eindrücke, S. 36-46.
[25] Vgl. Kaufmann „Widerstandsfähige Gehirne“, S. 218.
[26] Gaupp: Referat auf der 8. Jahresversammlung (Anm. 30), In: Kaufmann „Widerstandsfähige Gehirne“, S. 218.
[27] Kaufmann: „Widerstandsfähige Gehirne“, S. 220.
- Quote paper
- Riccardo Terrasi (Author), 2011, Ärzte und Patienten im Krieg. Aspekte der (Militär-)Psychiatrie im Ersten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/179693