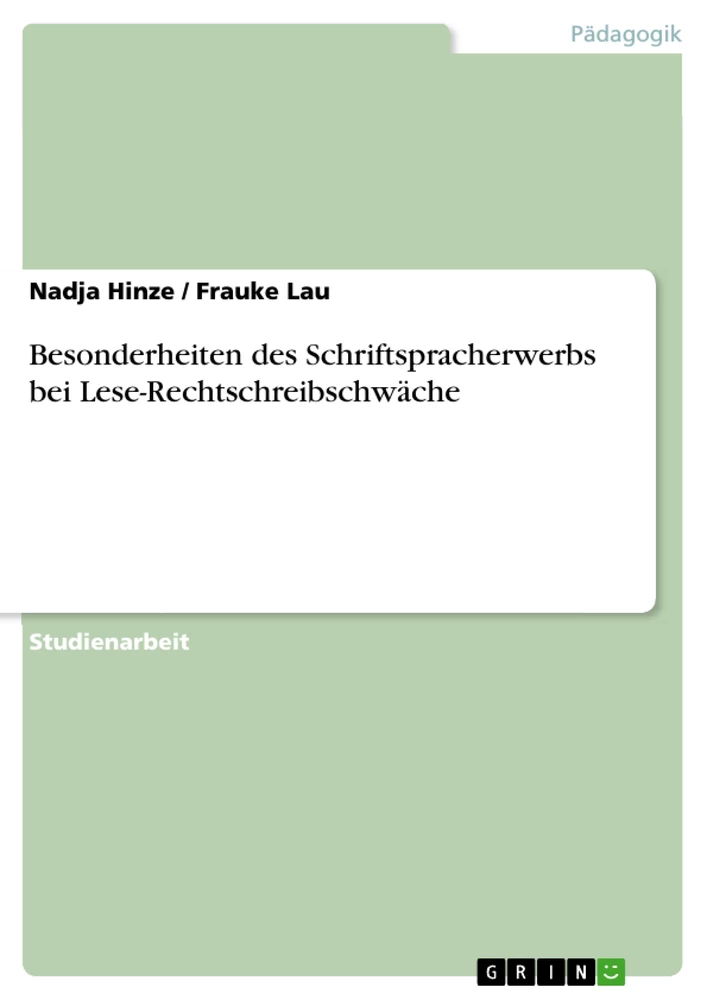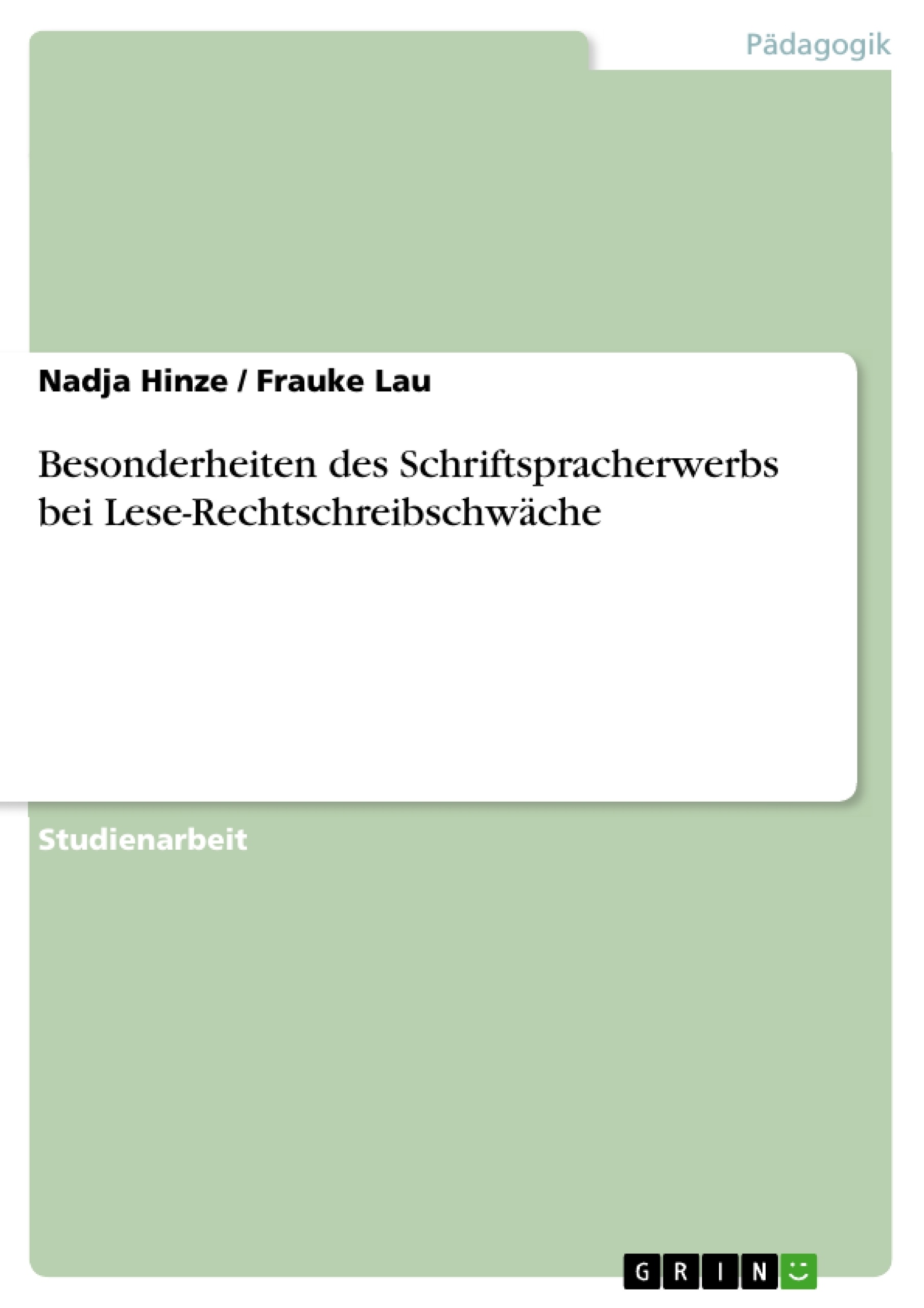Der Nachholbedarf hinsichtlich der Unterstützung von Menschen mit Problemen beim Schriftspracherwerb ist an Schulen in Deutschland immer noch hoch. Die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder an unseren Schulen nehmen stetig ab. Das Lesen und Schreiben zu lehren, gehört zu den Hauptaufgaben der Grundschule. Dieses Können ist in unserer Gesellschaft Grundlage schulischen Lernens.
Um im späteren Berufsleben mithalten zu können, sind die Kinder immer wiederkehrend weniger qualifiziert. Viele Unternehmen klagen über vor Fehlern strotzenden Bewerbungen und Auszubildende, die keinen vollständigen Satz fehlerfrei zu Papier bringen können. Begründet ist dies auch in unserm derzeitigen Schulsystem. Es bedarf einer umfassenden Reform, um die künftigen Chancen der Kinder zu verbessern, die Stresssituationen in der Schule zu entlasten und Kinder lebenstauglicher zu machen.
In dieser Arbeit wurde versucht den Begriff LRS näher zu beleuchten. Zunächst wird auf die Uneinheitlichkeit bezüglich des Begriffverständnisses und der vielfältigen Definitionen eingegangen. Differenziert wird die Lese-Rechtschreib-Schwäche als Teilleistungsschwäche definiert und die betroffenen Bereiche analysiert. Weiterhin wird darauf eingegangen wie LRS festgestellt wird. Im Anschluss daran wird der Prozess des Rechtschreiblernens beleuchtet und aufgezeigt, mit welchen Methoden an sächsischen Grundschulen lese-rechtschreib-schwache Schüler der Lese- und Schreiblernprozess erleichtert wird.
Die unterschiedlichen Auffassungen führen zu verschiedenen Konzepten der Förderung betroffener Kinder. Als ein Beispiel schulischer Förderung werden die LRS-Klassen näher erläutert und im außerschulischen Bereich das L.O.S..
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung…
- 1. Zum Begriff LRS…
- 2. LRS als Teilleistungsschwäche.
- 2.1 „Jedes Kind hat seine eigene LRS“..
- 2.2 Vorschullalter…
- 2.3 In den ersten Grundschulklassen…
- 2.3.1 Optisch-graphomotorischer Bereich…
- 2.3.2 Akustisch-phonematischer Bereich…
- 2.3.3 Kinästhetischer Bereich…
- 2.3.4 Rhythmischer Bereich…
- 2.3.5 Melodischer Bereich…
- 3. Feststellung der Lese-Rechtschreibschwäche…
- 4. Der Prozess des Rechtschreibenlernens…
- 4.1 Die erste Phase - Schreiben ist „Logos“ kennen…
- 4.2 Die zweite Phase- Schreiben ist Zuordnen von Laut und Zeichen…
- 4.3 Die dritte Phase - Schreiben ist Kennen von Bausteinen und Regeln…
- 4.4 Die Wechselbeziehung der Rechtschreibstrategien…
- 4.5 Worauf Eltern und Lehrer achten können hinsichtlich der Stufen der Rechtschreibentwicklung…
- 5. Methoden des Schreib- und Leselernprozesses bei lese-rechtschreib-schwachen Schülern…
- 5.1 LRS-Klassen an sächsischen Grundschulen…
- 5.1.1 Aufnahme in LRS-Klassen…
- 5.1.2 Arbeitsgrundsätze in den LRS-Klassen…
- 5.1.3 Didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts in Klasse 3/I…
- 5.1.4 Besonderheiten der Förderung in Klasse 3/II…
- 5.1.5 Förderprogramme und Fördergutachten…
- 5.1.6 Der Übergang in Klasse 4…
- 5.1.7 Leistungsermittlung und Leistungsbeurteilung…
- 5.2 Das Konzept des Lehrinstitutes für Orthographie und Schreibtechnik (L.O.S.) als Therapie bei Lese-Rechtschreibschwachen Kindern…
- 5.2.1 Überblick…
- 5.2.2 Die Diagnostik…
- 5.2.3 Die Therapie…
- 5.2.4 Dauer…
- 6 Zusammenfassung…
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Besonderheiten des Schriftspracherwerbs bei Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Ziel ist es, die LRS als Teilleistungsschwäche zu beleuchten, ihre Feststellung zu erläutern und den Prozess des Rechtschreibenlernens bei betroffenen Kindern zu analysieren. Darüber hinaus werden Methoden der Förderung in LRS-Klassen und alternative Therapiekonzepte vorgestellt.
- Definition und Merkmale der Lese-Rechtschreibschwäche
- Feststellung und Diagnostik von LRS
- Prozess des Rechtschreibenlernens bei LRS
- Methoden der Förderung in LRS-Klassen
- Alternative Therapiekonzepte für LRS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die Relevanz der LRS-Thematik dar. Kapitel 1 definiert den Begriff der Lese-Rechtschreibschwäche und beschreibt die verschiedenen Facetten dieser Teilleistungsschwäche. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung von LRS im Vorschulalter und in den ersten Grundschulklassen. Es analysiert verschiedene Bereiche, die eine Rolle bei der Entwicklung von LRS spielen, wie den optisch-graphomotorischen, akustisch-phonematischen, kinästhetischen, rhythmischen und melodischen Bereich. Kapitel 3 erläutert die verschiedenen Verfahren zur Feststellung von LRS.
Kapitel 4 widmet sich dem Prozess des Rechtschreibenlernens. Es beschreibt die verschiedenen Phasen, die ein Kind beim Erlernen des Schreibens durchläuft, und analysiert die Interaktion der verschiedenen Rechtschreibstrategien. Kapitel 5 stellt verschiedene Methoden zur Förderung von lese-rechtschreibschwachen Schülern vor, darunter die LRS-Klassen an sächsischen Grundschulen, die Besonderheiten der Förderung in Klasse 3/II und alternative Therapiekonzepte.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwäche, Teilleistungsschwäche, Schriftspracherwerb, Rechtschreibenlernen, Fördermethoden, LRS-Klassen, Therapiekonzepte, Diagnostik, Entwicklungspsychologie, Pädagogik.
- Arbeit zitieren
- Nadja Hinze (Autor:in), Frauke Lau (Autor:in), 2003, Besonderheiten des Schriftspracherwerbs bei Lese-Rechtschreibschwäche, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17474