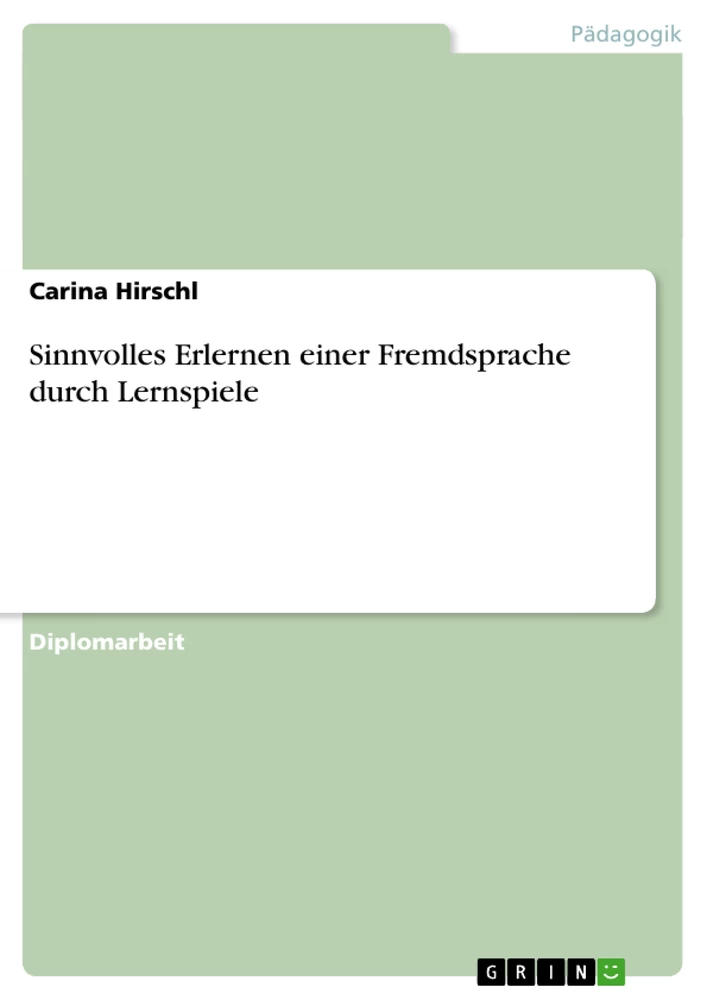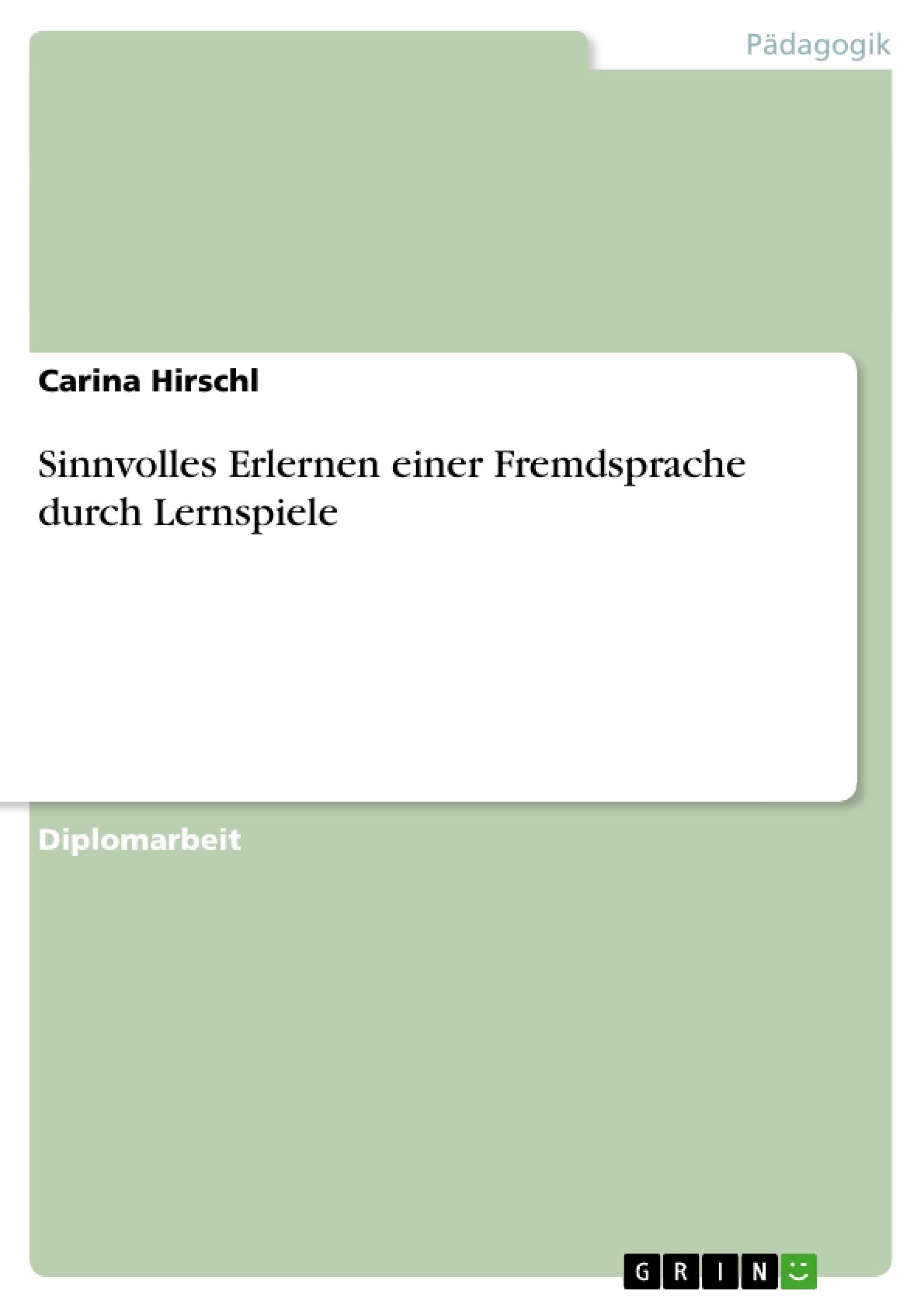Schule ? Schule !
Ein offenes Haus -voller Freude an Ideen
und voller Lachen. Offene Kinder -neugierig auf unsere Welt,
auf Geheimnisse. Offene Lehrer -auf der Suche nach sich selbst,
von Kindern lernend. (Ernst A. Ecker)
Dreimal ist in dem Gedicht das Wort „offen“ ausgesprochen: offenes Haus, offene Kinder und offene Lehrer. Ist Schule hier nicht zu sehr als Wunschvorstellung und Ideal ausgedrückt?
Die Schule von gestern ist nicht mehr die Schule von heute. Mit der gesellschaftlichen Entwicklung hat sich die Zielgruppe Schüler gewandelt. Kind heit hat sich aufgrund geänderter Rahmenbedingungen, geänderter Informationsvermittlung, geänderter Umgangsformen, aufgrund einer gesteigerten Mobilität und eines geänderten Freizeitverhaltens gleichzeitig geändert. Um Kindern heute gerecht zu werden ist e s wichtig, diese Veränderungen und Wandlungen als Grundlage für das Lernen im Blick zu halten. Schule und Lernen müssen sich verstärkt darum bemühen, vielfältige Möglichkeiten zu Eigentätigkeiten und zwischenmenschlichem Umgang zu schaffen. Offene Unterric htsformen bieten diese Chance.
Meine Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Im ersten Abschnitt versuche ich, den Begriff des Offenen Unterrichts, der schon seit langer Zeit in den Volksschulen etabliert ist, abzugrenzen. Im zweiten Abschnitt meiner Arbeit möchte ich besonders auf die Umsetzung dieser Lernform in der Sekundarstufe eingehen. Im darauffolgenden dritten Abschnitt möchte ich untersuchen, innerhalb welches didaktischen Rahmens Spiele oder spielerische
Aktivitäten in den Sprachunterricht eingegliedert werden können. Ich habe immer wieder das Argument gehört: „Spiele sind sehr zeitaufwendig und bringen außer ein bisschen Spaß nichts!“ Ich möchte hier den Gegenbeweis antreten und im vierten Abschnitt werde ich eine kleine Auswahl spielerischer Aktivitäten, versehen mit meinen eigenen Erfahrungsberichten, vorstellen. Ich werde mich auf zwölf Aktivitäten beschränken, wovon der Großteil relativ wenig Aufwand bereitet, einen ganzheitlichen Aspekt besitzt und ein großes Spektrum an möglichen Lernzielen abdeckt. In einem abschließenden fünften Kapitel möchte ich schließlich noch einige Erfahrungen und Kommentare von Lehrern bezüglich spielerischer Aktivitäten darlegen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Offener Unterricht
- 1. Die Begriffsproblematik
- 2. Offener Unterricht versus Frontalunterricht
- 3. Dimensionen von offenem Lernen
- 4. Merkmale des Offenen Unterrichts
- 5. Ziele des Offenen Unterrichts
- 6. Selbständiges Lernen und zielgerichtete Methodenvielfalt
- 7. Bedingungen für geöffneten Unterricht
- 7.1. Die Zeitstruktur
- 7.2. Die Raumstruktur
- 7.3. Materialien und Arbeitsmittel
- 8. Die Lehrerrolle im geöffneten Unterricht
- II. Offener Unterricht in der Sekundarstufe
- 1. Elemente des Offenen Lernens aus der Volksschule, die in die Sekundarstufe übernommen werden können
- 1.1. Der Klassenrat
- 1.2. Das Stationenlernen
- 1.2.1. Vorzüge der Stationenarbeit
- 1.2.2. Grenzen des Stationenlernens
- 1.3. Der Wochenarbeitsplan
- 1.3.1. Aufbau
- 1.3.2. Regeln für die Wochenplanarbeit
- 1.3.3. Vorzüge der Wochenplanarbeit
- 1.3.4. Gefahren und Probleme, die bei der Wochenplanarbeit entstehen können
- 1.4. Freiarbeit
- 1.5. Projektunterricht
- 1.5.1. Merkmale von Projektunterricht
- 1.5.2. Phasen von Projektunterricht
- 2. Probleme in der Sekundarstufe
- 2.1. Zeit
- 2.2. Raum
- 2.3. Das Fachlehrsystem
- 3. Die Beurteilung im Offenen Unterricht
- 3.1. Bewertung bei Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationenarbeit
- 3.2. Bewertung im projektorientierten Unterricht
- III. Das Spiel im Offenen Unterricht
- 1. Spielen und Lernen – ein Gegensatzpaar?
- 2. Das Spiel in der Pädagogik
- 3. Gemeinsame Merkmale des Spiels und offenem Unterricht
- 4. Ganzheitliches sensomotorisches Lehren und Lernen
- 4.1. Sensoren und ihre Stimulierung
- 4.1.1. Das Auge - visuelle Stimuli
- 4.1.2. Das Ohr - auditive Stimuli
- 4.1.3. Mundraum - Geschmacksstimulus
- 4.1.4. Haut und Hand – taktile und haptische Stimuli
- 4.1.5. Körperbewegung – kinästhetische und proprio zeptorische Stimuli
- 4.1.6. Emotionaler Stimulus
- 5. Die Rolle des Spielleiters / Lehrers
- 6. Lernspiele
- 6.1. Problematik von Lernspielen
- 6.2. Lernspiele im Fremdsprachenunterricht
- 6.2.1. Sprachlernziele mit Sprachlernspielen
- 6.2.2. Das Rollenspiel im Fremdsprachenunterricht
- 6.2.3. Das Spiel mit der Sprache
- 6.3. Die Fehlerkorrektur bei spielerischen Aktivitäten
- IV: Lernspiele für den Fremdsprachenunterricht
- 1. Einleitender Kommentar
- 2. Einige Lernspiele
- 2.1. I. Gruppe
- 2.1.1. Durch den Raum führen
- 2.1.2. Übung mit dem Geschmackssinn
- 2.1.3. Absurder Dialog
- 2.1.4. Sehenswürdigkeiten
- 2.1.5. Activity
- 2.2. II. Gruppe
- 2.2.1. Pronomenwürfel und Verbkärtchen
- 2.2.2. Tabu
- 2.2.3. Porträt-Geschichte
- 2.2.4. Trivial Pursuit
- 2.3. III. Gruppe
- 2.3.1. Zahlenschnipsen
- 2.3.2. Leitern & Schlangen
- 2.3.3. Textbingo
- 2.3.4. Laufdiktat
- V: Lehrerinterviews
- VI: Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der didaktischen Nutzung von Lernspielen im Fremdsprachenunterricht, insbesondere in der Sekundarstufe. Ziel ist es, die sinnvolle Einbindung von Spielen in den offenen Unterricht zu untersuchen und aufzuzeigen, wie Lernspiele einen Beitrag zum ganzheitlichen Sprachlernen leisten können.
- Begriffsbestimmung und Merkmale des offenen Unterrichts
- Die Rolle von Lernspielen im offenen Unterricht
- Ganzheitliches sensomotorisches Lehren und Lernen durch Spiele
- Einsatz von Lernspielen im Fremdsprachenunterricht
- Bewertung von Lernspielen im Kontext des offenen Unterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel, die sich mit den verschiedenen Aspekten des offenen Unterrichts und der Integration von Lernspielen befassen. Im ersten Kapitel wird der Begriff des offenen Unterrichts definiert und in Bezug zu anderen Unterrichtsformen gesetzt. Es werden die verschiedenen Dimensionen von offenem Lernen sowie die Merkmale und Ziele des offenen Unterrichts dargestellt. Das zweite Kapitel widmet sich der Umsetzung des offenen Unterrichts in der Sekundarstufe und analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich aus der spezifischen Situation der Sekundarstufe ergeben. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Elemente des offenen Lernens aus der Volksschule vorgestellt, die in die Sekundarstufe übernommen werden können, wie beispielsweise der Klassenrat, das Stationenlernen, der Wochenarbeitsplan, die Freiarbeit und der Projektunterricht. Im dritten Kapitel wird das Spiel als pädagogisches Instrument untersucht und die Gemeinsamkeiten zwischen dem Spiel und dem offenen Unterricht aufgezeigt. Es werden die Vorteile von ganzheitlichem sensomotorischem Lehren und Lernen durch Spiele diskutiert und die verschiedenen Sinne und ihre Stimulierung im Kontext von Lernspielen beleuchtet. Im vierten Kapitel werden konkrete Lernspiele für den Fremdsprachenunterricht vorgestellt und in Bezug auf die Sprachlernziele und die Entwicklung der Sprachkompetenz analysiert. Dabei werden sowohl klassische Sprachlernziele wie beispielsweise Wortschatz, Grammatik und Aussprache, als auch die Entwicklung von kommunikativer Kompetenz und interkultureller Sensibilität berücksichtigt. Das fünfte Kapitel enthält Lehrerinterviews, die Einblicke in die Erfahrungen von Lehrern mit dem Einsatz von Lernspielen im Fremdsprachenunterricht bieten.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Lernspiele, Fremdsprachenunterricht, Sekundarstufe, ganzheitliches Lernen, sensomotorische Stimuli, Sprachlernziele, kommunikative Kompetenz, interkulturelle Kompetenz.
- Arbeit zitieren
- Carina Hirschl (Autor:in), 2003, Sinnvolles Erlernen einer Fremdsprache durch Lernspiele, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17460