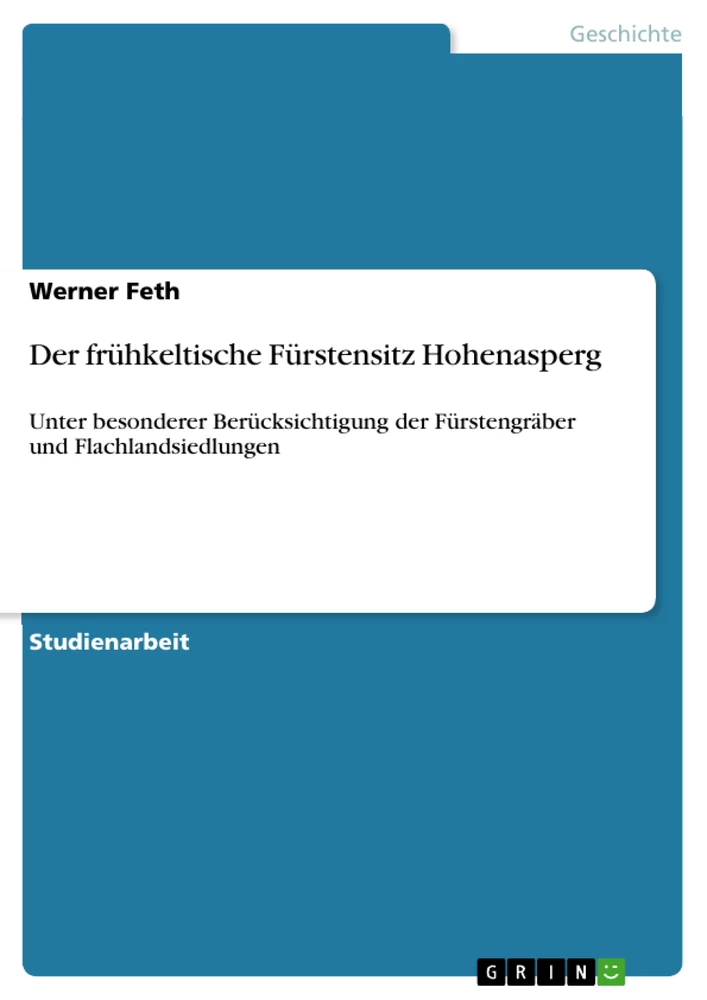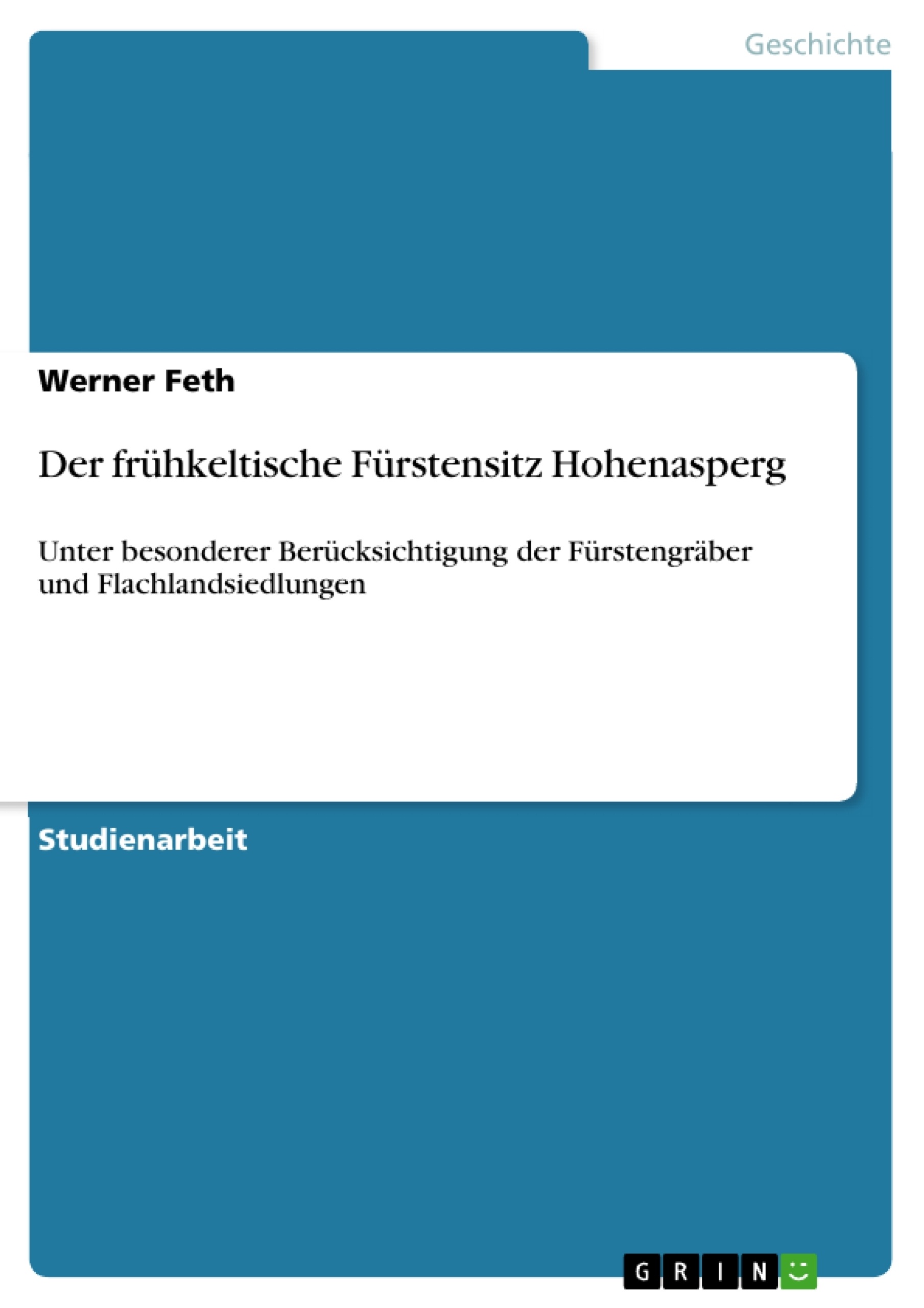Inhalt dieser Arbeit ist es, einen Überblick über den Fürstensitz Hohenasperg zu geben. Dabei soll zum einen der heutige Kenntnisstand bezüglich der Siedlung selbst und den umgebenden reich ausgestatteten Grabhügel dargestellt, und zum anderen ein genauer Blick auf die bekannten ländlichen Siedlungsstellen, welche sich innerhalb des Machtbereichs des Hohenasperg befanden, geworfen werden. Anhand der durchaus imposanten Fürstengräber, die in der Reihe ihres forschungsgeschichtlichen Bekanntwerdens vorgestellt werden, wird sich aufzeigen lassen, wie sich die späthallstatt-/frühlatènezeitliche Elite im Grabkult darstellte. Es wird der Frage nachgegangen werden, ob sich möglicherweise innerhalb dieser Bestattungskultur eine soziale Hierarchie erkennen lässt. Die Betrachtung der Siedlungen erfolgt diachron, entlang ihrer Entwicklung im Laufe der Phasen Ha C und D1, bis in die Frühlatènezeit hinein. Ziel dieser Untersuchung ist es einerseits die siedlungsarchäologischen Prozesse darzustellen, die zur Herausbildung des Siedlungsgefüges in der Landschaft des Hohenasperg im Laufe der Späthallstattzeit führten, andererseits die Bedeutung des Fürstensitzes für sein Umland, auch im Hinblick auf eine mögliche Funktion als Zentralort oder komplexes Zentrum, zu klären.
Ein abschließender Vergleich mit anderen Fürstensitzen, wie z. B. dem Mont Lassois in Burgund soll Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich die einstige Besiedlung auf dem Plateau des Hohenasperg vorstellen könnte, aber auch welche die Unterschiede sind, die diesen Fürstensitz so besonders machen und welche Chancen sich daraus für die Untersuchung auch in Bezug auf andere Regionen ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Hohenasperg
- Topographie
- Geschichte und frühe Funde
- Funde vom Hohenasperg
- Datierung
- Die Prunkgräber im Umfeld des Hohenasperg
- Der Römerhügel, Kr. Ludwigsburg
- Das Kleinaspergle, Kr. Ludwigsburg
- Die Gruppe von Bad Cannstatt „Steinhaldenfeld“, Stadt Stuttgart
- Das Grab von Ditzingen-Schöckingen, Kr. Ludwigsburg
- Das Grab von Hirschlanden, Kr. Leonberg
- Der Grafenbühl bei Asperg, Kr. Ludwigsburg
- Der Grabhügel von Eberdingen-Hochdorf, Kr. Ludwigsburg
- Ergebnisse
- Die Siedlungsstellen um den Hohenasperg
- Forschungsgeschichte
- Siedlungen Ha C/D1
- Stuttgart-Mühlhausen, „Viesenhäuser Hof“
- Remseck-Aldingen
- Siedlungen Ha D2-3
- Stuttgart-Stammheim
- Fellbach-Schmiden
- Kornwestheim
- Walheim
- Siedlungen FLT
- Eberdingen-Hochdorf
- Ergebnis
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Der Fürstensitz Hohenasperg
- Der Hohenasperg als „komplexes Zentrum“
- Vergleich zu anderen Fürstensitzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über den frühkeltischen Fürstensitz Hohenasperg in Nordwürttemberg zu geben. Sie untersucht den aktuellen Forschungsstand zur Siedlung, den umliegenden reich ausgestatteten Gräbern und den ländlichen Siedlungen innerhalb des Machtbereichs. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der spät-hallstattzeitlichen/ früh-latènezeitlichen Elite anhand ihrer Bestattungskultur und der Frage nach möglichen sozialen Hierarchien.
- Der Hohenasperg als frühkeltischer Fürstensitz
- Analyse der Prunkgräber im Umfeld des Hohenaspergs
- Untersuchung der ländlichen Siedlungen im Machtbereich des Hohenaspergs
- Diachrone Betrachtung der Siedlungsentwicklung
- Vergleich des Hohenaspergs mit anderen Fürstensitzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht den frühkeltischen Fürstensitz Hohenasperg im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 1171. Sie schließt eine Forschungslücke bezüglich der Fürstensitze selbst und der zugehörigen ländlichen Siedlungen, indem sie den aktuellen Wissensstand zu Siedlung und Gräbern präsentiert und die ländlichen Siedlungen innerhalb des Machtbereichs des Hohenaspergs analysiert. Die Arbeit fragt nach der Bedeutung des Fürstensitzes für sein Umland und seiner möglichen Funktion als Zentral- oder komplexes Zentrum, sowie nach sozialen Hierarchien innerhalb der Bestattungskultur. Ein Vergleich mit anderen Fürstensitzen soll zusätzliche Erkenntnisse liefern.
2. Der Hohenasperg: Dieses Kapitel beschreibt die Topographie des Hohenaspergs, seine geographische Lage in Nordwürttemberg, seine hydrographischen und klimatischen Bedingungen sowie die landwirtschaftlichen Gegebenheiten der umliegenden Region. Es wird die herausragende topographische Lage und der Reichtum an Grabfunden in der Umgebung des Hohenaspergs hervorgehoben. Die heutigen Überbauungen des Plateaus durch eine Festung und ein Justizvollzugskrankenhaus und die damit verbundenen Schwierigkeiten für archäologische Untersuchungen werden thematisiert. Trotz der Überbauung werden Funde aus Aushüben genannt, die auf eine eisenzeitliche Besiedlung hindeuten.
Schlüsselwörter
Frühkeltisch, Fürstensitz, Hohenasperg, Prunkgräber, Siedlungen, Hallstattzeit, Latènezeit, Zentralisierung, Urbanisierung, soziale Hierarchie, Grabkult, Siedlungsarchäologie, Neckarraum, Nordwürttemberg.
Häufig gestellte Fragen zum frühkeltischen Fürstensitz Hohenasperg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den frühkeltischen Fürstensitz Hohenasperg in Nordwürttemberg. Sie untersucht den aktuellen Forschungsstand zur Siedlung auf dem Hohenasperg, den umliegenden reich ausgestatteten Gräbern und den ländlichen Siedlungen innerhalb des Machtbereichs. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der spät-hallstattzeitlichen/ früh-latènezeitlichen Elite, ihrer Bestattungskultur und möglichen sozialen Hierarchien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Hohenasperg als frühkeltischen Fürstensitz; die Analyse der Prunkgräber im Umfeld; die Untersuchung der ländlichen Siedlungen im Machtbereich; eine diachrone Betrachtung der Siedlungsentwicklung; und einen Vergleich des Hohenaspergs mit anderen Fürstensitzen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem aktuellen Forschungsstand und bezieht Funde und Erkenntnisse aus archäologischen Ausgrabungen und Untersuchungen im Umfeld des Hohenaspergs mit ein. Sie berücksichtigt die Schwierigkeiten archäologischer Untersuchungen aufgrund der heutigen Bebauung des Plateaus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Beschreibung des Hohenaspergs (Topographie, Geschichte, Funde, Datierung), Analyse der Prunkgräber im Umfeld, Untersuchung der Siedlungsstellen um den Hohenasperg, und eine Zusammenfassung der Ergebnisse inklusive eines Vergleichs mit anderen Fürstensitzen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine umfassende Darstellung des Hohenaspergs als frühkeltisches Zentrum, analysiert die Bestattungskultur der Elite, untersucht die ländlichen Siedlungen im Machtbereich und vergleicht den Hohenasperg mit anderen ähnlichen Stätten. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der sozialen Strukturen und der Rolle des Hohenaspergs innerhalb seines Umlandes bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Frühkeltisch, Fürstensitz, Hohenasperg, Prunkgräber, Siedlungen, Hallstattzeit, Latènezeit, Zentralisierung, Urbanisierung, soziale Hierarchie, Grabkult, Siedlungsarchäologie, Neckarraum, Nordwürttemberg.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt eine Forschungslücke bezüglich der Fürstensitze selbst und der zugehörigen ländlichen Siedlungen, indem sie den aktuellen Wissensstand zu Siedlung und Gräbern präsentiert und die ländlichen Siedlungen innerhalb des Machtbereichs des Hohenaspergs analysiert. Sie untersucht die Bedeutung des Fürstensitzes für sein Umland und seine mögliche Funktion als Zentral- oder komplexes Zentrum.
Wo liegt der Hohenasperg geografisch?
Der Hohenasperg befindet sich in Nordwürttemberg und seine geografische Lage, hydrographischen und klimatischen Bedingungen sowie die landwirtschaftlichen Gegebenheiten der umliegenden Region werden in der Arbeit beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Werner Feth (Autor:in), 2010, Der frühkeltische Fürstensitz Hohenasperg, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/168072