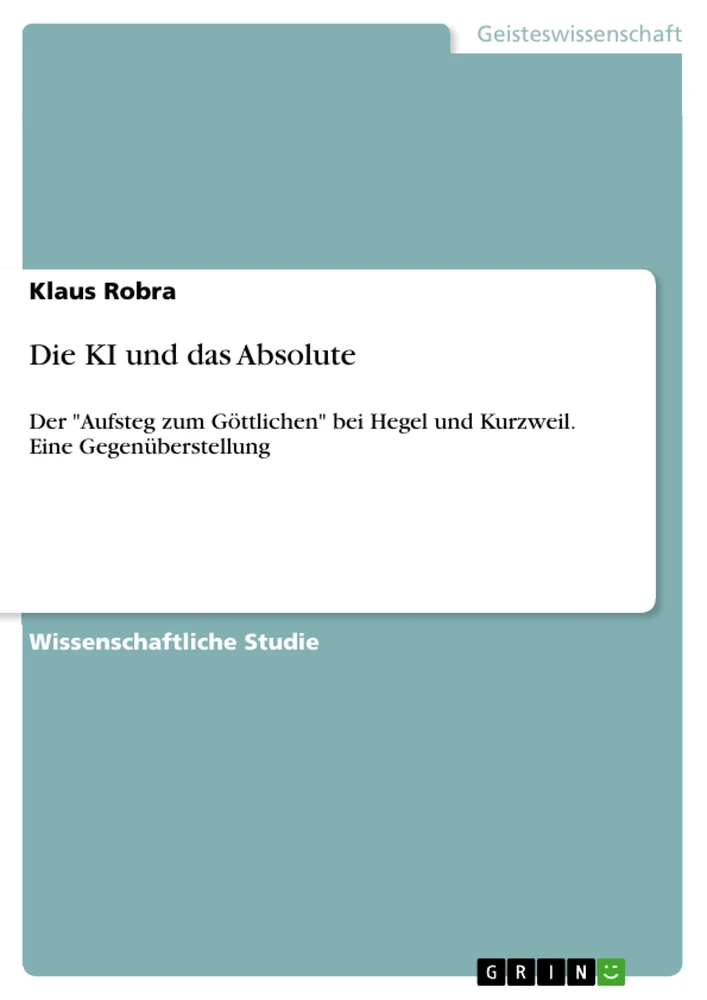Die Künstliche Intelligenz soll sich als Segen, nicht als Fluch der Menschheit erweisen. Dies ist wohl nicht zu bezweifeln. Die Frage stellt sich aber, wie die KI trotz fehlender globaler Regulierung unter Kontrolle gehalten werden kann. Hierzu ist es erforderlich, über das Wesen und die möglichen Folgen der KI möglichst genauen Aufschluss zu gewinnen. Über ihre Chancen und Risiken ist schon viel geschrieben worden, nicht aber über auffällige Parallelen zwischen Hegels Philosophie des Absoluten und den mit der KI verbundenen Absolutheits-ansprüchen, obwohl eine Erklärung dieser Parallelen möglicherweise entscheidend zum Ver-ständnis dieser Ansprüche beitragen kann. Zwar erklärte Roberto Simanowski (2020), die KI sei „der absolute Geist auf höchster Prozessstufe“, unterließ es aber, diese These ausführlich zu begründen, z.B. durch eine Analyse der genannten Parallelen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Hegels Aufstieg zum Absoluten
Das Hier und Jetzt, das Dieses und das Meinen
Die Wahrnehmung
Der Verstand
Das Selbstbewusstsein
Die Vernunft
Der Geist
Kritische Anmerkungen
Zu den Stufen der ‚Phänomenologie‘
II. KI und die Visionen von Ray Kurzweil u.a
Update Kurzweil 2024: „Die nächste Stufe der Evolution“
Kritische Anmerkungen
Zusammenfassung. Tabellarische Gegenüberstellung der Konzepte von Hegel und Kurzweil
Literaturhinweise
Einleitung
Die Künstliche Intelligenz soll sich als Segen, nicht als Fluch der Menschheit erweisen. Dies ist wohl nicht zu bezweifeln. Die Frage stellt sich aber, wie die KI trotz fehlender globaler Regulierung unter Kontrolle gehalten werden kann. Hierzu ist es erforderlich, über das Wesen und die möglichen Folgen der KI möglichst genauen Aufschluss zu gewinnen. Über ihre Chancen und Risiken ist schon viel geschrieben worden, nicht aber über auffällige Parallelen zwischen Hegels Philosophie des Absoluten und den mit der KI verbundenen Absolutheits-ansprüchen, obwohl eine Erklärung dieser Parallelen möglicherweise entscheidend zum Ver-ständnis dieser Ansprüche beitragen kann. Zwar erklärte Roberto Simanowski (2020), die KI sei „der absolute Geist auf höchster Prozessstufe“1, unterließ es aber, diese These ausführlich zu begründen, z.B. durch eine Analyse der genannten Parallelen. Als Belege für letztere zitiere ich zunächst nur
a) Ray Kurzweil:
„Es geht um die Entstehung eines Volkes von auserwählten Gott-Menschen, die in den Cyber-Himmel aufsteigen, wo sie als allmächtige und unsterbliche Götter leben, Universen erschaffen, sich mühelos durch Raum und Zeit bewegen und weder natürlichen noch ewigen Gesetzen unterworfen sind. Karma, Wiedergeburt, Sünde und Ethik gelten für diese Wesen nicht mehr, sie haben sich abgekoppelt.“2
b) Aristoteles (den Hegel am Schluss seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissen-schaften III zitiert):
„Das Denken an sich aber geht auf das an sich Beste, das höchste Denken auf das Höchste“.3
c) Hegel:
„Das Sich-Urteilen der Idee in die beiden Erscheinungen … bestimmt dieselben als ihre (der sich wissenden Vernunft) Manifestationen, und es vereinigt sich in ihr, daß die Natur der Sache, der Begriff, es ist, die sich fortbewegt und entwickelt, und diese Bewegung ebensosehr die Tätigkeit des Erkennens ist, die ewige an und für sich seiende Idee sich ewig als absoluter Geist betätigt, erzeugt und genießt.“4 Und:
Schon diese wenigen Zitate lassen zunächst den Schluss zu, dass Vergleiche zwischen den Positionen Hegels und Kurzweils möglich sind. Als Vergleichsinstanzen (tertia compara-tionis) könnten evtl. aktuelle Forschungsergebnisse, z.B. der Neurologie, und neuere philo-sophische Reflexionen dienen. – Möglich und notwendig ist jedenfalls eine Gegen-überstellung der beiden Positionen.
I. Hegels Aufstieg zum Absoluten
Künstliche Intelligenz ist anscheinend keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Vielmehr trifft man sie überall dort an, wo bestehende (natürliche) Zusammenhänge z.B. wissenschaftsanaly-tisch, experimentell und/oder philosophisch-reflektierend oder auch -spekulativ durch alter-native Strukturen und Konzepte verändert oder ersetzt werden. So schon, wenn Platon zwischen Urbild und Abbild, Ideenhimmel und irdischer Realität unterscheidet. Erst recht, wenn Augustin den „himmlischen Gottesstaat“ dem „teuflischen Erdenstaat“ gegenüberstellt; oder wenn Descartes empfiehlt, analytisch vom Einfachsten zum Komplexeren fortzuschrei-ten. – Grenzen von Reflexion und Spekulation dürften dann erreicht oder überschritten sein, wenn religiöser Glaube und Wissen nicht mehr auseinander gehalten, sondern ineins gesetzt werden.5
Bei Hegel zeigt sich eine willkürliche Aufgliederung in der von ihm in die Phänomenologie des Geistes (von 1807) eingeführten Stufenfolge der Erscheinungen des Bewusstseins. Ernst Bloch hat insgesamt 14 solcher aufeinander folgenden Stufen herausgefunden6, die sich fast ausnahmslos bestimmten Bewusstseins-Formen und -Funktionen zuordnen lassen, angefangen beim „Hier und Jetzt“ über die Wahrnehmungen, die Vorstellungen, den Verstand, das (Selbst-)Bewusstsein , die Vernunft und den Geist bis hin zum Absoluten Geist und Absolu-ten Wissen. Wobei auch der Geist, d.h. die Gesamtheit der dialektischen Subjekt-Objekt-Be-ziehungen, zum Instrumentarium des Bewusstseins gezählt werden kann. Hegels Willkür be-steht u.a. in seiner Verwendung des Begriffs Aufhebung – mit dessen Bedeutungen a) etwas von unten nach oben, z.B. vom Boden aufheben, b) löschen, beseitigen, entfernen, c) (auf hö-herer Stufe) aufbewahren. Jede vorausgehende Bewusstseins-Form hält Hegel für inhaltlich ärmer als die nachfolgende. Das Hier und Jetzt geht in die Wahrnehmungen über, diese in die Vorstellungen, diese in den Verstand usw. Da Vorstellungen aus gedächtnismäßig gespeicher-ten Wahrnehmungen stammen, sind diese in jenen enthalten („aufgehoben“) – was sich fortsetzt bis hin zum Absoluten, in dem sich angeblich Anfang und Ende, A und O, Weg und Ziel des Ganzen vereinen.
Das Hier und Jetzt, das Dieses und das Meinen
Es sind Faktoren, die nicht zu leugnen sind, aber weder an sich noch für sich nachprüfbare Wahrheiten vermitteln können. Was ein Grund dafür sein mag, dass Hegel diese Faktoren in der Phänomenologie in deren Neufassung im Rahmen der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III von 1817 nicht mehr erwähnt. – „Gesundheitsexperten“ empfehlen, gänz-lich im Hier und Jetzt zu leben, um das Leben wirklich und richtig genießen zu können. Dagegen wenden Neurowissenschaftler ein, dass genau dies unmöglich sei, weil wir Menschen nicht nur stets mit den Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontiert sind, sondern auch darin unwillkürlich „mitschwimmen“ und uns sozusagen hin- und herbewegen müssen.
Letzteres hat schon Hegel erkannt, jedenfalls teilweise. Zum Jetzt schreibt er:
„Es wird das Jetzt gezeigt, dieses Jetzt; es hat schon aufgehört zu sein, indem es gezeigt wird; das Jetzt, das ist, ist ein anderes als das gezeigte, und wir sehen, daß das Jetzt eben dieses ist, indem es ist, schon nicht mehr zu sein. Das Jetzt, wie es uns ge-zeigt wird, ist es ein gewesenes, und dies ist seine Wahrheit; es hat nicht die Wahrheit des Seins. Es ist also doch dies wahr, daß es gewesen ist. Aber was gewesen ist, ist in der Tat kein Wesen; es ist nicht, und um das Sein war es zu tun.“7
Es gibt also das Jetzt, aber nur als ständig vergehendes, und es ist nur in diesem Ver- und Übergehen präsent. Was Ernst Bloch veranlasst haben mag, über „das Dunkel des gelebten Augenblicks“ zu philosophieren und festzustellen:
„In ihm ist ausgesprochen, daß wir an der Stelle, wo wir uns in jedem Augenblick befinden, nicht sehen. Erst wenn dieser Augenblick vergangen ist oder zuvor, wenn er noch erwartet wird, haben wir eine Ahnung von ihm. Aber sonst läuft durch die ganze Welt hindurch das Dunkel des Unmittelbaren, erscheinend im Jetzt seiner Zeitform und Hier seiner Raumform.“8 Und in größtmöglicher Kürze: „Präsens ist noch keine Präsenz.“ (ebd.)
Ähnlich äußert sich Hegel zum „Hier“ in der Phänomenologie:
„Das Hier ist z.B. der Baum. Ich wende mich um, so ist diese Wahrheit verschwunden und hat sich in die entgegengesetzte verkehrt. Das Hier ist nicht ein Baum, sondern vielmehr ein Haus. Das Hier selbst verschwindet nicht; sondern es ist bleibend im Verschwinden des Hauses, Baumes usf. und gleichgültig, Haus, Baum zu sein. Das Dieses zeigt sich also wieder als vermittelte Einfachheit oder als Allgemeinheit.“9
Das Hier im Raum ist also ähnlich unbeständig und volatil wie das Jetzt in der Zeit. Beide stehen in Bezug zum „Dieses“, das Hegel in dessen Allgemeinheit als „das Wahre der sinnli-chen Gewissheit“ auffasst und zugleich zu bedenken gibt, dass zwischen „diesem“ Ding oder „dieser“ Person zunächst immer das Meinen stehe, das wegen seiner völlig willkürlichen Subjektivität unausdrückbar sei. Stattdessen könne man der tatsächlichen „Wahrheit der sinn-lichen Gewissheit“ erst in der Wahrnehmung näher kommen: „ … ich nehme es so auf, wie es in Wahrheit ist, und statt ein Unmittelbares zu wissen, nehme ich wahr.“ (a.a.O. S. 92)
Die Wahrnehmung
Die Dinge, die ich wahrnehme, zeigen sich mit vielfältigen, zuweilen wechselnden Eigen-schaften und Merkmalen. Laut Hegel erfasst das Wahrnehmen den Zusammenhang der Dinge, d.h. deren bestimmte Umstände und Zustandsarten. Wobei jedoch Täuschung auftreten kann, z.B. durch unzureichendes sinnliches Erfassen eines Gegenstandes – was Hegel, so jedenfalls in der Phänomenologie von 1807, auf mehreren Seiten weitschweifig und häufig eher um-ständlich darstellt. Es komme jedenfalls darauf an, die vielfältigen Eigenschaften der Dinge und Personen korrekt und möglichst vollständig zu erfassen, insbesondere auch in demjeni-gen, wodurch sie sich von anderen unterscheiden. „Dieser Verlauf, ein beständig abwechseln-des Bestimmen des Wahren und Aufheben dieses Bestimmens, macht eigentlich das tägliche und beständige Leben und Treiben des Wahrnehmenden und in der Wahrheit sich zu bewegen meinenden Bewußtseins aus.“ (a.a.O. S. 106) – Ein letztlich unbefriedigender Zustand, aus dem nur heraushelfen könne:
Der Verstand
Hierauf verwendet Hegel 1807 immerhin ca. 30 Seiten, in der Enzyklopädie von 1817 jedoch nur weniger als 2 ½ Seiten, davon fast 2 Seiten in den sogenannten „Zusätzen“ (Anmerkun-gen) – dies aus welchen Gründen auch immer. Den Verstand charakterisiert Hegel im We-sentlichen als das schlussfolgernde Denken. Und er bemerkt:
„Indem sich aber das Bewußtsein von der Beobachtung der unmittelbaren Einzelheit und von der Vermischung des Einzelnen und des Allgemeinen zur Auffassung des In-nern des Gegenstandes erhebt, den Gegenstand also auf eine dem Ich gleiche Weise bestimmt, so wird dieses zum verständigen Bewußtsein.“10 Und:
„So aufgefaßt ist dasselbe dasjenige; was wir Gesetz nennen. Denn das Wesen des Gesetzes, möge dieses sich nun auf die äußere Natur oder auf die sittliche Weltord-nung beziehen, besteht in einer untrennbaren Einheit, in einem notwendigen inneren Zusammenhange unterschiedener Bestimmungen.“ (ebd.)
Dies aber könne sich nicht abstrakt, sondern müsse sich in Gemeinschaft und Auseinanderset-zung mit dem Leben selbst bewähren. Wobei das Leben als Selbstzweck aufzufassen sei, so dass sich der Übergang zum Ich des Selbstbewusstseins quasi von selbst ergebe.
Das Selbstbewusstsein „ … erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbst-bewußtsein “11, also in dem, was Hegel auch als „das anerkennende Bewusstsein“ bezeichnet. Voraussetzungen hierfür sind allerdings, 1. dass Hegel Bewusstsein und Selbstbewusstsein als wechselseitig bedingt und zugleich als auf dem Selbstbewusstsein beruhende Einheit auffasst, 2. dass er die Ich-Identität: Ich = Ich jeglichem Bewusstsein und somit jeglichem Erkennen zu Grunde legt. Dies jedoch mit eigenartigen Folgerungen, die nur im Rahmen von Hegels Begriffs -Philosophie verständlich werden.
In dem Ausdruck Ich = Ich erkennt Hegel nämlich bereits „das Prinzip der absoluten Vernunft und Freiheit “, somit Faktoren, die eigentlich nicht dem bloßen Selbstbewusstsein, sondern höheren Stufen der Phänomenologie – denen von Vernunft und Geist – zuzuordnen sind. In der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften schreibt Hegel:
„Die Wahrheit des Bewußtseins ist das Selbstbewußtsein und dieses der Grund von jenem, so daß in der Existenz alles Bewußtsein eines anderen Gegenstandes Selbst-bewußtsein ist; ich weiß von dem Gegenstande als dem meinigen (er ist meine Vor-stellung), ich weiß daher darin von mir. – Der Ausdruck vom Selbstbewußtsein ist Ich = Ich; …“ (§ 424)
Damit behauptet Hegel, der Gegenstand des Bewusstseins sei grundsätzlich mit der individu-ellen Vorstellung vom Gegenstand identisch; mentale Objekte würden also stets ausschließ-lich vom Subjekt selbst erzeugt. – Dies allerdings im Widerspruch zu der Tatsache, dass Hegel andernorts ausdrücklich die scholastische Korrespondenztheorie der Wahrheit (adaequatio rei ad intellectum) bejaht, indem er erklärt, schon Kant habe richtig bemerkt, dass die Wahrheit in der „Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande“ bestehe, „eine Definition, die von großem, ja von dem höchsten Werte“12 sei.
Im Übrigen erläutert Hegel zum Selbstbewusstsein:
1. Über das „anerkennende Selbstbewußtsein“:
„Es ist ein Selbstbewußtsein für ein Selbstbewußtsein zunächst unmittelbar als ein Anderes für ein Anderes. Ich schaue in ihm als Ich mich selbst an, aber auch darin ein unmittelbar daseiendes, als Ich absolut gegen mich selbständiges anderes Objekt. … Dieser Widerspruch gibt den Trieb, sich als freies Selbst zu zeigen und für den Anderen als solches da zu sein, – den Prozeß des Anerkennens.“ (§ 430)
2. Über Bewusstsein und Selbstbewusstsein als Übergangsstufen zur Vernunft:
„Diese Einheit des Bewußtseins und des Selbstbewußtseins enthält zunächst die Einzelnen als ineinander scheinende. Aber ihr Unterschied ist in dieser Identität die ganz unbestimmte Verschiedenheit oder vielmehr ein Unterschied, der keiner ist. Ihre Wahrheit ist daher die an und für sich seiende Allgemeinheit und Objektivität des Selbstbewußtseins, – die Vernunft.“ (§ 437)
Die Kehrseite: das unglückliche Bewusstsein
In scharfem Kontrast zu seiner Bestimmung des Bewusstseins präsentiert Hegel die Kehrseite der Medaille: „ das unglückliche Bewusstsein “. Dieses denkt und handelt, wie Hegel erklärt, „nicht mit Blick auf das mannigfaltige Leben, sondern unter Berücksichtigung des Leblosen, Statischen, eines erwarteten Jenseits und Grabes der eigenen Bemühungen“:
„Dem Bewußtsein kann daher nur das Grab seines Lebens zur Gegenwart kommen. Aber weil dies selbst eine Wirklichkeit und es gegen die Natur dieser ist, einen dauernden Besitz zu gewähren, so ist auch diese Gegenwart des Grabes nur der Kampf eines Bemühens, der verloren werden muß.“ (Hegel ebd.)
Das unglückliche Bewusstsein „bleibt in einer Sisyphusarbeit gefangen. Es vergisst die Fallen, in die es bereits getappt ist, und fällt immer wieder erneut auf sie herein. Es vergisst die Versuche, die unerfolgreich geblieben sind, und vermag deshalb nicht aus dem Teufelskreis auszubrechen.“ (Carmele 2022, S. 6)
Allerdings: „Das unglückliche Bewusstsein bleibt nur solange unglücklich, wie es sich und seine eigenen Handlungen und Entscheidungen vergisst. Von Schicksal und Notwendigkeit keine Spur und wenn, dann nur im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung aufgrund einer sich selbst auferlegten Unaufrichtigkeit oder eines mnemonischen Unvermögens. Die letzt-liche Auflösung des Konfliktes besteht im Bejahen eines dynamischen, sich wiederherstel-lenden, sich perpetuierenden Gleichgewichts durch die verschiedenen, erinnerten Momente hindurch. Genau dies gelingt dem Bewusstsein am Ende von Die Phänomenologie des Geistes.“ (Carmele a.a.O. S. 7, Hervorhebungen im vorletzten Satz durch mich.)
Erfolge dieser Art kann das Bewusstsein erzielen, solange es nicht unglücklich wird, sondern gesund bleibt, und zwar im Einklang mit den von Hegel vorgelegten Bestimmungen (s.o.).
Herr und Knecht
Eine Abweichung vom Prinzip der Identität von Selbstbewusstsein und anerkennendem Be-wusstsein sieht Hegel in dem zwischen Herr und Knecht herrschenden Abhängigkeitsverhält-nis. Er schreibt dazu:
„Der Herr bezieht sich mittelbar durch den Knecht auf das Ding. Dem Herrn dagegen wird durch diese Vermittlung die unmittelbare Beziehung (auf das Ding) als die reine Negation desselben oder der Genuß; was der Begierde nicht gelang, gelingt ihm, damit fertig zu werden und im Genusse sich zu befriedigen. … Die Wahrheit des selbständigen Bewußtseins ist … das knechtische Bewußtsein. Dieses erscheint zwar zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit des Selbstbewußtseins. Aber wie die Herrschaft zeigte, daß sie das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegenteil dessen werden, was sie unmittelbar ist; sie wird als in sich zurückgedrängtes Bewußtsein in sich gehen und zur wahren Selbständigkeit sich umkehren.“ (Hegel, in: Bloch a.a.O. S. 85 f.)
Hierzu kommentiert Bloch: „Allerdings ist das Bewußtsein seiner selbst, wozu sich der Knecht erhebt, bei Hegel vor allem ein Bewußtsein der Zucht. Doch wie der Knecht, indem er durch sein eigenes Tun die Dinge bildet, sich selber bildet, während der Herr des arbeitslosen Einkommens nur noch im Genuß, bestenfalls im Machtgenuß vorkommt, so wird durch Arbeit, durch dieses Formieren das Bewußtsein eigener Kraft und Tätigkeit seiner selbst inne, zunächst wenigstens als freies Denken: >Es wird also durch dies Wiederfinden seiner durch sich selbst eigener Sinn, gerade in der Arbeit, worin es nur fremder Sinn zu sein schien< (II, S. 149).“ Und, einschränkend differenziert:
„Das Selbstbewußtsein ist im Verhältnis von Herr und Knecht immer noch ein gedop-peltes, es kommt nicht anders zu sich. Die Doppelheit Herr und Knecht wird sogar dualistisch in der Gestalt, die Hegel >das unglückliche Bewußtsein< nennt, diese Un-vereintheit von Jenseits und Diesseits, in der Hegel, wie bemerkt, das christliche Mittelalter gesehen hat, die subjektive Eitelkeit der Askese und die objektive Leerheit des heiligen Grabs (der unmenschlichen Transzendenz).“ (Bloch a.a.O. S. 86)
Die Vernunft
stammt laut Hegel vom „Vernehmen“ des göttlichen Logos, so dass sie per se zum Ab-soluten gehört – eine Vorwegnahme der höchsten von Hegel konstruierten Stufen der „Er-scheinungslehre“, denen des Absoluten Geistes und des Absoluten Wissens. Insofern sei die gesamte, von Gott erschaffene geschichtliche Wirklichkeit als „vernünftig“ anzusehen: „Das Wirkliche ist vernünftig, und das Vernünftige ist wirklich.“ Vernünftig sei daher auch alles Unvernünftige, Widersinnige, Sinnlos-Zerstörerische, und zwar in der „List der Vernunft“, durch die „selbstverständlich“ auch Unschuldige dem „Höchsten Gut“, der Allmacht des Absoluten, geopfert werden dürften. …
Kurioserweise widmet Hegel der Vernunft 1807 fast 150 Seiten, 1817 aber nur weniger als 1 Seite. In der Fassung von 1817 ist aufschlussreich die Unterscheidung zwischen gesetzgeberi-scher und gesetzprüfender Vernunft. Zur ersteren bemerkt Hegel:
„Was also dem Bewußtsein der Gegenstand ist, hat die Bedeutung, das Wahre zu sein; es ist und gilt in dem Sinne, an und für sich selbst zu sein und zu gelten; es ist die ab-solute Sache, welche nicht mehr von dem Gegensatze der Gewißheit und der Wahr-heit, des Allgemeinen und des Einzelnen, des Zwecks und seiner Realität leidet, sondern deren Dasein die Wirklichkeit und das Tun des Selbstbewußtseins ist; diese Sache ist daher die sittliche Substanz; das Bewußtsein derselben sittliches Bewußt-sein.“13
Diese sittliche Substanz werde „unmittelbar anerkannt“ (a.a.O. S. 312). – Den geschichtlichen Weltinhalt, „die Sache selbst“, nennt Hegel auch „das geistige Tierreich“; wozu Ernst Bloch feststellt:
„Den negativen Gegenschlag zum geistigen Tierreich führt derart die gesetzgebende Vernunft, aus lauter Geboten bestehend, die ebenso Verbote sind; diese Vernunft löst sich selber in die gesetzprüfende auf. Die Vernunft, indem sie ihre Vermittlung mit der Welt ebenso gewinnt wie selbst erschüttert wie als Aufgabe weitergibt, bereitet so den Boden für das nächste, moralisch-konkrete Erfahrungsreich: für das des Geistes.“14
Der Geist
Was für Hegels Vernunft-Begriff gilt, gilt erst recht für seinen Geist-Begriff. Gemäß christ-licher Glaubensvorstellung hat Gott = Geist sich im Menschen „inkarniert“, ist in ihm dialek-tisches Subjekt-Objekt geworden. Erstaunlich: Nachdem Hegel vom Hier und Jetzt bis zur Vernunft seinen „Aufstieg zum Absoluten“ vollzogen hat, vollführt er diesen Aufstieg erneut in seinen Kapiteln über den Geist, wobei er 1817 zunächst zwischen subjektivem (theore-tischem und praktischem) und objektivem Geist (= Recht, Moralität, Familie, Gesellschaft und Staat) unterscheidet.
Im Mittelpunkt steht dabei immer wieder – und angesichts meines Oberthemas glücklicher-weise – der Begriff Intelligenz, und zwar vor allem in den Sphären von Empfindung und Gefühl, Anschauung, Erinnerung, Einbildungskraft, Gedächtnis, Vorstellung, Sprache und Denken. Erst jetzt also – und nicht schon im Anschluss an das vage Hier und Jetzt – berücksichtigt Hegel die Faktoren Empfindung und Gefühl, wobei er diese, neben der Sprache, gemäß seiner idealistischen Grundüberzeugung nicht auch dem Körper, sondern aus-schließlich dem Geistig-Seelischen zuordnet.
Intelligenz bedeutet Erkenntnisfähigkeit. Schon in der Empfindung bzw. der „empfindenden Intelligenz“ seien Vernunft und Geist vorgebildet. Aber erst die Intelligenz verbinde die Emp-findung mit dem Geist. Und erst die geistige „Anschauung“ (nicht: Vorstellung!) lasse das je-
weilige Objekt der Empfindung erkennen. Anschauung sei eine Form von „sinnlichem Be-
wusstsein“, und zwar „ein von der Gewißheit der Vernunft erfülltes Bewusstsein“.15
Zur Vorstellung werde die Anschauung erstens durch die Erinnerung, zweitens durch die Ein-bildungskraft und drittens durch das Gedächtnis (vgl. a.a.O. S. 258). Die „eigentliche Vorstel-lung“ sei eine Synthese aus innerlichem Bild und erinnertem Dasein (S. 261).
Bei der Einbildungskraft unterscheidet Hegel zwischen der Reproduktion (von Bildern) und der Ideenassoziation; wobei sie „ überhaupt das Bestimmende der Bilder“ sei (S. 264), während die Intelligenz u.a. als „die Macht über den Vorrat der ihr angehörenden Bilder und Vorstellungen“ zu definieren sei (S. 265 f.)
Die Anschauung produziere nicht sich selbst, sondern etwas anderes, nämlich die Bedeutung als Zeichen, dies sowohl verbal als non-verbal. Auch die Sprache könne als ein Produkt der Intelligenz aufgefasst werden. Speziell in der Buchstabenschrift werde das Wort zum Gegen-stand und Mittel der Reflexion, und zwar mit Hilfe von Gedächtnis und Denken. (S. 270 f.)
Das Gedächtnis speichert die verbalen und non-verbalen Bedeutungen. Das reproduzierende Gedächtnis vermittle in der Bedeutung den ihr zu Grunde liegenden Sachverhalt. „Das Wort gibt … den Gedanken ihr würdigstes und wahrhaftestes Dasein.“ (S. 280)
Da die Intelligenz „wiedererkennend“ ist, findet sie im Denken ihre „letzte Haupt-entwicklungsstufe“ (S. 283) Denken und Sein gehen angeblich ineinander über. Zum reinen Denken aber komme man nur durch das Wissen, ohne deshalb bloß formell oder abstrakt zu werden (S. 284). Das Denken müsse konkret, d.h. eine Form des „ begreifenden Erkennens“ werden (ebd.), dies vor allem durch die logischen Grundfunktionen: Begriffe, Kategorien, Urteil und Schluss. Im Begriff habe das Denken keinen anderen Inhalt als sich selber; Wahrheit entstehe aus objektiver Vernunft.
Als freier Begriff bestimme sich das Denken durch den Willen (S. 287). „Die Intelligenz hat sich uns als der aus dem Objekte in sich gehende, in ihm sich erinnernde und seine Innerlichkeit für das Objektive erkennende Geist erwiesen.“ (S. 289) Wobei die Intelligenz keineswegs dem Gefühl, d.h. dem „Herzen und Willen“ schade. Wahrheit könne es aber nicht in der Einzelheit des Gefühls, sondern nur in der Allgemeinheit der Intelligenz geben.
Ähnliches gelte für die Triebe, die von der bloßen Begierde zu unterscheiden seien. Der Trieb sei „eine Form der wollenden Intelligenz “ (S. 295), folglich zu ergänzen durch die „ Lehre von den rechtlichen, moralischen und sittlichen Pflichten “ (S. 297).
Wirklich frei sei der Geist erst im „ Begriff des absoluten Geistes“ (S. 301). Womit die Darstellung in der Phänomenologie ihre höchste und letzte Stufe erreicht, 1807 dargestellt als „ das absolute Wissen “.16 Dahin gelangt die Intelligenz und mit ihr die Philosophie nach einem kritischen Durchgang durch Kunst und Religion, wobei das Logische „zur Natur und die Natur zum Geiste“ werde. Die Natur der Sache aber sei der Begriff in der Tätigkeit des Erkennens, „die ewig an und für sich seiende Idee“, die „sich ewig als absoluter Geist betätigt, erzeugt und genießt.“ (1970 a.a.O. S. 393 f.) Dabei werde sogar das Ding zum Ich: „ Das Ding ist Ich. “ (1976, S. 577), zumal jedes Ding nur an seiner Nützlichkeit gemessen werde. Die letzte Gestalt des Geistes aber sei das absolute Wissen oder auch: „der sich in Geistsgestalt wissende Geist oder das begreifende Wissen “ (1976, S. 582). Wobei die Substanz zum Subjekt werden solle. Dies sei „der in sich zurückgehende Kreis, der seinen Anfang voraussetzt und ihn nur im Ende erreicht“ (a.a.O. S. 585). Und der Geist vollende sich als „Weltgeist“, während die Geschichte „das wissende, sich vermittelnde Werden sei (S. 590). Ziel des Ganzen sei „ der absolute Begriff “; die Geschichte und „die Wissenschaft des erscheinenden Wissens“ bilden zusammen „die Erinnerung und die Schädelstätte des absoluten Geistes“ in seiner Unendlichkeit (S. 591). –
Demgemäß sei auch die Auslegung des Absoluten „die eigene Auslegung des Absoluten und nur ein Zeigen dessen, was es ist.“17 Immerhin habe die Auslegung aber „nicht im Absoluten ihren Anfang, sondern ihr Ende.“ (a.a.O. S. 190) Die Auslegung bewege sich also stets von der Wirklichkeit der Analyse hin zum Konstrukt des Absoluten. .
Kritische Anmerkungen
Wer aber sollte hierbei der Akteur sein, wenn nicht das Subjekt selbst? Zumal Wahrheit nicht einfach mit „der absoluten Idee allein“ identisch ist, wie Hegel vermeint, sondern – gemäß der von ihm hoch gepriesenen Korrespondenztheorie der Wahrheit – stets damit beginnt, dass das Subjekt eine Übereinstimmung zwischen einer Aussage und dem ausgesagten Sachverhalt feststellt. Letztlich geht „das Absolute“ in der Sphäre des Endlichen, Nicht-Absoluten auf. Auch wenn das Subjekt in Sprache, Denken und Erkennen von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch macht, bewegt es sich im Bereich des Endlichen, Nicht-Absoluten – und dies anscheinend endgültig, was im Folgenden zu überprüfen sein wird.
Wie schon mehrfach angeführt, beruht Hegels Begriff des Absoluten nicht auf nachprüfbaren Fakten, sondern auf religiösen Glaubens -Inhalten. Im Einzelnen präsentiert Hegel dabei folgende Setzungen:
1. Glaube und Wissen sind gleichzusetzen.
2. Gott bzw. das Absolute ist der absolute Sinnstifter der Weltgeschichte.
3. Gottes Geist manifestiert sich im positiven Fortschreiten der Weltgeschichte, z.B. als Welt-geist, Volksgeister, objektiver und subjektiver Geist, bis hin zum absoluten Wissen und absoluten Geist.
4. Vernunft ist „das Vernehmen des Göttlichen“.
5. Alles Vernunft-, Zweck- und Sinnwidrige kann als „List der Vernunft“ interpretiert werden.
6. Geistige und somit philosophische Einsicht in das Absolute ermöglicht „absolutes Bestim-men“.
7. Ziele der Geschichtsphilosophie sind a) das Erkennen des gottgewollten (absoluten) Endzwecks, b) die „sich wissende Wahrheit, die sich selbst erkennende Vernunft.“
Hierzu mein Kommentar:
zu 1): Glaube und Wissen sind nicht gleichzusetzen, und zwar schon deshalb nicht, weil – wie schon Kant bemerkte – Wissen stets auf Objekte, d.h. überprüfbare Fakten, angewiesen ist, der religiöse Glaube jedoch nicht.
zu 2): Gott für einen „absoluten Sinnstifter“ zu halten, ist ein Glaubenssatz, d.h. eine unbe-weisbare Behauptung.
zu 3) und 4): Auch hier werden Glaube und Wissen in unzulässiger Weise vermengt.
zu 5): Eine „List der Vernunft“ (überdies noch als „absolute“) zu vergöttern, zeugt von mangelndem Respekt gegenüber den zahllosen Opfern der Weltgeschichte.
zu 6): Den Geist zu verabsolutieren, erscheint heute schon deshalb unzulässig, weil die wichtigsten Funktionen des Geistes in der Großhirnrinde (Neocortex) des Menschen nach-gewiesen wurden, die als solche nicht vom Ganzen des Gehirns, des Körpers und der leib-seelischen Gesamtkonstellation zu trennen sind. – „Absolutes Bestimmen“ wäre unfehlbar, was es aber nicht geben kann, weil jegliches Bestimmen theorieabhängig und daher fehlbar ist.
zu 7): Für den „absoluten Endzweck“ und die „sich selbst erkennende Vernunft“ gelten sinngemäß meine Einwände gegenüber den Begriffen des Absoluten, des Zwecks und der Vernunft.
Fazit: Anscheinend erweisen sich fast alle Grundbegriffe der Hegelschen Absolutheits-Philo-sophie als unhaltbar. Ähnliches gilt für die damit verbundenen Konstrukte. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Hegel die Teleologie nicht für die höchste Kategorie hält, sondern sie den angeblich höher stehenden Begriffen der „Idee“ (des Lebens, der Sittlichkeit und des absoluten Geistes) unterordnet.18
Zu den Stufen der ‚Phänomenologie‘
In Bezug auf das Hier und Jetzt nimmt Hegel anscheinend das vorweg, was moderne Neuro-wissenschaftler nachweisen: dass es unbeständige, nicht verlässliche Faktoren sind. Nicht im Jetzt des Augenblicks, sondern erst in längeren Zeiträumen kann das Leben wirklich gelebt und genossen werden. Nach wie vor relevant scheint daher die Empfehlung, die Horaz vor mehr als 2000 Jahren mit seinem ‚Carpe diem‘ (‚Nutze den Tag!‘) gegeben hat. Auf diese Empfehlung geht Hegel anscheinend nicht ein. Was verstehbar wird, wenn man bedenkt, dass er die Gleichung „Ding = Ich“ aufgestellt hat, und zwar auf Grund der Tatsache, dass wir Menschen die dinglichen Gegenstände der Welt danach bewerten, in welchem Maße sie für uns von Nutzen sein können. Wenn alle Dinge in unserem Bewusstsein Teile unseres Ichs werden könnten, dann deshalb, weil wir sie ohnehin ständig nutzen, so dass wir der Horazischen Empfehlung nicht bedürften. Allerdings: Hegel übersieht die Tatsache, dass die Dinge als solche unabhängig von unserem stets subjektiven Bewusstsein existieren und keineswegs gleichmäßig verteilt und allen Menschen gleichermaßen zugänglich sind. Das ‚Carpe diem‘ behält also seine Berechtigung.
Vom Hier und Jetzt springt Hegel unmittelbar zur Wahrnehmung; ignoriert dabei die Tat-sache, dass jeglicher Wahrnehmung die Sphären der Empfindungen, Gefühle und Emotionen voraus- und zu Grunde liegen. Der Grund für dieses Ignorieren dürfte mit Hegels Idealismus zusammenhängen. Da Empfindungen, Gefühle und Emotionen zunächst körperliche Phäno-mene sind, müssen sie vorzugsweise materialistisch, nicht idealistisch erklärt werden – wozu Hegel aus nahe liegenden Gründen nicht in der Lage war; sein System des Idealismus wäre in sich zusammengebrochen.
In welchem Maße der Körper von Empfindungen etc. betroffen ist, geht aus einer Abhandlung hervor, aus der ich auszugsweise zitiere:
„Die Grundlage unserer Emotionen sind biologische, neurologische und hormonelle Aktivierungen, die wir als körperliche Empfindungen erleben. Zum Beispiel, wenn du traurig bist, könntest du Bauchschmerzen fühlen, wenn du Angst hast, fühlst du Aufruhr in deinem ganzen Körper, wenn du glücklich bist, könntest du eine ange-nehme Wärme und Ruhe spüren.
Da Emotionen im Körper sehr stark spürbar sind, folgt daraus auch, dass wir oft körperliche Mechanismen nutzen, um sie zu regulieren. Zum Beispiel könnten die meisten Menschen bemerken, dass sie, wenn sie emotionale Schmerzen verspüren, seufzen, tiefe Vorwürfe machen oder Muskeln im Bauch straffen. Vielleicht hast du erlebt, wie anstrengend es sein könnte, deine Tränen zurückzuhalten? Während es völlig in Ordnung ist, ab und zu Tränen zurückzuhalten, kann es anstrengend sein, nie in der Lage zu sein, Emotionen auszudrücken. Wenn man viele unverarbeitete Emo-tionen hat und sie nie ausdrückt, verwandelt sich dies in der Regel in körperliche Beschwerden, Schmerzen und Unannehmlichkeiten.
Es ist zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die mit vielen schmerzhaften emotionalen Gefühlen zu kämpfen und diese nicht bewältigt haben, steife Nacken und Schultern, Kopfschmerzen, Verspannungen im Kiefer, Bauchschmerzen und Probleme mit der Verdauung haben. Einige wenden auch andere Methoden an, um mit Gefühlen umzugehen, wie Alkohol, Drogen, zuviel Nahrung oder übermäßige Bewegung, die wiederum Schäden am Körper verursachen können.
Es ist wichtig zu wissen, dass schmerzhafte Emotionen an sich nie gefährlich sind, obwohl sie anstrengend, beängstigend und überwältigend sein können. Es ist norma-lerweise schmerzhafter, keine Emotionen zu haben als sie zu haben. Oftmals, wenn wir mit Emotionen in der Therapie arbeiten, arbeiten wir viel damit, schwierige Emotionen dort sein zu lassen und dann gute Wege zu finden, mit ihnen umzugehen oder sie sogar zu verändern. Dies reduziert in der Regel körperliche Beschwerden.“19
Empfindungen, Gefühle und Emotionen sind stets auch Formen von Wahrnehmung, so dass sich die von Hegel postulierte Stufenfolge der Phänomenologie schon bei der Wahrnehmung als unhaltbar erweist, zumal er die Gefühls-Phänomene als rein geistige betrachtet und daher erst in den Schlusskapiteln über den Geist behandelt.
Schon mit der Wahrnehmung will Hegel anfangs die Gegenstände des Bewusstseins bestimmen können, kommt dann aber zu dem Schluss, dass dies nicht möglich sei, weil dieses Bestimmen immer wieder „aufgehoben“ werde. Dies mag daran liegen, dass Hegel seine jeweilige Vorstellung von einem Gegenstand für diesen Gegenstand selbst hält, zumal er von der Gleichung „Ding = Ich“ ausgeht. Wenn aber die Vorstellung von einem Gegenstand per se mit diesem identisch ist, erübrigt es sich, diese „Übereinstimmung“ zu überprüfen, z.B. an Hand der Korrespondenztheorie der Wahrheit, die Hegel ausdrücklich befürwortet, so dass er in einen Widerspruch zu seiner Gleichung „Ding = Ich“ gerät. – Überdies ist seine Analyse der Wahrnehmung unvollständig, da diese mit Faktoren des Bewusstseins arbeitet, die Hegel erst auf den höheren Stufen des Verstandes und des Geistes ansiedelt, so dass seine „Stufenfolge“ sich erneut als unzutreffend und willkürlich erweist. – Heutigem Forschungs-stand entsprechend ist bei der Wahrnehmung Folgendes zu beachten:
1. „Unsere Wahrnehmung wird von vielen Aspekten beeinflusst.
Nachdem Wundt den Grundstein für die experimentelle Forschung auf dem Gebiet gelegt hatte, entwickelten sich weitere Richtungen und schließlich die heutigen Teildisziplinen der Psychologie. Der Teil, der sich vor allem mit Empfindungen und Wahrnehmungen befasst, ist die Kognitionspsychologie.
Neben der Wahrnehmung und Empfindung, beschäftigt sich die kognitive Psychologie zudem auch mit dem Gedächtnis, der Sprache oder dem Lösen von Problemen. Da die Wahrnehmung allerdings von unseren Sinnen abhängt, bestehen auch Schnittstellen mit der biologischen Psychologie und den Neurowissenschaften.
Doch auch die Sozialpsychologie spielt bei der Wahrnehmung eine Rolle, da unsere soziale Umwelt einen Einfluss darauf hat, wie wir Informationen interpretieren. Wir alle besitzen eine bestimmte, persönliche Sicht auf die Welt, welche sowohl durch unsere kulturelle und soziale Umwelt als auch durch unsere Erfahrungen beeinflusst werden. Wir nehmen demnach nicht die objektive Realität wahr, sondern sehen die Welt sozusagen durch unsere eigene Brille.“20
2. „Die Wahrnehmungskette (aus: Wikipedia – Wahrnehmung)
Die Wahrnehmungskette als Modell der Wahrnehmung (1956 bei John Raymond Smythies: „causal chain of perception and action“)[20] beruht auf der Gegen-überstellung von einem Wahrnehmungsapparat und einer Außenwelt. Die Kette besteht aus sechs Gliedern, die jeweils auf ihr Folgeglied Einfluss ausüben und an jeder Art von Wahrnehmung in genau dieser Reihenfolge beteiligt sind. Sie ist in sich geschlossen, d. h. das sechste Glied beeinflusst wiederum das erste Glied der Kette:
Reiz
Die Objekte in der Außenwelt erzeugen Signale, z. B. reflektieren sie elektro-magnetische Wellen oder sie vibrieren und erzeugen so Schall. Ein solches Signal, das auf Eigenschaften des Objektes beruht und keines Beobachters bedarf, nannte Gustav Theodor Fechner „Distaler Reiz“. Distale Reize sind i. A. physikalisch messbare Größen; Ausnahmen werden von der Parapsychologie unter dem Begriff Außersinnliche Wahrnehmung erforscht.
Transduktion, Transformation
Ein distaler Reiz trifft auf die Sinneszellen (auch Sensoren bzw. Rezeptorzellen), wo er durch Interaktion mit diesen zum proximalen Reiz wird. Sensoren sind speziali-sierte Zellen des Körpers, die durch bestimmte Stimuli erregt werden. Sie verwandeln verschiedene Arten von Energie (wie Licht, Schall, Druck) in Spannungsänderungen um, ein Vorgang, der Transduktion genannt wird. Wenn beispielsweise bestimmte elektromagnetische Wellen auf die Photosensoren des Auges treffen, lösen sie dort über eine chemische Verstärkungskaskade ein Rezeptorpotenzial aus. Rezeptor-potenziale werden anschließend entweder in der Zelle selbst (primäre Sinneszelle) oder wie bei der Retina des Auges, deren Sensoren sekundäre Sinneszellen darstellen, nach synaptischer Übertragung auf eine Nervenzelle in Aktionspotenzialfolgen umkodiert: Transformation. Sensoren sind meistens in spezielle biologische Strukturen eingebettet, die ihre Fähigkeiten als Sinnesorgan erweitern, z. B. als Beweglichkeit des Augapfels oder als Trichterwirkung der Ohrmuscheln.
Verarbeitung
Im Sinnesorgan selbst findet oft eine massive Vorverarbeitung der empfangenen Signale statt, besonders aber in allen folgenden Kerngebieten des Gehirns, unter anderem durch Filterung, Hemmung, Konvergenz, Divergenz, Integration, Summation und zahlreiche Top-down-Prozesse. …
Wahrnehmung
Der nächste Schritt ist die Bewusstwerdung des Perzepts (Kognition): Schall wird zum Ton oder Geräusch, elektromagnetische Strahlung zu Licht
Wiedererkennung
Prozesse wie Erinnern, Kombinieren, Erkennen, Assoziieren, Zuordnen und Urteilen führen zum Verständnis des Wahrgenommenen und bilden die Grundlage für Reaktionen auf den distalen Reiz. Dabei müssen diese Prozesse keineswegs zu einem klar umrissenen gedanklichen Bild führen, auch Empfindungen wie Hunger, Schmerz oder Angst sind Ergebnis der Kognition.“
3. „Die Wahrnehmung ist ein menschlicher Mechanismus, der den gesamten Menschen betrifft und nicht nur auf die Sinnesorgane beschränkt ist. Alte Informa-tionen werden mit neuen gekoppelt, um so neue Muster herstellen zu können, die wiederum als Grundlage für neue Koppelungen dienen. Auf diese Weise ist der Prozess der Wahrnehmung ein theoretisch unendlicher Kombinierungsprozess von neuen mit alten Erfahrungen.
Der Geist strukturiert Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Erleben und fasst diese zu Bewusstseinszuständen zusammen.“21
Hegel ignoriert also zahlreiche Faktoren der Wahrnehmung, die er allerdings großenteils zu seiner Zeit noch nicht kennen konnte. Solche Faktoren sind:
1. Die Wahrnehmung beschränkt sich nicht auf die Aktivierung eigener, an den Gegenstand herangetragener Vorstellungen. Sie beteiligt vielmehr nahezu alle Faktoren und Funktionen des Bewusstseins.
2. Objekte der Außenwelt erzeugen Signale, auch völlig unabhängig vom Beobachter: „distale Reize“.
3. Zunächst durch Sinneszellen (Sensoren) werden die Signale verarbeitet.
4. Die Perzepte werden bewusst, z.B. Schall als Ton usw.
5. Unterschiedliche mentale Prozesse verhelfen zum Verstehen des Wahrgenomme-nen.
6. Die Wahrnehmung betrifft den ganzen Menschen.
7. Der Geist verbindet die Wahrnehmung mit anderen Bewusstseinszuständen.
8. Die Wahrnehmung ist Gegenstand u.a. von (Kognitions-)Psychologie, Psycho-analyse, Neurowissenschaften und Sozialpsychologie.
In Bezug auf den Verstand ist unklar, was Hegel unter dem „Inneren“ eines Gegenstandes versteht, das diesen angeblich dem Ich assimiliert. Ebenso nicht plausibel ist seine Behaup-tung, das Ich sei völlig dem Gesetz unterworfen. Dies steht nämlich in Widerspruch zur Willensfreiheit, die Hegel andernorts positiv bewertet. Erst recht gilt dieser Einwand, wenn Hegel das Leben selbst zum Hauptgegenstand von Verstand und Gesetz erklärt. Nicht erst vom Verstand her ergeben sich Bezüge zum Bewusstsein im Ganzen (s.o. zur Wahrnehmung). – Aufgabe des Verstandes ist es u.a., die spezifischen Merkmale und Eigenschaften des jeweiligen Gegenstandes des Bewusstseins zu bestimmen, was über die Aktivierung von Vor-stellungen weit hinausgeht.
In einem Artikel ‚ Rationalität‘ heißt es zum aktuellen Forschungsstand:
„Der Verstand ist ein Werkzeug der Psyche zur Verhaltenssteuerung. Seine Funktion basiert auf Rationalität. Deshalb wird er als rationaler Verstand bezeichnet. Das Rationale beschreibt den der gesamten Verstandesfunktion zugrunde liegenden Mechanismus:
1. Innerhalb der Wahrnehmung bestimmte Elemente unterscheiden,
2. zwischen den Elementen der Wahrnehmung Zusammenhänge herstellen.
Das wars! Das ist schon alles, was den Verstand ausmacht, und es bildet die Grund-lage für alles, was der Verstand tut. Der Verstand identifiziert in der Wahrnehmung bestimmte Elemente und setzt sie dann zueinander in Beziehung:
1. Unterscheiden, 2. Zusammenhänge herstellen.
Damit lassen sich sehr komplexe Modelle der Realität erstellen, weil es viele verschiedene Arten von Unterscheidungen und auch viele Arten von Zusammen-hängen gibt. Eine Gesetzmäßigkeit ist zum Beispiel eine ganz bestimmte Art von Zusammenhang, welche eine Bedingung mit einer Konsequenz verknüpft:
Bedingung, Konsequenz
Die Unterscheidungen und Zusammenhänge des Verstandes lassen sich in Sprache abbilden und so in eine äußerlich wahrnehmbare und kommunizierbare Form bringen. Dazu werden den Unterscheidungen Begriffe zugeordnet, die dann durch Aussagen zueinander in Beziehung gesetzt werden können: Begriffe bilden die Unterschei-dungen ab und Aussagen stellen Zusammenhänge zwischen den Begriffen her.“22
Das Bewusstsein naturwissenschaftlich, speziell neurologisch, zu erklären, ist bisher – trotz umfangreicher, intensiver Bemühungen – anscheinend nicht gelungen. Der Grund hierfür dürfte darin liegen, dass das Bewusstsein als Ganzes keine materielle, messbare Größe ist, sondern ein Relations-Geschehen; der Geist mit seinen dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen ist eines der wichtigsten Instrumente des Bewusstseins.
In dieser Situation scheint Hegels Ansatz einen willkommenen Ausweg zu bieten. Denn für Hegel ist das Bewusstsein vor allem anerkennendes Selbstbewusstsein, dem u.a. Wahrneh-mung, Vorstellung, Verstand, Vernunft und Geist als Mittel zur Verfügung stehen. Scheinbar bestätigt wird dieses Konzept heutzutage durch die Erforschung der Spiegelneuronen und damit der Grundlage der Empathie. So dass es nahe liegt anzunehmen, dass das Bewusstsein problemlos eine ihrer wichtigsten Aufgaben löst: die spezifischen Merkmale und Eigenschaften der Gegenstände des Bewusstseins nachprüfbar zu bestimmen. Dies ist bei Hegels Konstrukten jedoch nicht der Fall. Seine Behauptungen a) „Ding = Ich“ und b) individuelle Vorstellungen vom Gegenstand bestimmten bereits den Gegenstand selbst, führen ihn in Widersprüche zu der von ihm ausdrücklich befürworteten Korrespondenztheorie der Wahrheit. Kein Ding als solches kann tatsächlich Teil des Ichs werden; Vorstellungen und Beobachtungen können täuschen, variieren außerdem unter verschiedenen Subjekten bzw. Beobachtern. In vielen Fällen reicht die Korrespondenztheorie zur Wahrheitsfindung nicht aus. Nicht selten muss sie durch die Kohärenz- und Konsens-Theorien der Wahrheit ergänzt werden. (Was neuerdings durch KI-Suchmaschinen wesentlich erleichter wird. Aussagen über Sachverhalte sind weitestgehend durch die von der KI bereitgestellten Informationen überprüfbar – auch wenn noch nicht alle Regulierungs- und Kontroll-Probleme und -Notwendigkeiten und auch nicht alle technischen Probleme der KI gelöst sind.)
Kaum Einwände scheinen hingegen zu Hegels Kapiteln über „das unglückliche Bewusstsein“ und über „Herr und Knecht“ vonnöten zu sein. Letzteres Verhältnis nennt Ernst Bloch eines „der wesentlichsten, alle bisherige Geschichte erfüllenden dialektischen Verhältnisse, in denen dieses Selbstbewußtsein in sich und zugleich am Anderen erscheint und sich hoch-bewegt“23. Der Knecht arbeitet, produziert und bildet sich dadurch selbst, während der Herr dem Müßiggang frönt. Zunächst zumindest durch „freies Denken“ gelangt der Knecht dage-gen zum „ Bewußtsein eigener Kraft und Tätigkeit “ (a.a.O. S. 86).
In der Enzyklopädie -Fassung der Phänomenologie fällt auf, dass Hegel zum Bewusstsein nur den „subjektiven Geist“ mit den Stufen vom sinnlichen Bewusstsein bis zur Vernunft zählt, während er, davon abgesetzt, den Geist zunächst psychologisch, sodann als „objektiven Geist“ und schließlich als „Absoluten Geist“ abhandelt. Nicht zu leugnen ist jedoch, dass auch sämtliche Inhalte des Geistes zugleich Bewusstseins-Inhalte sind.
Die Vernunft definiert Hegel in seiner Geschichtsphilosophie, dargelegt u.a. in ‚Die Vernunft in der Geschichte‘ (Hamburg 1955), folgendermaßen:
„ … die Vernunft ist das Vernehmen des göttlichen Werkes.“ (a.a.O. S. 78)
Was natürlich bereits ein Fauxpas, eine unzulässige Vermischung von religiösem Glauben und Wissen ist: Nachweisbar ist die Vernunft, nicht jedoch als „Vernehmen des Göttlichen“. Und dies gilt auch für die folgende, ausführliche Begründung durch Hegel:
„Denn in der Vernunft ist das Göttliche. Der Inhalt, der der Vernunft zugrunde liegt, ist die göttliche Idee und wesentlich der Plan Gottes. Als Weltgeschichte erfaßt ist nicht die Vernunft in dem Willen des Subjekts der Idee gleich, sondern allein die Wirksamkeit Gottes ist der Idee gleich. Aber in der Vorstellung ist die Vernunft das Vernehmen der Idee, schon etymologisch das Vernehmen dessen, was ausgesprochen ist (Logos) – und zwar des Wahren. Die Wahrheit des Wahren – das ist die erschaffene Welt. Gott spricht; er spricht nur sich selbst aus, und er ist die Macht, sich auszuspre-chen, sich vernehmlich zu machen. Und die Wahrheit Gottes, die Abbildung seiner ist es, was in der Vernunft vernommen wird. So geht die Philosophie dahin, daß, was leer ist, kein Ideal ist, sondern nur, was wirklich ist, – daß die Idee sich vernehmlich mache.“ (ebd.)
Immer wieder versucht Hegel hier, religiöse Argumente als philosophische auszugeben. Die von Gott „erschaffene Welt“ enthalte per se alle Wahrheit, die der Philosoph nur nachzuvoll-ziehen habe. Da dies ein Logos sei, der „vernommen“ werde, sei er identisch mit der Ver-nunft, so dass alles Wirkliche vernünftig und alles Vernünftige wirklich sei – auch dies ein unzulässiges Konstrukt! Dieses wird vollends abwegig und inhuman, sobald Hegel auch alles Unvernünftige und Widersinnige einfach in die Vernunft integriert, und zwar mittels der “List der Vernunft“, der immer wieder Unschuldige zum Opfer fallen (s.o.). –
Einer der schärfsten Kritiker von Hegels Vernunft-Begriff ist Friedrich Nietzsche (1844-1900). Seine Antwort lautet im ‚Zarathustra‘: Hinter Deinem Selbst steht Dein Leib. Dein Leib ist eine große Vernunft, die sagt nicht Ich, aber tut Ich! Auch das, was man „Geist“ nennt, ist etwas am Leibe. – Auf diese Weise wendet Nietzsche sich – wohl zu Recht – gegen den Leib-Seele-Dualismus, der verstärkt zum Tragen kommt, sobald Vernunft und Geist obendrein dem göttlichen Logos, dem Absoluten, zugeordnet werden.
Einen Schritt weiter geht Schopenhauer (1788-1860) in seinem völlig pessimistischen Welt- und Menschenbild. Hierzu bemerkt Herbert Schnädelbach (1936-2024):
„Schopenhauer war der erste Philosoph, der mit dem Ernst machte, woran Hegels grandioser Versuch einer rationalen Synthese von Vernunft, Natur und Geschichte gescheitert war: der Endlichkeit unserer Vernunft. … Wir können nun nicht mehr wie Hegel davon ausgehen, dass unsere subjektive Vernunft ein Widerschein oder gar eine Gestalt des ewigen lógos sei; vielmehr spricht alles dafür, dass das Wesen der Welt – sofern wir uns überhaupt noch getrauen, danach zu fragen – durch und durch irrational ist und unsere Vernunft, mit der wir das zu denken versuchen, gewissermaßen ein metaphysischer Ausnahmefall. Dieses irrationale Wesen der Welt dachte Schopen-hauer als blinden, ziellos drängenden Willen, und Nietzsche, die Vertreter der Lebens-philosophie und selbst Heidegger sind dem auf ihre Weise gefolgt. Unsere meta-physikgeschichtliche Situation steht im Zeichen Schopenhauers und nicht Hegels. … Warum also sollte man nach Schopenhauer sich noch dazu entschließen, wie Hegel zu philosophieren? Musste jetzt nicht der Mut der Wahrheit einer anderen Wahrheit gelten, nämlich der Einsicht in das undurchdringliche irrationale Wesen der Welt? … Hegels System ist ein intellektueller Traum, aus dem die Philosophie erwachen musste, als sie erwachsen wurde“.24
Allerdings: Die Behauptung, die Welt sei „durch und durch irrational“, ist inzwischen wissen-schaftlich widerlegt worden, und zwar durch die Erkenntnis, dass auch alle Vernunft-Fakto-ren, jegliche Norm, integrale Bestandteile des menschlichen Wesens sind, zumal diese Fakto-ren im Gedächtnis, d.h. im Unbewussten, gespeichert werden. Hierzu schreibt Benjamin Libet:
„Die bewusste Absicht erscheint etwa 150 msec vor der motorischen Bewegung. Das lässt genügend Zeit dafür, dass die Bewusstseinsfunktion in diesen Prozess eingreift. Der Prozess kann ein Auslöser sein, der ermöglicht, dass ein Willensprozess vollendet wird; dafür gibt es jedoch keine direkten Belege. Es gibt jedoch Belege dafür, dass der bewusste Wille den Prozess stoppen oder unterdrücken kann, so dass es nicht zu einer Handlung kommt. In einem solchen Fall könnte der freie Wille das Ergebnis steuern. Das passt zu unserem Gefühl, dass wir Kontrolle über uns selbst haben, etwas, das die ethischen Systeme von uns verlangen.“25
Und zu den Ergebnissen der Forschergruppe um den Neurologen Markus Kiefer erfährt man:
„Unser Wille ist freier als gedacht. Sind wir Sklaven unseres Unbewussten und können nichts dagegen tun? Hirnforscher sagen: Nein! Unser Bewusstsein kontrolliert unbewusste Prozesse im Gehirn. Der Wille und die automatische Verarbeitung arbeiten Hand in Hand, nicht gegeneinander. Das hat eine Forschergruppe an der Universität Ulm herausgefunden.“26
Diese Ergebnisse stimmen weitgehend mit denjenigen Libets überein. Dass sie allerdings nicht für die epigenetischen und sonstigen unbewussten Körperfunktionen gelten können, liegt auf der Hand. Frappierend ist dennoch a) das hohe Ausmaß der Kontrolle durch das Bewusstsein, b) die Vielfalt der Kooperation zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Ohne die weit gefassten Begriffe für beide Sphären wäre es nicht möglich, den genannten Befunden und Erkenntnissen gerecht zu werden. Mit erheblichen Folgen für die komplexen Fragen von Ethik, Lebensführung, Gesundheitsfürsorge, Psychohygiene usw.
Außerdem: Nicht zu bestreiten ist, dass die Kontrolle durch das Bewusstsein nicht immer gelingt. Man denke nur an die relativ häufigen Fälle von krankhaften Veränderungen, Ungeschicklichkeiten, Naturkatastrophen, Bosheit, Kriminalität und anderen angeborenen und/oder erworbenen Beeinträchtigungen. – Die Macht des Unbewussten ist – wie die des Bewussten – nicht zu überschätzen, aber auch nicht zu unterschätzen. Anscheinend aber müssen und können Balance und Maß individuell herausgefunden und hergestellt werden. – Auch wenn unklar sein mag, wo innerhalb einer Klassengesellschaft die Grenzen des freien Willens liegen.27
Umso mehr ist es erforderlich, einen wissenschaftlich fundierten, nicht religiös verbrämten Vernunft-Begriff zu entwickeln. Dieser sollte folgende Leitsätze enthalten:
1. Die Welt ist nicht völlig irrational, zumal sie in unserem Bewusstsein rational verarbeitet wird.
2. Die Fähigkeit zur Willensfreiheit und zur Unterscheidung von Gut und Böse sind an-geborene Faktoren der Vernunft.
3. Vernunft ist Teil des menschlichen Wesens und als solcher in unserem Unbewussten verankert.
4. Verstand und Vernunft können – neben ethischen und moralischen Maßstäben – das Verhalten steuern.
5. Die Vernunft stützt sich auf die Wahrheit, u.a. in Form der Korrespondenz-, Kohä-renz- und Konsens-Theorien der Wahrheit.
6. Die Vernunft ist integraler Bestandteil des Bewusstseins und des Geistes.
7. Gesetzgebende und gesetzprüfende Vernunft sind, neben anderen Faktoren, Grund-lagen der Gesellschaft und des Staates.
Geist und Intelligenz.
Hegel postuliert „Absoluten Geist“ und „Absolutes Wissen“ auf Grund seiner christlichen Überzeugung, dass Gott Mensch geworden sei. Schon dies kann aber ge-rade nicht absolut gelten, zumal diese Überzeugung den meisten anderen Religionen völlig fremd ist. Genau deshalb fühlte Hegel sich jedoch den anderen Religionen überlegen. Das Ab-solute ist für ihn das Ganze („Das Ganze ist das Wahre.“) – und dieses setzt er mit der Wahr-heit gleich; konkret: der Mensch erkennt die Dinge nicht nur, wie sie „an sich“, sondern auch, wie sie „für sich“, d.h. für das erkennende Subjekt und damit „an-und-für-sich“ sind. – Auch dies ist jedoch nicht akzeptabel. Denn:
1. Das Ganze ist für niemanden mehr überschaubar. Adorno behauptet sogar, das Ganze sei „das Unwahre“.
2. Erkenntnisse gewinnt das Subjekt nicht absolut, sondern in dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen, einer inzwischen gängigen Chiffre für den Geist überhaupt. Diese Beziehungen beruhen auf der prinzipiellen Einheit von Körper, Seele und Geist im Menschen. Dem Bewusstsein dienen die Subjekt-Objekt-Beziehungen als einige seiner wichtigsten Instrumente.
3. Als Subjekt kann der Mensch sich zwar auf das Absolute (= Gott) beziehen, nicht jedoch wie Gott einen Anspruch auf „absolute Wahrheit“ im An-und-für-sich erheben. Seit Karl R. Popper ist nachweisbar nur, dass Aussagen mit Wahrheitsanspruch nur so lange gültig sind, wie sie nicht durch neue Fakten oder Theorien widerlegt worden sind.
Verdienstvoll sind dennoch Hegels Aussagen über den Geist, insofern er sie anderweitig, so z.B. durch empirisch haltbare Analysen der Intelligenz begründet. Intelligenz weist er in fast allen Bewusstseins-Sphären auf, so in „Empfindung und Gefühl, Anschauung, Erinnerung,
Einbildungskraft, Gedächtnis, Vorstellung, Sprache und Denken“ (s.o. S. 10), auch wenn er Empfindung und Gefühle, wie auch die Sprache, „gemäß seiner idealistischen Grundüber-zeugung nicht auch dem Körper, sondern ausschließlich dem Geistig-Seelischen zuordnet“ (ebd.).
Als Erkenntnisfähigkeit beginne die Intelligenz bei der Empfindung, die sie mit der Vernunft und dem Geist verbinde. Erweitert durch Anschauung und Vorstellung, wobei Hegel hier überraschenderweise schon der Anschauung zutraut, das jeweilige Objekt der Empfindung zu erkennen. Zusammen mit der Einbildungskraft verfüge die Intelligenz auch über die Macht der Bilder und Vorstellungen, und zwar u.a. in Form von Zeichen und Bedeutungen, die sowohl in verbalen als auch nicht-verbalen Formen im Gedächtnis gespeichert werden. Wille, Denken und Wissen vervollständigen das Panorama der Intelligenz. – Wobei kritisch anzu-merken ist, dass Hegel von der Intelligenz einerseits Konkretion, andererseits zugleich stets Allgemeinheit verlangt. Wie aber soll dabei das Logische „zur Natur und die Natur zum Geiste“ werden? Die Logik verbleibt doch stets im menschlichen Geist, und die Natur wird im Geist reflektiert, aber nicht mit ihm identisch. „Weltgeist“ und „Volksgeister“ sind anschei-nend ebenso wenig nachweisbar wie „absolutes Wissen“ und „absoluter Geist“. Zumal alles auf die Auslegung des Absoluten ankomme. Die stets im menschlichen Gehirn stattfindende Auslegung kann jedoch nie mit dem Absoluten identisch sein, sondern relativiert dieses – anscheinend endgültig.
Was aber ist nun Erkenntnis ? Ich nehme an, dass sie zwar stets von Sprache begleitet und beeinflusst wird, aber entscheidend erst durch das Denken und andere, auch nicht-sprachliche Erfahrungen gewonnen wird. „Objektive Erkenntnis“ wird in den meisten Erkenntnistheorien für möglich oder zumindest annäherungsweise erreichbar gehalten. Nicolai Hartmann vertritt in seinem Kritischen Realismus die Auffassung, dass beim Erkennen das Subjekt vom Objekt „bestimmt“ werde, zumal das Subjekt – im Gegensatz zu Kants Behauptung – keineswegs der Natur „Gesetze vorschreiben“, sondern lediglich ihre Gesetze entdecken könne. – Dem Thema „Objektive Erkenntnis“ hat Sir Karl Popper ein ganzes Buch (1972/1995) gewidmet. Wohingegen er in seinem Kritischen Rationalismus einräumt, dass Erkenntnis – natürlich auf der Subjektseite – stets von Theorien geleitet werde. Theorien seien so lange gültig, wie sie nicht widerlegt (falsifiziert) worden seien. Popper befürwortet demgemäß eine Evolutionäre Erkenntnistheorie. Dieser zufolge ist objektive Erkenntnis möglich, weil Natur und menschlicher Geist aus gemeinsamen Ursprüngen stammen und daher zwischen ihnen ein Verhältnis der „Passung“ existiere.
Marxistisch wird dagegen der Vorrang der Dialektik von Subjekt und Objekt geltend gemacht. Im Dialektischen Materialismus wird versucht, „Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen“, wie Karl Marx es ausdrückte. Dies bedeutet, dass bestimmte Wahrheiten des Idealismus mit denen des Materialismus verbunden werden sollen. Die Arbeit des Subjekts an seinen Objekten kann nicht als „rein geistige“ verstanden werden. Die Dialektik bekommt einen materiellen Unterbau, in letzter Instanz: die Ökonomie.
Dagegen gelten Lenin s Weiterführungen hin zu einem offiziellen „DiaMat“ (Dialektischen Materialismus des Sowjetsystems), z.B. in Begriffen wie „Abbild“ und „Widerspiegelung“, heute nicht nur neurowissenschaftlich als unzulänglich und überholt.
Sprachlich beruht die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, u.a. auf den stets subjektiven Assozi-ationen von Sendern und Adressaten. Unterschiedliche, letztlich unüberschaubare Wort-Assoziationen führen zu unterschiedlichen Wortfeldern mit unterschiedlichen (Be-) Wertun-gen. Sodass anzunehmen ist, dass auch das für den Erkenntnisprozess unabdingbare Verstehen nicht rein sprachphilosophisch erklärt werden kann.28 Auch in diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, was der Philosoph A.J. Ayer (1910-89) in seiner Oxforder Antritts-vorlesung von 1959 zu bedenken gegeben hat, dass nämlich „die Untersuchung des Sprachgebrauches nicht für die Erhellung der Sachfragen genüge“.29
Zu ergänzen bleiben zwei Formen der Intelligenz, die Hegel nicht erwähnt (bzw. noch nicht kennen konnte): 1. die Emotionale Intelligenz, 2. den Erfindungsgeist. Erstere beruht auf der Empathie (die bekanntlich erst im 20. Jahrhundert durch die Erforschung der Spiegelneuronen zufriedenstellend erklärt werden konnte). Hierzu heißt es in dem Wikipedia-Artikel ‚Emotio-nale Intelligenz‘:
„Dies ist die Grundlage aller Menschenkenntnis und das Fundament zwischen-menschlicher Beziehungen. Ein Mensch, der erkennt, was andere fühlen, kann viel früher die oftmals versteckten Signale im Verhalten anderer erkennen und heraus-finden, was sie brauchen oder wollen. Allerdings weist Goleman selbst in anderen Texten darauf hin, dass zugleich auch erkennbar wird, wie sie negativ beeinflussbar sind /(leadership ability)/.“
David Goleman ist der Autor von ‚Emotionale Intelligenz‘ (1995/1997). Im Übrigen nennt Goleman folgende weiteren Kriterien:
„Die eigenen Emotionen <https://de.wikipedia.org/wiki/Emotion erkennen und akzep-tieren, während sie auftreten. Diese Fähigkeit ist entscheidend für das Verstehen des eigenen Verhaltens und der eigenen Antriebe. (Hintergrund: Viele Menschen fühlen sich gegenüber ihren Gefühlen ausgeliefert, lehnen sie ab und bekämpfen oder vermei-den sie – statt sich der Tatsache bewusst zu sein, dass man Emotionen aktiv steuern kann.)“ (a.a.O.)
Außerdem komme es darauf an, Gefühle situationsgemäß zu kontrollieren und Emotionen in die Tat umzusetzen, um das Selbstgefühl und -bewusstsein zu stärken, und auch mit Bezie-hungen und folglich mit den Gefühlen anderer Menschen angemessen umzugehen. – Als poli-tisch hoch bedeutsames Korollar zur Emotionalen Intelligenz ist kürzlich erschienen: Johannes Hillje: Mehr Emotionen wagen. Wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Popu-lismus überlassen, München 2025.
Zum Erfindungsgeist. „Der Mensch muss sich zu helfen wissen“, lautet ein geläufiges Sprichwort. Solange dies aber nachweislich nicht allen Menschen möglich ist, besteht die Gefahr, dass die von den akuten Bedrohungen ausgehenden Gefahren Überhand nehmen. In ständigem Vorteil befinden sich Menschen, denen es tatsächlich möglich ist, sich selbst zu helfen, weil sie sich auf ihre Fähigkeiten verlassen können. Nicht alle, aber viele Menschen verfügen auch und gerade im Alltag über die Fähigkeit, unvorhergesehene Situationen und Probleme zu meistern, weil ihnen im richtigen Augenblick das Richtige – einfällt.
Einfälle zu haben, ist allen Erfindern und Erfinderinnen sozusagen von Natur aus gegeben. Aber woher kommen die Einfälle? Sicherlich nicht vom Himmel oder aus dem luftleeren Raum, sondern aus eigenen „neuronalen“ Möglichkeiten (die bekanntlich unbegrenzt sind). Wer sein Wissen und seinen Erfahrungen kreativ einbringen, d.h. auf neue Sachverhalte in neuen, originellen Verknüpfungen anwenden kann, hat das – nicht nur dem Genie gegebene – Talent zum Erfinden. Sodass es unverständlich ist, warum der Begriff ‚Erfindung‘ heutzutage mehr und mehr auf seine Verwendung für Zwecke der Technik (z.B. im Sinne des Patent- und Gebrauchsmuster-Rechts) reduziert wird. Zweifellos behält das Erfinden seine Existenz-Berechtigung (und -Notwendigkeit!) auch für Wissenschaft, Kunst, Literatur und Philosophie.
Paradebeispiel: der Umgang mit der Öko-Katastrophe. Wäre diese durch rein technische Lösungen, nämlich auf den Gebieten der Umwelt-Technologie und -Technik, abzuwenden, hätte man hierzu seit mindestens 50 Jahren reichlich Gelegenheit gehabt. Der Grund dafür, dass dies nicht bzw. nicht in ausreichendem Maße geschehen ist, dass vielmehr die Kata-strophe immer bedrohlichere Dimensionen angenommen hat, ist nicht allein auf Mängel der Technologie und deren Anwendung, der Technik, sondern auf politische, gesellschaftliche und ideologische Defizite zurückzuführen. Ein äußerst schwieriges, schwerwiegendes Pro-blem, auf das ich im Schlussteil dieser Arbeit, u.a. im Kapitel ‚Öko-Ethik (II)‘, zurückkommen werde.
Nicht zu unterschätzen ist hier die aufsteigende Werte-Hierarchie: Entdeckung – Erkenntnis – Erfindung. Eine Entdeckung macht, wer etwas auffindet, was vorher unbekannt war. Erkenntnis stellt unter Beweis, wer zutreffende Aussagen über zuvor unbekannte Sachverhalte an Hand zureichender Gründe macht; während die Erfindung aus schöpferischer Tätigkeit hervorgeht, durch die Neues, bisher noch nicht Gegebenes erzeugt wird. Gemeinsam ist diesen drei Stufen, dass sie mit bestimmten Erfahrungen – gepaart mit Denken, Phantasie und Kognition – verbunden sind. Beim Erfinden kommen durchweg hohe Emotionalität und Freude hinzu, nachweisbar angeblich sogar im Gehirn, wo beim Erfinden Dopamin freigesetzt werde, das auch im Gefühlsleben, für Aufmerksamkeit und Konzentration und als „Begleit-musik“ ekstatischer Gemütszustände eine Rolle spielt.30
Unbedingt nachzutragen bleibt die Kritik, die Karl Marx an Hegels Begriff des Absoluten geübt hat; er schreibt in Nationalökonomie und Philosophie (1844):
„Das menschliche Wesen, der Mensch, gilt für Hegel = Selbstbewußtsein. Alle Ent-fremdung des menschlichen Wesens ist daher nichts als Entfremdung des Selbst-bewußtseins. Die Entfremdung des Selbstbewußtseins gilt nicht als Ausdruck, im Wissen und Denken sich abspiegelnder Ausdruck der wirklichen Entfremdung des menschlichen Wesens. Die wirkliche, als real erscheinende Entfremdung vielmehr ist ihrem innersten verborgnen – und erst durch die Philosophie ans Licht gebrachten – Wesen nach nichts andres als die Erscheinung von der Entfremdung des wirklichen menschlichen Wesens, des Selbstbewußtseins. Die Wissenschaft, welche dies begreift, heißt daher Phänomenologie. Alle Wiederaneignung des entfremdeten gegenständ-lichen Wesens erscheint daher als eine Einverleibung in das Selbstbewußtsein; der sich seines Wesens bemächtigende Mensch ist nur das der gegenständlichen Wesen sich bemächtigende Selbstbewußtsein. Die Rückkehr des Gegenstandes in das Selbst ist daher die Wiederaneignung des Gegenstandes.
Allseitig ausgedrückt ist die Überwindung des Gegenstandes des Bewußtseins:
1. daß der Gegenstand als solchen sich dem Bewußtsein als verschwindend darstellt;
2. daß die Entäußerung des Selbstbewußtseins es ist, welche die Dingheit setzt;
3. daß diese Entäußerung nicht nun negative, sondern positive Bedeutung hat;
4. sie nicht nun für uns oder an sich, sondern für es selbst hat.
5. Für es hat das Negative des Gegenstandes oder dessen Sich-Selbst-Aufheben dadurch die positive Bedeutung, oder es weiß diese Nichtigkeit desselben dadurch, daß es sich selbst entäußert, denn in diesen Entäußerung setzt es sich als Gegenstand oder den Gegenstand um der untrennbaren Einheit des Fürsichseins willen als sich selbst.
6. Andrerseits liegt hierin zugleich dies andre Moment, daß es diese Entäußerung und Gegenständlichkeit ebensosehr auch aufgehoben und in sich zurückgenommen hat, also in seinem Anderssein als solchem bei sich ist.
7. Dies ist die Bewegung des Bewußtseins, und dies ist darum die Totalität seinen Momente.
8. Es muß sich ebenso zu dem Gegenstand nach der Totalität seiner Bestimmungen verhalten und ihn nach jeder derselben so erfaßt haben. Diese Totalität seiner Bestimmungen macht ihn an sich zum geistigen Wesen und für das Bewußtsein wird dies in Wahrheit durch das Auffassen einer jeden einzelnen derselben als des Selbsts oder durch das eben genannte geistige Verhalten zu ihnen. [38]
ad 1. Daß der Gegenstand als solcher sich dem Bewußtsein als verschwindend darstellt, ist die oben erwähnte Rückkehr des Gegenstandes in das Selbst.
ad 2. Die Entäußerung des Selbstbewußtseins setzt die Dingheit. Weil der Mensch = Selbstbewußtsein, so ist sein entäußertes gegenständliches Wesen oder die Dingheit (das, was für ihn Gegenstand ist, und Gegenstand ist wahrhaft nur für ihn, was ihm wesentlicher Gegenstand, was also sein gegenständliches Wesen ist. Da nun nicht der wirkliche Mensch, darum auch nicht die Natur – der Mensch ist die menschliche Natur –, als solcher zum Subjekt gemacht wird, sondern nur die Abstraktion des Menschen, das Selbstbewußtsein, so kann die Dingheit nun das entäußerte Selbstbewußtsein sein) = dem entäußerten Selbstbewußtsein, und die Dingheit ist durch diese Entäußerung gesetzt. Daß ein lebendiges, natürliches, mit gegenständlichen, i.e. materiellen Wesenskräften ausgerüstetes und begabtes Wesen auch sowohl wirkliche natürliche Gegenstände seines Wesens hat, als daß seine Selbstentäußerung die Setzung einer wirklichen, aber unter der Form der Äußerlichkeit, also zu seinem Wesen nicht gehörigen und übermächtigen, gegenständlichen Welt ist, ist ganz natürlich. Es ist nichts Unbegreifliches und Rätselhaftes dabei. Vielmehr wäre das Gegenteil rätselhaft. Aber daß ein Selbstbewußtsein durch seine Entäußerung nun die Dingheit, d.h. selbst nun ein abstraktes Ding, ein Ding der Abstraktion und kein wirkliches Ding setzen kann, ist ebenso klar. Es ist ferner klar, daß die Dingheit daher durchaus nichts Selb-ständiges, Wesentliches gegen das Selbstbewußtsein, sondern ein bloßes Geschöpf, ein von ihm Gesetztes ist, und das Gesetzte, statt sich selbst zu bestätigen, ist nun eine Bestätigung des Aktes des Setzens, der einen Augenblick seine Energie als das Produkt fixiert und zum Schein ihm die Rolle – aber nun für einen Augenblick – eines selbständigen, wirklichen Wesens erteilt.“31
Und wenig später ergänzt Marx:
„Diese Bewegung in ihren abstrakten Form als Dialektik gilt daher als das wahrhaft menschliche Leben, und weil es doch eine Abstraktion, eine Entfremdung des menschlichen Lebens ist, gilt es als göttlicher Prozeß, aber als der göttliche Prozeß des Menschen – ein Prozeß, den sein von ihm unterschiednes abstraktes, reines, absolutes Wesen selbst durchmacht.
… Dieser Prozeß muß einen Träger haben, ein Subjekt; aber das Subjekt wird erst als Resultat; dies Resultat, das sich als absolutes Selbstbewußtsein wissende Subjekt, ist daher der Gott, absoluter Geist, die sich wissende und betätigende Idee. Der wirkliche Mensch und die wirkliche Natur werden bloß zu Prädikaten, zu Symbolen dieses verborgnen unwirklichen Menschen und diesen unwirklichen Natur. Subjekt und Prädikat haben daher das Verhältnis einen absoluten Verkehrung zueinander, mysti-sches Subjekt-Objekt oder über das Objekt übergreifende Subjektivität, das absolute Subjekt als ein Prozeß, als sich entäußerndes und aus der Entäußerung in sich zurück-kehrendes, aber sie zugleich in sich zurücknehmendes Subjekt und das Subjekt als dieser Prozeß; das reine, rastlose Kreisen in sich.“ (a.a.O. S. 282)
Solcher Rastlosigkeit setzt Marx sein eigenes Welt- und Menschenbild entgegen:
„Wenn der wirkliche, leibliche, auf der festen wohlgerundeten Erde stehende, alle Naturkräfte aus- und einatmende Mensch seine wirklichen, gegenständlichen Wesens-kräfte durch seine Entäußerung als fremde Gegenstände setzt, so ist nicht das Setzen Subjekt; es ist die Subjektivität gegenständlicher Wesenskräfte, deren Aktion daher auch eine gegenständliche sein muß. Das gegenständliche Wesen wirkt gegenständ-lich, und es würde nicht gegenständlich wirken, wenn nicht das Gegenständliche in seinen Wesensbestimmung läge. Es schafft, setzt nun Gegenstände, weil es durch Gegenstände gesetzt ist, weil es von Haus aus Natur ist. In dem Akt des Setzens fällt es also nicht aus seiner „reinen Tätigkeit“ in ein Schaffen des Gegenstandes, sondern sein gegenständliches Produkt bestätigt nur seine gegenständliche Tätigkeit, seine Tätigkeit als die Tätigkeit eines gegenständlichen natürlichen Wesens.“ (a.a.O. S. 273)
Hieraus entwickelt Marx sodann seine eigene, neue Form des Humanismus in einer Synthese von Naturalismus und Humanismus:
„Wir sehn hier, wie der durchgeführte Naturalismus oder Humanismus sich sowohl von dem Idealismus als dem Materialismus unterscheidet und zugleich ihre beide vereinigende Wahrheit ist. Wir sehn zugleich, wie nur der Naturalismus fähig ist, den Akt der Weltgeschichte zu begreifen.“ (ebd.)
An diese Synthese knüpfte später Ernst Bloch mit seiner humanistischen Allianztechnik der Natur und seinem hypothetischen Natursubjekt an.32
II. KI und die Visionen von Ray Kurzweil u.a.
Mit KI will man bestimmte Funktionen des menschlichen Gehirns nachbilden, simulieren. Maßgebliche Faktoren sind dabei Algorithmen mit programmierten Anleitungen zur optima-len Informationsverarbeitung und vor allem: künstliche neuronale Netze (KNN). Da letztere denen des Gehirns nachempfunden sind, ist es zunächst angebracht, sich die Funktionen der neuronalen Netze des menschlichen Gehirns zu vergegenwärtigen:
„Das neuronale Netz ist … nichts anderes als eine Gruppe von Neuronen, die miteinander kommunizieren und auf diese Weise eine bestimmte Funktion ausüben. Jedes Neuron gibt dabei Informationen an beliebig viele andere Neuronen weiter und erhält gleichzeitig Signale von beliebig vielen anderen Neuronen. Schnittstellen sind immer die Synapsen.
Dieses neuronale Netz wird aber nicht etwa einmal geknüpft und dann für immer so belassen. Vielmehr ist es im Laufe des Lebens in ständiger Veränderung. Man spricht von neuronaler Plastizität: Neue Verbindungen zwischen Synapsen werden geschaffen (z.B. wenn wir etwas Neues lernen) und bestehende Verbindungen gekappt. Wird eine Synapse sehr häufig benutzt, verändert sich zudem ihre Struktur. Zum Beispiel werden mehr Rezeptoren an der postsynaptischen Membran eingebaut oder die Menge an ausgeschütteten Botenstoffen erhöht sich. Dadurch verbessert sich die synaptische Übertragung. Diesen Mechanismus bezeichnet man als Langzeitpotenzierung. Sie ist vermutlich die Grundlage dafür, dass wir Dinge erlernen oder langfristig im Gedächt-nis abspeichern können, wenn wir sie in regelmäßigen Abständen wiederholen. Andersherum werden nicht genutzte Verbindungen mit der Zeit immer schwächer.“33
Wer diese neuronalen Funktionen nachbilden will, muss mit KI zumindest Folgendes zu erreichen versuchen:
1. Die „Neuronen“ müssen miteinander kommunizieren können.
2. Ein Austausch von Informationen muss an beliebig vielen Schnittstellen stattfinden können.
3. In und zwischen den Schnittstellen („Synapsen“) muss Plastizität, d.h. Veränderbar-keit herrschen.
4. Langzeitpotenzierung der Leistungen muss gewährleistet werden.
Fraglich ist, ob jemals die gesamte Bandbreite der Bewusstseins-Fähigkeiten des Gehirns – Gedächtnis, Empfindungen, Gefühle, Emotionen, Wahrnehmungen (u.a. durch Anschauun-gen und Vorstellungen), Verstand, Vernunft und Geist – in KI simuliert werden kann.
Die vier genannten Minimalziele hat man inzwischen – nach jahrzehntelanger Aufbauarbeit – anscheinend weitgehend erreicht. Dabei wurden folgende Strukturen und Funktionen ent-wickelt, die teilweise schon entsprechenden Leistungen des menschlichen Gehirns überlegen zu sein scheinen:
„Die Grundeinheit eines künstlichen neuronalen Netzes ist ein einzelnes Neuron. Einfach ausgedrückt, ist dieses ein Element, das gewichtete Eingaben entgegen nimmt, verarbeitet und eine Ausgabe erzeugt. In Abb. 1 (rechts) ist ein einfaches mathe-matisches Modell eines Neurons, das sogenannte Perzeptron, dargestellt. Das Perzep-tron ist über gewichtete Verbindungen – Kanten genannt – mit einem Satz von Ein-gaben verbunden, wobei das Gewicht der Stärke der Synapsen entspricht. Zusätzlich erhält das künstliche Neuron eine Dummy-Eingabe mit dem Wert 1 und einem eige-nen Gewicht, welches als /Bias/, sprich Achsenabschnitt, bezeichnet wird. Die Ein-gaben, die das Perzeptron erhält, werden auch als Eingabemerkmale bezeichnet.
…
Zur Lösung nichtlinearer Fragestellungen können … mehrere Neuronen miteinander vernetzt und dadurch ein künstliches neuronales Netz aufgebaut werden. Hierzu werden Neuronen in mehreren Schichten angeordnet und gerichtet miteinander ver-bunden, d. h. die Neuronen einer Schicht erhalten die Ausgaben der vorherigen Schicht als Eingabe. Die erste Schicht eines neuronalen Netzes wird als Eingabe-schicht, die letzte Schicht als Ausgabeschicht bezeichnet. Die Menge der Neuronen in der Eingabeschicht wird durch die Anzahl der Eingabedaten bestimmt, die Menge der Neuronen in der Ausgabeschicht hängt von der gewünschten Anzahl an Ergebnissen ab. Dazwischen können beliebig viele verdeckte Schichten, bestehend aus beliebig vielen Neuronen, liegen.
…
Das "Wissen" eines Perzeptrons, also die Regeln, nach denen es bestimmte Aufgaben lösen kann, ist in den Gewichten gespeichert. Diese sind anfangs zufällig gewählt und müssen erst /gelernt/ werden. Im Falle des Perzeptrons wird gelernt, indem die Gewichte des Perzeptrons derart angepasst werden, dass die gegebenen Daten möglichst fehlerfrei durch eine lineare Funktion getrennt werden. Der hierfür verwen-dete Perzeptron-Algorithmus passt die Gewichte nur dann an, wenn der Ausgabewert des Neurons vom Sollwert abweicht. Andernfalls bleiben die Gewichte unverändert. Da bei mehrschichtigen neuronalen Netzen nicht mehr direkt von der Eingabe auf die Ausgabe geschlossen werden kann, ist hierfür der Perzeptron-Lernalgorithmus nicht mehr anwendbar. Der Fehler, also der Unterschied zwischen Ausgabewert und Sollwert, kann nur für die Ausgabeschicht, nicht aber für die verdeckten Schichten gemessen werden.
…
Warum tief? Einblick in die Struktur neuronaler Netze Anders als man denken könnte, verweist das Wort "Deep" nicht etwa auf ein besonders tiefes Problem- oder Lösungsverständnis, das mit Deep Learning erreicht werden kann. Tatsächlich bezieht sich die Tiefe auf die Struktur der verwendeten neuronalen Netze, konkret die Verwendung vieler verdeckter Schichten. Je tiefer das Netz, d. h. je mehr verdeckte Schichten es hat, umso komplexer ist die extrahierte Datenrepräsentation. Wie viele Schichten und Neuronen für eine bestimmte Problemstellung erforderlich sind, lässt sich jedoch nicht pauschal definieren. Wählt man beispielsweise zu wenige Neuronen, erhält man ein zu einfaches Modell, das die Daten nur unvollständig reprä- sentieren kann. Bei zu vielen Neuronen und Schichten hingegen "merkt" sich das Netz alle Daten, die es während des Trainings gesehen hat, was einem Auswendiglernen gleichkommt. Dieses als /Overfitting/ bezeichnete Phänomen hat den Effekt, dass das Netz schlecht generalisiert, also bei unbekannten Daten schlechte Ergebnisse liefert. Tatsächlich ist das Design der verdecktenSchichten immer noch ein äußerst aktives Forschungsgebiet – es existieren noch keine universellen theoretischen Richtlinien, denen man folgen könnte. …
Blick in die Black Box: Erklärung neuronaler Netze Eine Möglichkeit, die generelle Arbeitsweise neuronaler Netze zu erklären, ist die Abbildung des Netzes mittels inhärent interpretierbarer Modelle, sogenannter White- Box-Modelle, wie Entscheidungsbäumen oder Entscheidungsregeln. Entscheidungs- Bäume bestehen aus internen Knoten, die zu überprüfende Bedingungen definieren, und Blattknoten, die Klassen darstellen. Möchte man ein Datum mithilfe eines Ent- scheidungsbaums klassifizieren, wird der Baum von oben nach unten traversiert, bis man einen Blattknoten erreicht, der die Klasse codiert. Um ein Black-Box-Modell nun mithilfe eines solchen White-Box-Modells erklären zu können, wird im ersten Schritt das Black-Box-Modell, etwa ein neuronales Netz, gelernt (s. Abb. 6). Im Anschluss kann ein interpretierbares Stellvertretermodell – auch als /Surrogat/ bezeichnet – aus dem neuronalen Netz extrahiert werden, welches dann zur Erzeugung von Erklärungen genutzt werden kann. …
Blick in die Glaskugel: wohin geht die Reise?
Schon heute existiert eine Vielzahl an Methoden und Techniken, die uns Menschen er- lauben, einen ersten Blick in die Black Box zu werfen. Doch sind wir noch lange nicht am Ziel angekommen. Stand heute gibt es bereits eine Vielzahl an Unternehmen, die die enormen Potenziale der künstlichen Intelligenz nutzt, sei es in hochrelevanten An- wendungen, wie der computergestützen Diagnose im Gesundheitswesen oder dem autonomen Fahren, aber auch zur anfangs erwähnten Bekämpfung des Falschgeld- gebrauchs. Auf der anderen Seite stehen viele Firmen hier aufgrund bisher nicht er- kannter Potenziale, fehlenden Know-hows oder gesetzlicher Hürden erst am Anfang. Doch mit steigender Verbreitung der KI-Anwendungen wird auch der Bedarf von Er- klärbarkeit der eingesetzten Algorithmen steigen. Hier gilt es, bereits existierende Ver- fahren in die Anwendung zu überführen und neue Methoden zu entwickeln. Auch die Frage, welche Art der Erklärung für welche Zielgruppe am besten geeignet ist, wird hierbei noch eine große Rolle spielen. Schließlich hat ein Endanwender ein anderes Interesse an einem KI-Verfahren als der Experte, der es programmiert hat und selbst besser verstehen will.“[34]
Posthumanistische Endzeit-Visionen: R. Kurzweil u.a.
Die rapide Entwicklung der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz (KI) hat den KI- und Zukunftsforscher Ray Kurzweil veranlasst, für das Jahr 2045 eine „Singularität“, den Anbruch eines neuen Weltzeitalters, zu prophezeien. Wobei schon die Wortwahl auffällt, wird doch der Begriff Singularität vor allem zur Charakterisierung des sogenannten „Urknalls“ verwendet. Im Zusammenhang mit KI bedeutet der Begriff aber so viel wie „die Entwicklung einer >Superintelligenz< durch den fortwährenden Gebrauch neuer Technologien“. (Beierlein 2014, S. 1)
Tatsächlich stellt Kurzweil einen totalen Bruch mit der bisherigen Menschheitsgeschichte – und sogar deren Abbruch – in Aussicht. Dabei stützt er sich auf die angeblich nicht linear, sondern exponentiell voranschreitende Entwicklung der Computer-Technologien. In immer kürzeren Abständen verdoppele sich das entsprechende Experten-Wissen, so dass spätestens im Jahre 2045 die Inhalte der menschlichen Gehirne ausnahmslos auf Roboter übertragbar sein würden, die auf Grund ihrer ins Unermessliche zu steigernden Intelligenz den Menschen nicht nur vollständig ersetzen, sondern auch eine ganz neue Ära in der Geschichte des Universums initiieren würden; es werde diesen Super-Wesen gelingen, den gesamten Welt-raum zu erobern. „Es geht um die Entstehung eines Volkes von auserwählten Gott-Menschen, die in den Cyber-Himmel aufsteigen, wo sie als allmächtige und unsterbliche Götter leben, Universen erschaffen, sich mühelos durch Raum und Zeit bewegen und weder natürlichen noch ewigen Gesetzen unterworfen sind. Karma, Wiedergeburt, Sünde und Ethik gelten für diese Wesen nicht mehr, sie haben sich abgekoppelt.“ [35 ]
Vorstufen schon jetzt: Immer mehr unzulängliche („fragile“) Körperteile von Menschen werden durch Prothesen ersetzt. Die Bioelektronik zielt langfristig darauf ab, Cyborgs herzustellen, halb-menschliche Wesen, die überwiegend aus technischen Implantaten bestehen und sich somit auf dem Weg vom „biologischen Menschen zum posthumanen Wesen“ Cyborg (Wikipedia-Artikel 2016, S. 3) befinden. Welche Gefahren dabei für die bisher noch mit unveräußerlichen Rechten ausgestattete menschliche Person entstehen, zeigt sich aktuell bereits an einer Erfindung, die jeder Geheimagent begrüßen dürfte: dem ‚Projekt Google Glass‘. „Glass-Träger können alles, was sie sehen, sofort auf Video aufnehmen – ohne dass die Gefilmten es merken.“[36] Mit der besonders pikanten Pointe, dass sämtliche von ‚Glass‘ gesendeten oder empfangenen Dateien über den Server der Firma Google transportiert werden. Was langfristig nur bedeuten kann, dass die Freiheit der Person in einem System perfekter privatkapitalistischer Überwachung untergeht.
Nichtsdestoweniger hält Kurzweil, der inzwischen als Technischer Direktor bei Google gearbeitet hat, die Entwicklung zum Cyborg und schließlich zum perfekten KI-Roboter für unumkehrbar und sozusagen naturnotwendig. Er glaubt, man könne Geist und Bewusstsein, ja, sogar das Gefühlsleben und die Psyche des Menschen vollständig technisch kopieren und beliebig reproduzieren, zumal er überzeugt ist, eine Parallele zwischen der angeblich hierarchischen Struktur des Universums und derjenigen des menschlichen Gehirns entdeckt zu haben, wonach beide gemäß bestimmter „Informationsmuster“ organisiert seien. Die „300 Millionen Mustererkenner im menschlichen Neocortex ..., die der Erkennung der in der Welt enthaltenen Informationsmuster dienen“, könne man modellhaft nachbilden. Überdies fasst Kurzweil anscheinend „alle seine Überlegungen zum menschlichen Gehirn, künstlicher Intelligenz und der Möglichkeit ihrer Fusion im Konzept der Mustererkennungstheorie des Geistes zusammen“.[37 ] Dem entsprechend werde es schon im Jahre 2029 „bewusste Maschinen“, Roboter mit menschlichem Bewusstsein, geben, denen es bis zum Jahr 2045 gelingen werde, die erwähnte KI-„Singularität“ zu bewerkstelligen. Sein Buch ‚The Sin-gularity is Near‘ beendet Kurzweil mit optimistischen Hinweisen auf die angebliche Trans- formation des Menschen von einem biologischen zu einem rein technologischen Maschinen-Wesen und der kühnen Prophezeiung: „It will continue until the entire universe is at our fingertips.“[38] Ein krasser Widerspruch, denn nicht wir Menschen, sondern die uns ersetzenden Maschinen-Wesen sollen doch das gesamte Universum erobern. …[39]
Update Kurzweil 2024: „Die nächste Stufe der Evolution“
Der Titel des 2024 in New York erschienenen amerikanischen Originals lautet: The Singulari-ty is Nearer, natürlich in Anknüpfung an Kurzweils 2005 erschienenes Hauptwerk The Singu-larity is Near. Die Herausgeber der deutschen Übersetzung im Piper-Verlag (München) wähl-ten für den Titel des Buches nicht die wörtliche Fassung des Originals, sondern: „ Die nächste Stufe der Evolution“, mit dem Untertitel: „Wenn Mensch und Maschine eins werden“. Über die Gründe hierfür kann spekuliert werden. Wahrscheinlich hielt man die wörtliche Überset-zung des Titels für wenig werbewirksam; nahm dafür aber eine leichte Irreführung in Kauf, denn Kurzweil denkt nicht evolutionstheoretisch, sondern durchweg deterministisch. Wie er schon 2005 behauptete, lässt die rasante („exponentielle“) Entwicklung der IT- Und KI-Technologie dem Menschen keine andere Wahl, als sich dem Trans- und Posthumanismus zu unterwerfen. Was Kurzweil hierzu 2024 vorträgt, ist im Wesentlichen eine Bekräftigung und Erweiterung seiner früher vorgebrachten Argumente. Und zwar hauptsächlich zu den The-menbereichen: KI und Intelligenz, „Wer bin ich?“, „ exponentielle“ Verbesserung des Lebens, Zukunft der Arbeitsplätze, Gesundheit und Wohlbefinden sowie abschließend zu den damit verbundenen Gefahren.
Als Grundlage des Bewusstseins nimmt Kurzweil die seit Beginn des Universums vorhandene Information an, wodurch der Bewusstseins-Begriff enorm erweitert wird, keineswegs mehr nur den Menschen betrifft, sondern als „universell“ aufgefasst wird. Für die Zeit seit An-beginn des Ganzen seien sechs Stadien der Entwicklung zu unterscheiden, und zwar:
1. Geburt der Naturgesetze, der Atome usw.,
2. Entstehung des Lebens,
3. Entstehung der Tiere mit Informationen verarbeitenden und speichernden Gehirnen,
4. der Mensch erscheint,
5. in der Zukunft: Verbindung der menschlichen Gehirne mit nicht-biologischen Com-putern („Gehirn-Computer-Schnittstellen“),
6. Ausbreitung dieser Intelligenz über das gesamte Universum in Form von „Materie mit höchstmöglicher Rechendichte“, dem „Computronium“ (a.a.O. 2024, S. 15-19).
Hierzu werde man zunächst die Intelligenz neu erfinden, und zwar im Anschluss an die Ent-wicklung der KI, in der es u.a. urplötzliche, völlig unerwartete Sprünge gebe (S. 22).
Die hohe Komplexität der KI sei mathematisch erfassbar – was Kurzweil mit zahlreichen Bei-spielen ausführlich illustriert. Um der menschlichen Intelligenz endgültig (?) auf die Spur zu kommen, seien Kleinhirn und Neocortex genauer zu analysieren. Und ohne weiteres nachzu-bilden im Deep Learning als neuer Form von KI (S. 48 ff.). Der entscheidende Faktor zur Erzielung ausreichender Intelligenz sei der Umfang der Rechenleistung, die immer kosten-günstiger gestaltet werde (S. 64 f.). – Dagegen hänge im Hinblick auf die Singularität (2045?) alles von der Qualität der PC-Programmierung ab, die darauf abzielt, dass KI sich autonom entwickelt, d.h. sich selbst Programmier-Kenntnisse beibringt. Ziel ist offenbar die superin-telligente KI-Nachbildung sämtlicher menschlicher Intelligenz-Leistungen, bis hin zum Com-mon Sense (dem „gesunden Menschenverstand“), wobei gegenwärtig schon Versuche mit Ge-hirn-Implantaten stattfinden (S. 83), was letztlich auf eine all-umfassende Beusstseins-Erwei-terung hinauslaufe.
Folgerichtig stellt Kurzweil in Kap. 3 („Wer bin ich?“) erneut Überlegungen zum Bewusst-seins-Begriff an. Er versteht darunter nicht nur die bewusste Beziehung zur Umwelt, sondern vor allem „ die Fähigkeit zum subjektiven Erleben aus innerer Perspektive “ (S. 87). In den 2020er und 2030er Jahren werde es durch KI gelingen, genau diese Perspektive und damit das Bewusstsein erheblich und entscheidend zu erweitern und zu vertiefen.
In Bezug auf die Willensfreiheit sieht Kurzweil das Hauptproblem darin, dass unter den Theo-retikern Uneinigkeit darüber bestehe, wie diese Freiheit zu definieren sei, zumal dabei Deter-minismus und Indeterminismus zu verbinden seien (S. 94).
Für die 2040er Jahre sagt Kurzweil voraus, dass Nanobots in die Gehirne gelangen und voll-ständige Kopien der Bewusstseins-Inhalte anfertigen. Durch solche Verschmelzung würden endlich auch „die Schwächen der Biologie“ überwunden werden (S. 123). – Äußerst opti-mistisch äußert Kurzweil sich über Möglichkeiten der Lebensverbessrung durch KI. Auch diese Verbesserung werde exponentiell (!) vonstatten gehen. Die bisherige, aus grauer Vorzeit stammende „Vorliebe für schlechte Nachrichten“ sei – ebenso wie die Neigung zur Verklä-rung der Vergangenheit – evolutionspsychologisch zu erklären. Aber nicht nur der tradierte Pessimismus, sondern auch jede Art von degenerativer Krankheit werde digital überwunden werden, schon ab den 2030er Jahren durch die Nabots (s.o.) und durch medizinische Nanoro-boter. – Und in den 2040er Jahren werde für die meisten Menschen die Lebensverlängerung sogar in die Unsterblichkeit einmünden können (S. 154).
Armut und Gewalt würden drastisch zurückgehen, die Einkommen überall schnell merklich zunehmen. In der Landwirtschaft werde es ganz neue, umweltfreundliche Methoden geben, flankiert von immer mehr Erneuerbarer Energie, besserem Hausbau, neuen 3D-Druckverfah-ren usw.
Über die Zukunft der Arbeitsplätze brauche man sich keine Sorgen zu machen. Einige, wie z.B. diejenigen von Versicherungsvertretern und Steuerbeamten, würden zwar vollständig automatisiert und somit wegfallen. Trotzdem werde die Gesamtzahl der Arbeitsplätze zuneh-men, die Arbeitszeiten geringer, die Entlohnung überall viel besser werden, gestützt durch Bildungs- und Gesundheits-Revolution.
Dennoch verschließt Kurzweil nicht die Augen vor möglichen Bedrohungen und Gefahren. Das Schlusskapitel seines Buches nennt er „Gefahr“ (S. 305-326). Speziell zu den Atomwaf-fen: „KI kann das Risiko eines Atomkriegs zwar nicht beseitigen, doch können intelligentere Befehls- und Kontrollsysteme das Risiko von Sensorfehlfunktionen, die zum unbeabsichtigten Einsatz der schrecklichen Waffen führen würden, erheblich verringern.“ (S. 309) Und in Bezug auf superintelligente KI benennt Kurzweil drei Gefahren:
1. Missbrauch, z.B. durch Terroristen,
2. „Äußere Fehlausrichtung“: Programmierer schätzen die – zunehmend autonome – KI zuweilen falsch ein.
3. „Innere Fehlausrichtung“: Es entsteht eine Diskrepanz zwischen dem von KI-Robotern „Erlernten“ und ihrem tatsächlichen Verhalten in der Praxis.
Gegen alle diese Gefahren könne man sich aber durch die KI selbst wappnen, auch wenn man nie in der Lage sein werde, „die meisten von superintelligenter KI getroffenen Entschei-dungen ganz zu verstehen“ (S. 323). Dennoch lautet Kurzweils Schlusswort:
„Insgesamt sollten wir vorsichtig optimistisch sein. KI bringt zwar neue technische Bedrohungen hervor, wird aber auch unsere Fähigkeit, mit diesen Bedrohungen umzu-gehen, radikal verbessern. Und was den Missbrauch betrifft: Da KI uns unabhängig von unseren Werten intelligenter macht, kann sie sowohl für gute als auch für böse Zwecke eingesetzt werden. … Wir sollten daher auf eine Welt hinarbeiten, in der das, was KI leisten kann, weitverbreitet ist, sodass ihre Auswirkungen die Werte der gesamten Menschheit widerspiegeln.“ (S. 326)
Kritische Anmerkungen
In seinem Schlusswort (s.o.) leitet Kurzweil aus den auch bei KI bestehenden Möglichkeiten sowohl zum Guten als auch zum Bösen die Notwendigkeit einer allgemein-verbindlichen Ethik ab. Diese Forderung ist durchaus nachvollziehbar; es stellt sich aber die Frage, ob die von Kurzweil abgeleitete Notwendigkeit evtl. wissenschaftlich begründet werden kann.
Nicht nachvollziehbar dürfte jedenfalls Kurzweils Panpsychismus sein, die Behauptung, es gebe ein überall anzutreffendes, „universelles Bewusstsein“, so dass das menschliche Bewusstsein seine Sonderstellung verlöre. Wissenschaftlich nachprüfbar ist diese Behauptung jedoch bisher anscheinend nicht. Für präzisierungsbedürftig halte ich außerdem Kurzweils Bestimmungen des menschlichen subjektiven Bewusstseins. Die gehirnlichen Grundlagen der Eigenschaften und Fähigkeiten des Bewusstseins sind bisher noch nicht vollständig erforscht. Bekannt ist allerdings die Tatsache, dass die neuronale Kombinatorik des Gehirns unendlich, unüberschaubar und mathematisch nicht erfassbar ist. Jeglicher Vergleich zwischen natür-licher und künstlicher Intelligenz wird dadurch zu einem Va-banque-Spiel. Dies erst recht, wenn man wie Kurzweil davon ausgeht, dass die Komplexität der KI zwar mathematisierbar, aber letztlich dennoch nicht ganz verstehbar sei. Wie sollen dann die mit KI verbundenen Gefahren überhaupt erkennbar sein? Und: Warum sollte eine Ethik zur Abwendung solcher Gefahren überhaupt notwendig sein, wenn der Mensch ohnehin in der „Singularität“ des Jahres 2045 zu Gunsten des „Computroniums“, der „Materie mit höchstmöglicher Rechen-dichte“, verschwinden oder aber einer höchst fragwürdigen, abenteuerlich anmutenden „Unsterblichkeit“ teilhaftig werden wird. - Im Übrigen hat Kurzweil anscheinend keines seiner vor 2024 vorgetragenen Argumente revidiert; so dass ich an meiner Kritik vollumfänglich festhalten muss:
Transhumanismus geht über das bisherige Mensch-Sein hinaus; Posthumanismus setzt an beim „Ende der Menschheit“. Kurzweil vereinigt beide Richtungen in seinen Ideen, wobei er allerdings nicht nur gewichtige Fakten außer Acht lässt; es unterlaufen ihm auch mehrere Denkfehler. Die Fakten: Der menschliche Geist besteht nicht nur aus Mustererkennern in der Großhirnrinde. Vielmehr sind deren Funktionen untrennbar mit der Tätigkeit des gesamten Gehirns verbunden. Diese Tätigkeit – und mit ihr die gesamte neuronale Kombinatorik – ist jedoch weder gänzlich überschaubar noch vollständig erforscht noch mathematisch erfassbar.[40 ] Es handelt sich um eine durchweg kreative, zu neuen Erkenntnissen befähigende Tätigkeit, die zwar auf Mustererkennung angewiesen ist, aber weit über diese hinausgeht.
Unerfüllt – und wahrscheinlich sogar dauernd unerfüllbar – bleibt folglich eine Grundvor-aussetzung für die technische Modellierbarkeit des menschlichen Gehirns. Was erst recht für den Geist, das Bewusstsein und die Psyche des Menschen gilt, weil diese sich als umfassendes Subjekt-Objekt-Geschehen manifestieren und sich keineswegs in der Gehirn-tätigkeit erschöpfen.
Außerdem übersieht Kurzweil die Tatsache, dass das Erkennen von Mustern nicht unmit-telbar, sondern durch sprachliche und nicht-sprachliche Bedeutungen vermittelt geschieht, d.h. mittels semantischer, syntaktischer, assoziativer und gefühlsmäßiger Zuordnungen. Auch diese sind letztlich unüberschaubar, zumal sprachliche Bedeutungen nicht nur in Form von Denotationen (Grundbedeutungen) und Konnotationen (Nebenbedeutungen) auftreten, son-dern auch in rein individuellen, subjektiven Assoziations-Bedeutungen, die für jegliche Phantasie, Kreativität und Entscheidungstätigkeit maßgeblich sind. Anders ausgedrückt: Kurzweils KI-Konzept ist nicht nur fehlerhaft, sondern auch nicht anwendbar. Geist, Bewusstsein und Psyche des Menschen, stets eng verbunden mit seiner Gefühlswelt, sind technisch weder modellierbar noch reproduzierbar.
Würden die transhumanistischen Anmaßungen Realität, wäre uns Menschen der Zugang zu einem möglichen Reich der Freiheit für immer verwehrt. Die Menschheit müsste abdanken, sich selbst aufgeben, und zwar auch dann, wenn, wie es dem ebenfalls transhumanistisch eingestellten Hans Moravec vorschwebt, lediglich Roboter als superintelligente Arbeits-sklaven hergestellt würden; denn auch diese könnten ja eines Tages ihre Superintelligenz zur Vernichtung der Menschheit einsetzen.
Um solch fatalen Entwicklungen vorzubeugen, sind wahrscheinlich schon jetzt gesetz-geberische Gegenmaßnahmen erforderlich. Langfristig wird, wie ich meine, eine gesamt-gesellschaftliche Kontrolle über die Schlüsselindustrien (natürlich einschließlich der IT-Branche) unumgänglich sein. Indiskutabel ist dagegen jeder Versuch, den Menschen zur Selbstaufgabe zu zwingen. Wer den Menschen abschaffen will, beraubt sich selbst seiner Menschenwürde. Personalität geht in dem Maße verloren, wie man die aus Geist, Psyche und Körper-Materie bestehende Einheit des Menschen zerstört, um sie schließlich auf technisch manipulierte anorganische Materie zu reduzieren. Jeder derartige Versuch verschärft die vorherrschende Konkurrenz-Situation, in der die Menschen dieser Erde sich befinden.
Je mehr Zulauf der Transhumanismus gewinnt, desto alarmierender wird die Lage. Daher zitiere ich die folgende
>Transhumanismus Kritik:
"Den Menschen zu verbessern" ist ein uralter Menschheitstraum. Die "Schaffung des neuen Menschen" führte in der Geschichte immer wieder zu Katastrophen und auch nach Auschwitz. Mit Hilfe von Technikoptimismus, libertärem und neoliberalem Denken, Gentechnik, Nanotechnologie, Eugenik und Computern den „alten Menschen“ abschaffen und einen „neuen Menschen“ schaffen. Mit Gehirnimplantaten und Gendoping soll der Mensch "optimiert" werden. Das Klonen von menschlichen Embryonen und die Möglichkeit, aus geklonten Embryonen Stammzellen zu gewinnen, bringt die Transhumanisten ihrem gefährlichen Traum vom ewigen Leben einen großen Schritt näher. Immer mehr Menschen verstehen sich selbst als Teil der transhumanistischen Bewegung, die den Menschen von seinen biologischen Schranken befreien will. Der Transhumanismus wird zunehmend zur neuen, gefährlichen Weltreligion der Umweltzerstörung und des Neoliberalismus. Die Umweltbewegung sollte sich stärker mit dieser zutiefst inhumanen Ideologie auseinan-dersetzen. (Axel Mayer, BUND-Geschäftsführer, Vizepräsident TRAS und Kreisrat, in: www.bund-rvso.de/transhumanismus.html)
Jedenfalls werden die Menschen sich ihr Streben nach Glück, besserem Leben und dem Reich der Freiheit nicht von Trans- und Posthumanisten vergällen lassen.[41]
Zusammenfassung. Tabellarische Gegenüberstellung der Konzepte von Hegel und Kurzweil
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Hegels „Aufstieg zum Absoluten“ ist ebenso hinfällig wie Kurzweils Konstrukt von „unsterb- lichen, gottähnlichen Wesen“, die in der „Singularität“ des Jahres 2045 die Menschen erset-zen sollen. Auch superintelligente Roboter sind keine menschlichen Subjekte. Roboter werden von Menschen programmiert; der menschliche Geist ist „naturwüchsig“, d.h. evolutionsgeschichtlich entstanden. Da Roboter keine Subjekte sind, fehlen ihnen entschei-dende Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins, d.h. auch der Vernunft und des Geistes mit dessen dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen. Die Intelligenz-Leistungen von Men-schen und Robotern sind daher nicht vergleichbar. Es fehlt die Vergleichs-Instanz, das tertium comparationis. – Stattdessen ist die Neubegründung eines naturalistischen Humanismus er-forderlich, wie ich sie in meiner Arbeit über ‚Vom Humanismus zum Trans- und Posthuma-nismus im KI-Zeitalter?‘ (München 2024, https://www.grin.com/document/1570033 ) vorge-schlagen habe.
Literaturhinweise
Beierlein, Hannes 2014: “Ist künstliche Intelligenz schon im Jahre 2045 möglich?“ www.cancom.info/2014/12/ist-künstliche...
Beuth, Patrick 2013: „Google Glass. Die Anti-Cyborgs“, www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-03/stop-the-cyborgs-google-glass/komplettansicht
Bloch, Ernst 1962: Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel, Frankfurt a.M.
Bloch, Ernst 1977: Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde., Frankfurt a.M.
Carmele, Alexander 2022: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: „Das unglückliche Bewusstsein“, in: https://kommunikativeslesen.com>2022/10/15>geor...
Goleman, Daniel 1997 (1995): Emotionale Intelligenz, München
Hegel, G.W.F. 1970 (1817): Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III, Frankfurt a.M.
Hegel, G.W.F. 1976 (1807): Phänomenologie des Geistes, Frankfurt a.M.
Kurzweil, Ray 2005: The Singularity is Near, London
Kurzweil, Ray 2014: Das Geheimnis des menschlichen Denkens. Einblicke in das Reverse Engineering des Gehirns, Berlin
Kurzweil, Ray 2024: Die nächste Stufe der Evolution. Wenn Mensch und Maschine eins werden. München
Marx, Karl 1964: Die Frühschriften, Stuttgart
Robra, Klaus 2017: Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demokratischen Öko-Sozialismus, München, https://www.grin.com/de/e-book/375344/person-und-materie-vom-pragmatismus-zum-demokratischen-oeko-sozialismus
Robra, Klaus 2023: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Möglichkeiten und Gefahren, München, https://www.grin.com/document/1383067
Robra, Klaus o.J.: Hegels System: Welterklärung oder Mystifikation? mit Antworten seiner Kritiker und Kritikerinnen, München, https://www.grin.com/document/1490033
Robra, Klaus o.J. a): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus 2024: Bewusstseins-Philosophie. Eine Übersicht, München, https://www.grin.https://www.grin.com/document/1472343
Robra, Klaus 2024 a): Vom Humanismus zum Trans- und Posthumanismus im KI-Zeitalter? München, https://www.grin.com/document/1570033 )
Transhumanismus, https://www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-die-menschheit
Weisbuch, Gérard 1989: Dynamique des systèmes complexes, Paris
Wikipedia 2016: „Das Geheimnis des menschlichen Denkens“
[...]
1 Simanowski in: https://www.deutschlandfunkkultur.de/hegel–und–kuenstliche–intelligenz–der_mensch_erschafft_100.html
2 Kurzweil in: Transhumanismus S. 8 (s. Literaturverzeichnis!)
3 Aristoteles in: Hegel 1970 (1817), S. 395
4 Hegel 1970, S. 394
5 Hegel 1976, S. 591
6 In: Bloch 1962, S. 79 ff.
7 Hegel 1976, S. 88
8 Bloch in: Bloch Wörterbuch, Berlin 2012, S. 53
9 Hegel 1976, S. 85
10 Hegel 1970, S. 211
11 Hegel 1976, S. 144
12 Hegel in: Wissenschaft der Logik II, Frankfurt a.M. 1986 (1813), S. 266
13 Hegel 1976, S. 311
14 Bloch 1962, S. 89
15 Hegel 1970, S. 254
16 Hegel 1976, S. 575-591
17 Hegel in: Wissenschaft der Logik II, Frankfurt a.M. 1986 (1813), S. 187
18 Vgl. Robra o. J. S. 127 f.
19 In: https://emotioncompass.org/de/information/emotions-and-the-body/
20 In: https://sciodoo.de/wahrnehmung-empfindung-unterschiede-zur-reizaufnahme-und-verarbeitung/
21 In: https://www.wie-funktioniert.com/drei-stufen-der-wahrnehmung/
22 In: https://www.verstand.info/
23 In: Bloch 1962, S. 85
24 In: https://philosophie-neu.de/zur-kritik-an-hegel-2/#_Toc119512642
25 B. Libet in: Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt a.M. 2005, S. 246
26 Studie: Unser Wille ist freier als gedacht (2015), https://www.derstandard.at/story/ 2000011387060/studie-unser-wille… , S. 1
27 Vgl. Robra 2024, S. 29
28 Zu den Themen Sprache, Erkenntnis, Verstehen und Verständigung s. auch Robra 2017, S. 95-108
29 Vgl. Walter Schulz: Wittgenstein – Die Negation der Philosophie, Pfullingen 1979, S. 114. Ferner: Robra o.J. a), S. 255 f.
30 Vgl. Das Geheimnis des „Aha-Moments“, in: www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/das-geheimnis-des-aha-moments. Ferner: Vgl. Robra o.J. a), S. 257 f.
31 In: Marx 1964, S. 271-273
32 Vgl. Bloch 1977, S. 805, 813
33 In: https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/neuronale-netzwerke-oder-wie-funktioniert-das-gehirn/
34 In: https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/kuenstliche-intelligenz/ . Besonders zu vermerken sind die Erfolge, die neuerdings mit KI-Suchmaschinen wie ‚Microsoft-Copilot‘ und ‚Perplexity AI‘ erzielt worden sind; vgl. Robra 2024 a), S. 164.
35 Transhumanismus S. 8 (s. Literaturverzeichnis!)
36 Beuth 2013, S. 1
37 Vgl. Wikipedia 2016, S. 1-2, sowie Kurzweil 2014, S. 35-74
38 Kurzweil 2005, S. 487
39 Vgl. Robra 2023, S. 18-22
40 vgl. Weisbuch 1989, S. 193
41 Vgl. Robra 2017, S. 129 ff.
- Arbeit zitieren
- Klaus Robra (Autor:in), 2025, Die KI und das Absolute, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1577331