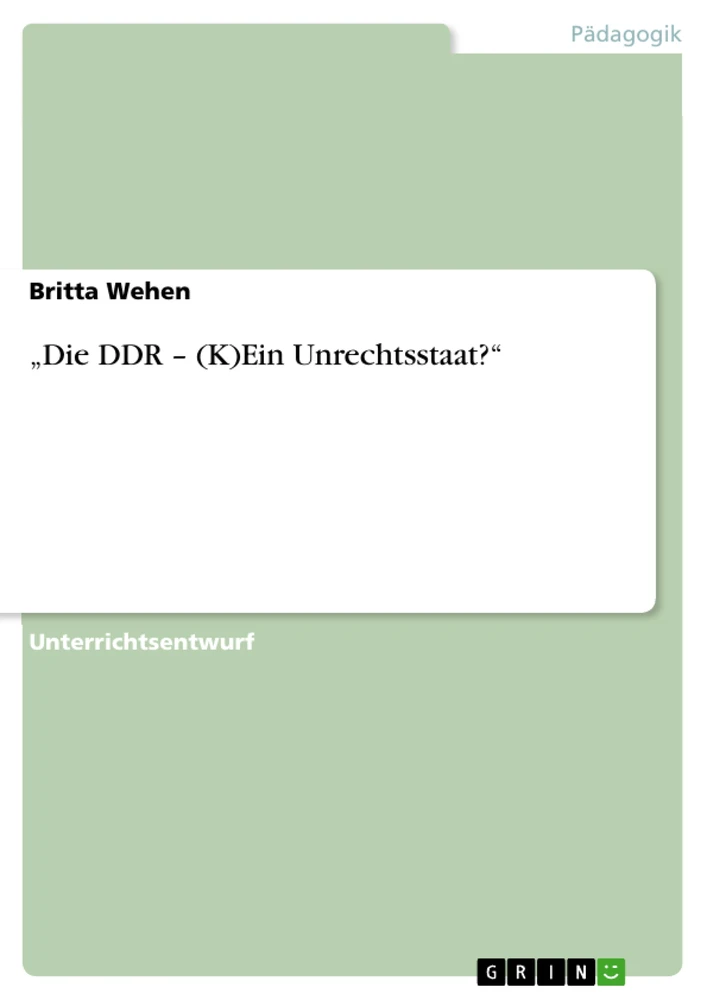1. Sachanalyse
„Die DDR wird heute sehr schnell global und undifferenziert als Unrechtsstaat bezeichnet. Doch entspricht dies keineswegs der durchgängigen Erfahrung der ge-lernten DDR-Bürger […] Daß in der DDR Unrecht geschehen ist, wird niemand bezweifeln. Aber das reicht nicht aus, diesen Staat zu charakterisieren. Wer wollte unterstellen, daß es in der ehemaligen Bundesrepublik kein Unrecht gegeben hätte? Ab wieviel Unrecht ist ein Staat ein Unrechtsstaat?“
Mit diesem Zitat ist bereits die Problemstellung verdeutlicht, die in der vorliegenden Unter-richtseinheit behandelt werden soll: Kann die ehemalige DDR als Unrechtsstaat bezeichnet werden?
Im vorangegangenen Jahr keimte eine Debatte auf, die bereits Mitte der 1990er-Jahre geführt wurde: Die Frage nach dem Charakter des DDR-Staates. Anlass war eine Äußerung des Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin Sellering. Der Politiker hatte im März 2009 behauptet, die DDR sei „kein totaler Unrechtsstaat“ gewesen. In den folgenden Wo-chen entwickelte sich eine öffentlich ausgetragene Debatte, in die sich unter anderem Marian-ne Birthler (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-gen Deutschen Demokratischen Republik), Gesine Schwan (SPD Bundespräsidentschaftskandidatin), Matthias Platzeck (Brandenburgs Ministerpräsident) sowie Christian Wulff, Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier einschalteten.
Die Debatte entzündete sich jedoch hauptsächlich an der Wortwahl, Gesine Schwan drückte es so aus, dass die Bezeichnung „Unrechtsstaat“ unrechtmäßig sei, da diese impliziere, „dass alles unrecht war, was in diesem Staat geschehen ist.“ Bereits 1995 wies Prof. Dr. Horst Sendler, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts a.D., darauf hin, dass dies eine unzutreffende Konsequenz sei, die immer wieder aus dieser Kennzeichnung abgeleitet werde. Daher soll die öffentlichkeitswirksame Kontroverse auch lediglich als Ausgangspunkt genommen werden, um sich der bedeutsameren Frage – nämlich der nach dem Charakter des ehemaligen ostdeutschen Staates – zuzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Sachanalyse
- 2. Didaktische Überlegungen
- 2.1 Didaktische Begründung
- 2.2 Bezug zum Kerncurriculum
- 2.3 Einbindung in den Unterricht und Lernvoraussetzungen
- 2.4 Lernziele
- 2.5 Schwerpunktsetzungen
- 3. Überlegungen zur Methodik und zum Medieneinsatz
- 4. Überblick über die Unterrichtseinheit
- 5. Überblick über die Einzelstunden
- 6. Leistungskontrolle
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf befasst sich mit der Frage, ob die DDR als Unrechtsstaat bezeichnet werden kann. Die zentrale Zielsetzung ist es, den Schülern ein differenziertes Verständnis des DDR-Staates zu vermitteln, indem sie unterschiedliche Perspektiven und Argumentationen zur Debatte um den Charakter des ehemaligen ostdeutschen Staates kennenlernen. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Problematik der Kennzeichnung als „Unrechtsstaat“ reflektieren und die komplexen Aspekte der DDR-Gesellschaft und des DDR-Staates in ihren historischen Kontext einordnen.
- Der Charakter des DDR-Staates und die Debatte um die Bezeichnung als "Unrechtsstaat"
- Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in der DDR
- Die SED-Herrschaft und ihre Machtinstrumente
- Die Rolle der Stasi und die Unterdrückung von Opposition
- Das Leben in der DDR aus unterschiedlichen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die Sachanalyse beleuchtet die Debatte um den Charakter der DDR und die Frage, ob sie als Unrechtsstaat bezeichnet werden kann. Sie beleuchtet die wesentlichen Merkmale eines Rechtsstaates und zeigt, wie die DDR von diesen Prinzipien abwich. Die Kapitel 2 bis 6 befassen sich mit didaktischen Überlegungen, der Methodik und dem Medieneinsatz, dem Überblick über die Unterrichtseinheit, den Einzelstunden und der Leistungskontrolle.
Schlüsselwörter
Rechtsstaat, Unrechtsstaat, DDR, SED, Staatssicherheit (Stasi), Menschenrechte, Gewaltenteilung, Unterdrückung, Zensur, Nischengesellschaft, öffentliche Debatte.
Häufig gestellte Fragen
Kann die DDR pauschal als "Unrechtsstaat" bezeichnet werden?
Die Bezeichnung ist umstritten. Während sie das systematische politische Unrecht betont, kritisieren manche, dass sie die Alltagserfahrungen der Bürger und funktionierende Teilbereiche des Staates ausblende.
Was sind die Merkmale eines Rechtsstaates, die in der DDR fehlten?
Dazu gehören die Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz, die Achtung der Menschenrechte und der Schutz vor willkürlicher Verfolgung durch Machtinstrumente wie die Stasi.
Welche Rolle spielte die Stasi in der DDR-Gesellschaft?
Das Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) diente als "Schild und Schwert" der SED-Partei zur Überwachung der Bevölkerung und Unterdrückung jeglicher Opposition.
Warum entzündete sich die Debatte an der Äußerung von Erwin Sellering?
Sellering behauptete, die DDR sei kein "totaler Unrechtsstaat" gewesen, was eine bundesweite Kontroverse über die Bewertung der SED-Diktatur und den Begriff "Unrechtsstaat" auslöste.
Was ist das Ziel der Unterrichtseinheit zu diesem Thema?
Schüler sollen ein differenziertes Verständnis des DDR-Staates entwickeln und lernen, historische Urteile über den Charakter einer Diktatur kriteriengeleitet zu fällen.
- Quote paper
- Britta Wehen (Author), 2010, „Die DDR – (K)Ein Unrechtsstaat?“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/156475