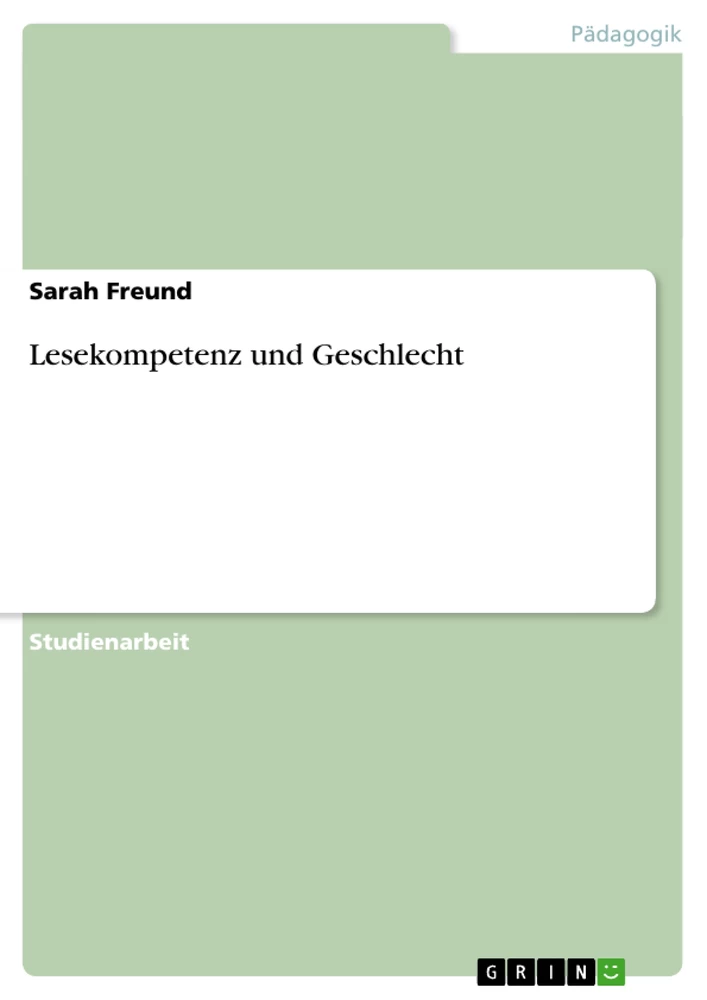1. Einleitung
Schon seit mehreren Jahren steht das Schlagwort „Mädchenförderung“ für ein pädagogisches Programm, das in aller Munde ist. In der Schule und durch Freizeitangebote sollen Mädchen ihre spezifischen Kompetenzen erkennen und nutzen lernen sowie Selbstbewusstsein aufbauen. Schwächen sollen durch vielerlei pädagogische Maßnahmen kompensiert werden, Schulen bieten beispielsweise Computerkurse und Arbeitsgemeinschaften nur für Mädchen an. Doch stellt sich die Frage, ob Jungen nicht auch einer speziellen Förderung bedürfen. Werden ihre spezifischen Schwächen vielleicht zu wenig berücksichtigt? Die Ergebnisse der PISA- Studie zeigen neben vielen Stärken auch deutliche Schwächen der Jungen auf: Vor allem im Bereich Lesekompetenz gibt es dringenden Handlungsbedarf. Gibt es hier vielleicht die Notwendigkeit, eine spezielle Jungenförderung ins Leben zu rufen? In dieser Arbeit soll folgender Fragestellung nachgegangen werden: Wie lassen sich die in PISA festgestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lesekompetenz erklären? Anhand dieser Fragestellung wird am Ende dieser Arbeit eine Einschätzung abgegeben, ob eine spezielle Jungenförderung wirklich notwendig ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die inhaltliche Bedeutung von Lesekompetenz
- 3. Die Funktionen von Lesekompetenz
- 4. Internationale Ergebnisse der PISA-Studie zu Geschlechterunterschieden im Bereich der Lesekompetenz
- 5. Erklärungen für die unterschiedlichen Lesekompetenzleistungen von Jungen und Mädchen
- 5.1 Theoretische Erklärungsansätze zum Leseverhalten der Geschlechter
- 5.2 Lesegewohnheiten und motivationale Merkmale der Geschlechter
- 5.3 Lesesozialisation in der Familie
- 5.4 Lesesozialisation in der Schule
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lesekompetenz, wie sie in der PISA-Studie aufgezeigt werden. Ziel ist es, die Ursachen dieser Unterschiede zu erklären und zu beurteilen, ob eine spezielle Jungenförderung notwendig ist.
- Definition und Bedeutung von Lesekompetenz
- Funktionen von Lesekompetenz in der Wissensgesellschaft
- Ergebnisse der PISA-Studie zu Geschlechterunterschieden in der Lesekompetenz
- Theoretische Erklärungsansätze für geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten
- Einfluss von Familie und Schule auf die Lesesozialisation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung vor: Während Mädchenförderung im Fokus steht, werden die Schwächen von Jungen, insbesondere im Bereich der Lesekompetenz, oftmals vernachlässigt. Die Arbeit untersucht die in der PISA-Studie festgestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede und prüft die Notwendigkeit einer speziellen Jungenförderung.
2. Die inhaltliche Bedeutung von Lesekompetenz: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der Lesekompetenz, berücksichtigt dabei die Definition der PISA-Studie und weitere Definitionen aus einschlägiger Literatur, beispielsweise aus dem Handbuch "Lesen - Ein Handbuch", sowie Überlegungen von Ulrich Saxer. Es wird eine umfassende und differenzierte Betrachtung des Begriffs vorgenommen, um eine solide Grundlage für die weiteren Kapitel zu schaffen.
3. Die Funktionen von Lesekompetenz: Dieser Abschnitt beleuchtet die zentrale Rolle des Lesens in der heutigen Wissensgesellschaft. Es werden die Konsequenzen eines Mangels an Lesekompetenz aufgezeigt und die Bedeutung von Lesekompetenz für den individuellen Erfolg und die gesellschaftliche Teilhabe herausgestellt. Der Fokus liegt darauf, die Relevanz der Thematik zu verdeutlichen und den Kontext für die Analyse der PISA-Ergebnisse zu setzen.
4. Internationale Ergebnisse der PISA-Studie zu Geschlechterunterschieden im Bereich der Lesekompetenz: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der internationalen PISA-Studie, mit besonderem Augenmerk auf die Geschlechterunterschiede in der Lesekompetenz. Es werden die signifikanten Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen detailliert dargestellt und analysiert. Der hohe Anteil von Jungen in der Risikogruppe (die Kompetenzstufe I nicht erreichen) wird hervorgehoben und bildet die Grundlage für die weitere Untersuchung der Ursachen.
5. Erklärungen für die unterschiedlichen Lesekompetenzleistungen von Jungen und Mädchen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Erklärungsmöglichkeiten für die in Kapitel 4 dargestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede. Es werden verschiedene Erklärungsansätze aus der wissenschaftlichen Forschung präsentiert und kritisch bewertet, inklusive der Betrachtung von Lesegewohnheiten, motivationalen Merkmalen sowie des Einflusses von Familie und Schule auf die Lesesozialisation. Die Interdependenz der verschiedenen Faktoren wird betont, um monokausale Erklärungen zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, PISA-Studie, Geschlechterunterschiede, Jungenförderung, Lesesozialisation, Familie, Schule, Lesegewohnheiten, Motivation, wissenschaftliche Erklärungsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Lesekompetenz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Lesekompetenz, wie sie in der PISA-Studie aufgezeigt werden. Das Hauptziel ist es, die Ursachen dieser Unterschiede zu erklären und zu beurteilen, ob eine spezielle Jungenförderung notwendig ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Bedeutung von Lesekompetenz, Funktionen von Lesekompetenz in der Wissensgesellschaft, Ergebnisse der PISA-Studie zu Geschlechterunterschieden in der Lesekompetenz, theoretische Erklärungsansätze für geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten, und den Einfluss von Familie und Schule auf die Lesesozialisation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, inhaltliche Bedeutung von Lesekompetenz, Funktionen von Lesekompetenz, internationale Ergebnisse der PISA-Studie zu Geschlechterunterschieden, Erklärungen für die unterschiedlichen Lesekompetenzleistungen von Jungen und Mädchen und ein Fazit. Kapitel 5 ist weiter unterteilt in Unterkapitel zu theoretischen Erklärungsansätzen, Lesegewohnheiten und motivationalen Merkmalen, sowie Lesesozialisation in Familie und Schule.
Welche Ergebnisse der PISA-Studie werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die internationalen Ergebnisse der PISA-Studie, insbesondere auf die signifikanten Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen in der Lesekompetenz. Besonders hervorgehoben wird der hohe Anteil von Jungen in der Risikogruppe, die die Kompetenzstufe I nicht erreichen.
Welche Erklärungsansätze für die Unterschiede werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und bewertet kritisch verschiedene Erklärungsansätze aus der wissenschaftlichen Forschung. Berücksichtigt werden Lesegewohnheiten, motivationale Merkmale sowie der Einfluss von Familie und Schule auf die Lesesozialisation. Es wird betont, dass die verschiedenen Faktoren miteinander verwoben sind und monokausale Erklärungen vermieden werden sollten.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im sechsten Kapitel präsentiert und fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen. Es wird bewertet, ob die Ergebnisse der Untersuchung die Notwendigkeit einer speziellen Jungenförderung belegen.
Welche Definition von Lesekompetenz wird verwendet?
Die Arbeit analysiert den Begriff der Lesekompetenz umfassend. Sie berücksichtigt dabei die Definition der PISA-Studie und weitere Definitionen aus einschlägiger Literatur, beispielsweise aus dem Handbuch "Lesen - Ein Handbuch", sowie Überlegungen von Ulrich Saxer.
Welche Rolle spielen Familie und Schule?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Familie und Schule auf die Lesesozialisation und wie diese den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Lesekompetenz beitragen können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lesekompetenz, PISA-Studie, Geschlechterunterschiede, Jungenförderung, Lesesozialisation, Familie, Schule, Lesegewohnheiten, Motivation, wissenschaftliche Erklärungsansätze.
- Quote paper
- Sarah Freund (Author), 2003, Lesekompetenz und Geschlecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/15572