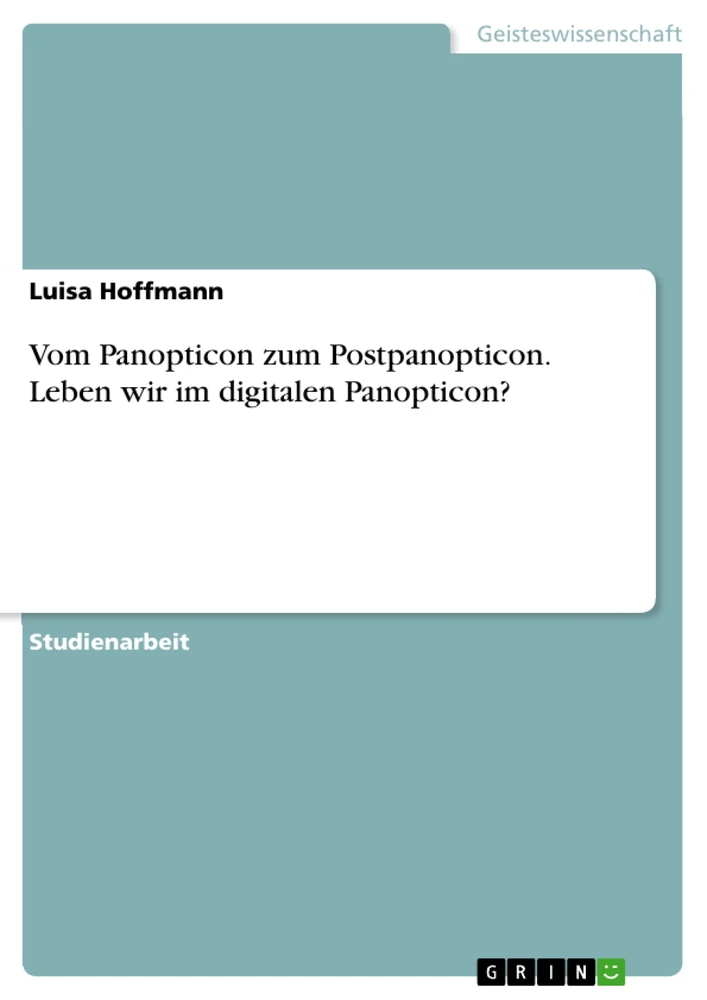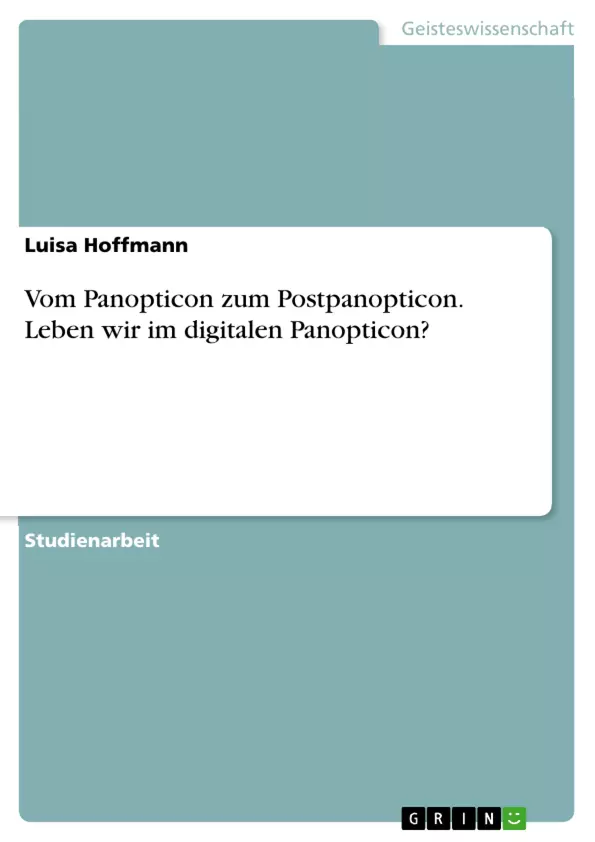Die Debatte um das Panopticon in unserer heutigen Gesellschaft flammt immer wieder auf. Digitalisierung ist dabei das Schlagwort. Es geht um den gläsernen Menschen in der digitalen Welt. Die Meinungen über die Existenz eines digitalen
Panopticons gehen dabei weit auseinander. Der eine sieht in der digitalen Welt einen weiteren Schritt in Richtung Demokratie, der andere fühlt sich ständig gesehen, überwacht und damit im digitalen Panopticon. Der eine sieht im Netz die ganze Meinungsvielfalt, der andere sieht Zensur (insbesondere seit Corona).
Ebenso verhält es sich mit der Macht. Der eine sieht durch die virtuelle Welt die Macht gleichmäßig verteilt, hingegen der andere die eine Macht dahinter sieht. Der eine bewegt sich gerne auf Social Media, der andere fühlt sich dazu genötigt.
Interessant hierbei ist, dass sich die unterschiedlichen Meinungen mit Foucaults ‚Überwachen und Strafen‘ begründen lassen. Je nach Meinung bietet das Werk Möglichkeiten zur Auslegung und Untermauerung des jeweiligen Standpunktes.
Eine mögliche Perspektive auf die Frage, ob wir im digitalen Panopticon leben, bietet diese Arbeit. Eine 1:1 Übertragung wird nicht zu erwarten sein, da die panoptische Idee und die Darlegungen Foucaults noch vor der digitalen Welt entstanden sind. Es wird vielmehr deutlich, dass die Funktionsweisen teils stark differieren.
Um zu klären, inwieweit sich das panoptische Modell der Disziplinarmacht auf die digitale Welt übertragen lässt, wird zunächst der Begriff ‚Macht‘ erläutert. Ob nun Disziplinarmacht, die das Wort schon in sich trägt, oder Macht durch Daten – es geht um Macht. Macht und Wissen gehören untrennbar zusammen.
Im dritten Kapitel werden dann die Disziplinarmacht mit dem Panopticon, ihre Funktionsweise und das von Foucault herausgearbeitete panoptische Schema erläutert. Dabei wird deutlich, welches Wissen generiert wird und auf welche Weise. Im vierten Kapitel wird die Funktionsweise der digitalen Welt beleuchtet, um dann schlussendlich den Vergleich ziehen zu können: Leben wir im digitalen Panopticon?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Macht
- Von der Souveränitätsmacht zur Disziplinarmacht
- Das Panopticon
- Das panoptische Schema
- Leben wir im digitalen Panopticon?
- Das Funktionieren der digitalen Welt
- Big Data und Social Media im Vergleich zum Panopticon
- Leben wir im digitalen Panopticon - im Postpanopticon?
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übertragbarkeit des panoptischen Modells der Disziplinarmacht auf die digitale Welt. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage, ob und inwiefern wir in einem digitalen Panopticon leben, ausgehend von Foucaults Werk „Überwachen und Strafen“. Dabei werden die Funktionsweisen des digitalen Raums im Vergleich zum klassischen Panopticon analysiert und kritisch hinterfragt.
- Der Machtbegriff nach Foucault und Byung-Chul Han
- Das Panopticon als Modell der Disziplinarmacht
- Der Vergleich zwischen dem klassischen und dem digitalen Panopticon
- Die Rolle von Big Data und Social Media
- Macht und Wissen in der digitalen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die kontroversen Meinungen zur Existenz eines digitalen Panopticons dar. Kapitel 2 befasst sich mit dem vielschichtigen Machtbegriff, insbesondere nach Foucault und Byung-Chul Han, und differenziert zwischen Macht durch Zwang und Macht durch Freiheit. Kapitel 3 erläutert die Disziplinarmacht und das Panopticon nach Foucault, inklusive des panoptischen Schemas und der damit verbundenen Wissensgenerierung. Kapitel 4 beleuchtet die Funktionsweise der digitalen Welt, um den Vergleich zum Panopticon im Hinblick auf Überwachung und Machtstrukturen vorzubereiten.
Schlüsselwörter
Panopticon, Postpanopticon, Digitale Überwachung, Macht, Disziplinarmacht, Foucault, Byung-Chul Han, Big Data, Social Media, Wissen, Überwachung und Strafen, digitale Welt.
- Quote paper
- Luisa Hoffmann (Author), 2024, Vom Panopticon zum Postpanopticon. Leben wir im digitalen Panopticon?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1516317