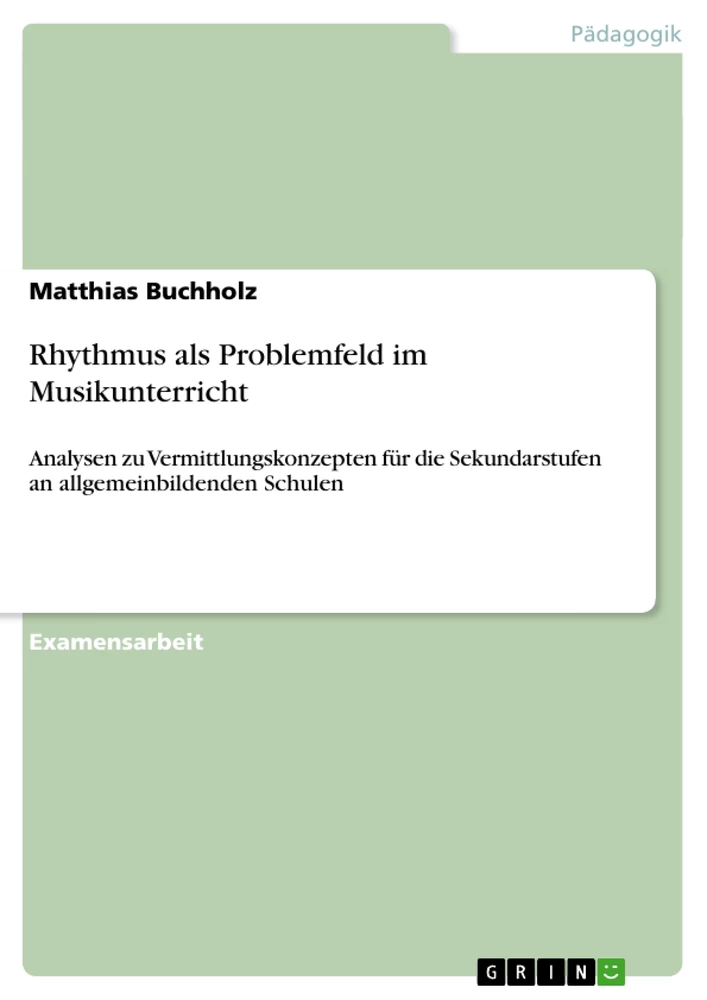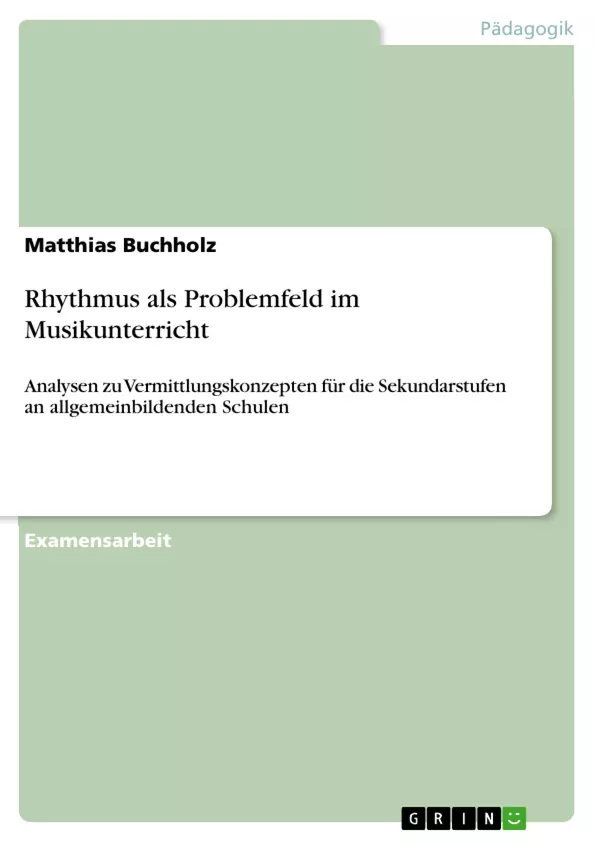Aus dem auf eigenen Erfahrungen (als Schüler, als Student der Schulmusik und als freiberuflicher Musiker) beruhenden Anspruch, Schülern Rhythmus und den Spaß daran in bestmöglichem Maße zu vermitteln, entstand das Ziel, herauszufinden, welche Aspekte in einem meinem Rhythmusbild gerecht werdenden Vermittlungsprozess von Bedeutung sind. Dafür ist es zunächst unerlässlich, sich auf theoretischer Ebene ausführlich mit dem Rhythmus auseinanderzusetzen. Aus meiner Beobachtung heraus kann und möchte ich Rhythmus als ein Phänomen bezeichnen, und anhand eines in seinen Blickwinkeln vielschichtigen Analyseprozesses werden verschiedene Erscheinungsformen dessen betrachtet und ergründet. Der Ansatz meines Vorgehens bezieht sich auf die Tatsache, dass die Felder Rhythmus, Musik und Mensch eng miteinander verknüpft sind. Ich möchte versuchen, den Rhythmus zu erschließen, indem ich ihn zunächst in seinen Wechselbeziehungen zum Menschen und zur Musik betrachte bzw. untersuche, wie sich alle drei Felder gegenseitig bedingen. Der kulturelle Kontext und die Sicht der Musikpädagogik sind weitere Aspekte, die analysiert werden.
Sich an den theoretischen und musikdidaktischen Erkenntnissen orientierend wird dann der Transfer zu entsprechenden Unterrichtskonzepten vollzogen, die als Anleitung für die Vermittlung des Rhythmus in allgemeinbildenden Schulen geschrieben wurden. Ein Vergleich dieser Konzepte hinsichtlich auf den theoretischen Erkenntnissen aufbauender Kriterien bildet einen zweiten Hauptteil der Arbeit. Die übergeordneten Fragestellungen dieser Analyse weisen dabei in zwei Richtungen: Auf welche Weise spiegeln sich die inhaltlichen Schwerpunkte der theoretischen Analyse sowie aktuelle musikpädagogische Positionen in den vorliegenden Unterrichtskonzepten wieder, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus hinsichtlich der Sichtweise bzw. des rhythmischen Wissens und rhythmischer Kompetenzen, die die Schüler als Ergebnis des Lernprozesses erhalten?
Anhand der dabei gewonnenen Erkenntnisse werden inhaltliche und methodische Anforderungen ausgelotet, die an zeitgemäße rhythmische Vermittlungskonzepte gestellt werden müssen. Ich möchte mich selbst und andere Berufstätige im musikpädagogischen Feld in die Lage versetzen, den Musikunterricht im Fach Rhythmus didaktisch optimal aufbereiten zu können, und sehe den Gebrauchswert dieser Arbeit darüber hinaus auch in einer generellen Motivierung, sich der spannenden Welt des Rhythmus durchdacht und intensiv zu widmen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- 1. Rhythmus - Erfahrungen und persönliche Motivation
- 2. Zum Arbeitsinteresse
- B. Rhythmus – Dem Phänomen auf der Spur
- 1. Zur Definition von Rhythmus
- 2. Mensch und Rhythmus
- 2.1. Der Mensch als ursprünglich rhythmisches Wesen
- 2.1.1. Rhythmus ist Leben
- 2.2. Rhythmus und Bewegung
- 2.3. Rhythmus und Sprache
- 2.4. Rhythmus und Wirkung
- 3. Musik und Rhythmus
- 3.1. Metrum / Puls
- 3.2. Takt
- 3.3. Tempo
- 4. Musik und Rhythmus und Mensch
- 4.1. Die Urelemente Musik und Bewegung
- 4.2. Wirkungen von Musik und Rhythmus auf den Menschen
- 4.3. „Es groovt“!
- 4.3.1. Die strukturelle Dimension
- 4.3.2. Die soziale Dimension
- 5. Rhythmus und Kultur
- 5.1. Ein Beispiel: Der Rhythmus afrikanischer Musik
- 6. Rhythmus im musikpädagogischen Blickfeld
- 6.1. Die rhythmisch-musikalische Erziehung
- 6.2. Rhythmus in der zeitgenössischen Musikpädagogik
- 6.2.1. Das Problemfeld Schulmusik
- C. Rhythmus - Analyse von Unterrichtskonzepten
- 1. Rhythmus im Musikunterricht: Thesen
- 2. Bemerkungen zum Untersuchungsverfahren
- 2.1. Fragekomplexe zur Konzeptanalyse
- 2.2. Hypothesen
- 3. Vorstellung der ausgewählten Unterrichtskonzepte
- D. Darstellung der Untersuchungsergebnisse
- E. Auswertung der Ergebnisse
- F. Zusammenfassung
- G. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vermittlung von Rhythmus im Musikunterricht der Sekundarstufe an allgemeinbildenden Schulen. Ziel ist es, die bestehenden Konzepte zu analysieren und mögliche Gründe für ein vermeintlich fehlendes Rhythmusgefühl bei Schülern zu identifizieren. Die Arbeit basiert auf den persönlichen Erfahrungen des Autors als Musiker und Musiklehrer.
- Analyse der Rhythmusvermittlung im Musikunterricht
- Identifizierung von Stärken und Schwächen bestehender Unterrichtskonzepte
- Untersuchung des Einflusses von Rhythmus auf das Musikerleben
- Entwicklung von Vorschlägen zur Verbesserung des Rhythmusunterrichts
- Rhythmus als Lebenselixier der Musik
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Die Einleitung beschreibt die persönlichen Erfahrungen des Autors mit Rhythmus im Musikunterricht, sowohl als Schüler als auch als aktiver Musiker. Ein negativer Erlebnisbericht aus einem Praktikum kontrastiert mit den positiven Erfahrungen im Kontext von Band- und Orchesterarbeit. Der Autor verdeutlicht die Diskrepanz zwischen der oft trockenen und theoretischen Vermittlung im Unterricht und der lebendigen, emotionalen Erfahrung von Rhythmus in der Praxis. Dies begründet sein Forschungsinteresse und die zentrale These der Arbeit: Rhythmus ist nicht nur Notenlehre, sondern ein essentieller Bestandteil des musikalischen Gefühls und des Spaßes am Musizieren.
B. Rhythmus – Dem Phänomen auf der Spur: Dieses Kapitel beleuchtet den Rhythmus aus verschiedenen Perspektiven. Es beginnt mit einer Definition von Rhythmus und untersucht dessen Bedeutung für den Menschen in verschiedenen Kontexten: als fundamentales Element des Lebens, in Bewegung, Sprache und der Wirkung von Musik. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Metrum, Takt und Tempo in der Musik und wie diese Elemente gemeinsam das "Gefühl" von Rhythmus erschaffen. Abschließend wird der kulturelle Einfluss auf den Rhythmus, insbesondere an Beispiel afrikanischer Musik, betrachtet. Das Kapitel dient als umfassende Grundlage für die musikpädagogische Betrachtung im Folgekapitel.
C. Rhythmus - Analyse von Unterrichtskonzepten: Dieser Abschnitt analysiert verschiedene Unterrichtskonzepte zur Vermittlung von Rhythmus. Die Analyse konzentriert sich auf die didaktischen Ansätze, Methoden und Materialien der ausgewählten Konzepte. Es werden konkrete Beispiele aus Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien vorgestellt und kritisch evaluiert, um ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie effektiv diese Konzepte das Verständnis und die Freude am Rhythmus bei Schülern fördern. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Auswertung im späteren Teil der Arbeit.
Schlüsselwörter
Rhythmus, Musikunterricht, Sekundarstufe, Musikpädagogik, Rhythmusgefühl, Unterrichtskonzepte, Konzeptanalyse, Musikpraxis, Metrum, Takt, Tempo, afrikanische Musik, Schulmusik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Rhythmus im Musikunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vermittlung von Rhythmus im Musikunterricht der Sekundarstufe an allgemeinbildenden Schulen. Sie analysiert bestehende Unterrichtskonzepte und sucht nach Gründen für ein mögliches fehlendes Rhythmusgefühl bei Schülern. Die Arbeit basiert auf den persönlichen Erfahrungen des Autors als Musiker und Musiklehrer.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rhythmusvermittlung im Musikunterricht zu analysieren, Stärken und Schwächen bestehender Konzepte zu identifizieren, den Einfluss von Rhythmus auf das Musikerleben zu untersuchen und Vorschläge zur Verbesserung des Rhythmusunterrichts zu entwickeln. Ein zentrales Thema ist die Bedeutung von Rhythmus als „Lebenselixier der Musik“.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einführung mit persönlichen Erfahrungen des Autors, eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Phänomen Rhythmus (Definition, Bedeutung für den Menschen, in Musik und Kultur), eine Analyse ausgewählter Unterrichtskonzepte, die Darstellung und Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie eine Zusammenfassung. Ein besonderes Beispiel ist die Betrachtung afrikanischer Musik im Kontext von Rhythmus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die persönliche Motivation und den Forschungsfokus des Autors darlegt. Es folgt ein Kapitel, das den Rhythmus umfassend aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, von der Definition bis hin zu kulturellen Aspekten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Unterrichtskonzepten zur Rhythmusvermittlung. Die Arbeit schließt mit der Darstellung und Auswertung der Ergebnisse, gefolgt von einer Zusammenfassung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf der Analyse von Unterrichtskonzepten und Materialien basiert. Es werden konkrete Beispiele aus Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien vorgestellt und kritisch evaluiert. Die Analyse konzentriert sich auf didaktische Ansätze, Methoden und Materialien, um die Effektivität der Konzepte bei der Förderung des Verständnisses und der Freude am Rhythmus zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rhythmus, Musikunterricht, Sekundarstufe, Musikpädagogik, Rhythmusgefühl, Unterrichtskonzepte, Konzeptanalyse, Musikpraxis, Metrum, Takt, Tempo, afrikanische Musik, Schulmusik.
Welche konkreten Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Fragen wie: Wie wird Rhythmus im Musikunterricht vermittelt? Welche Stärken und Schwächen weisen bestehende Unterrichtskonzepte auf? Welchen Einfluss hat Rhythmus auf das Musikerleben? Wie kann der Rhythmusunterricht verbessert werden? Wie kann man das oft fehlende Rhythmusgefühl bei Schülern erklären?
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit können hier nicht vollständig wiedergegeben werden, da sie den detaillierten Ergebnissen der Untersuchung entsprechen. Die Zusammenfassung der Arbeit im HTML-Code gibt jedoch einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse.)
- Quote paper
- Matthias Buchholz (Author), 2009, Rhythmus als Problemfeld im Musikunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/142755