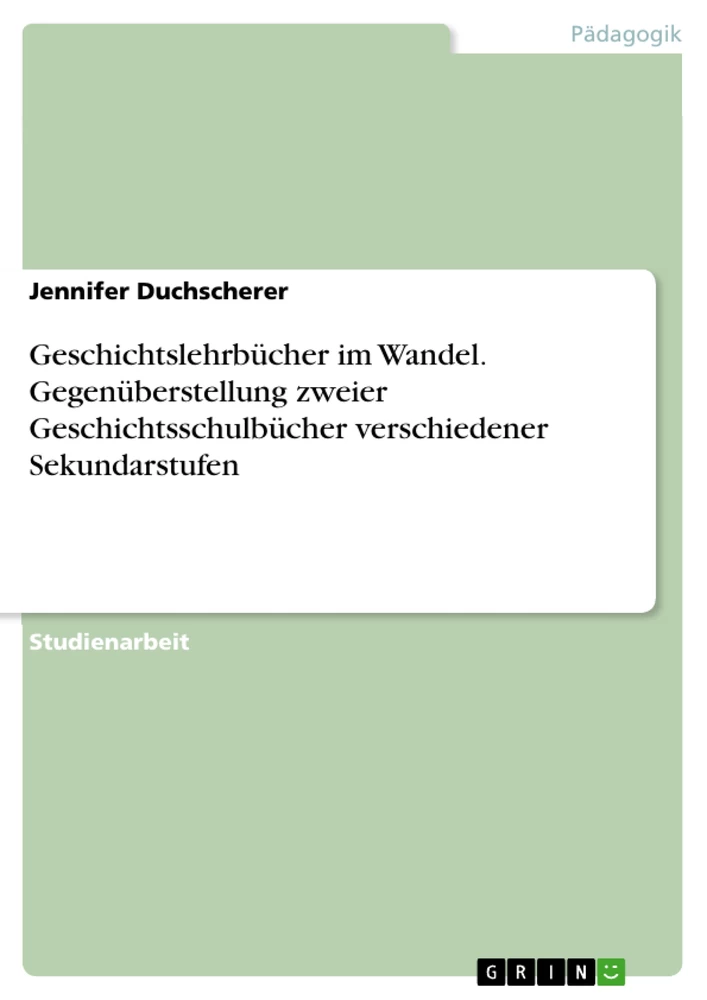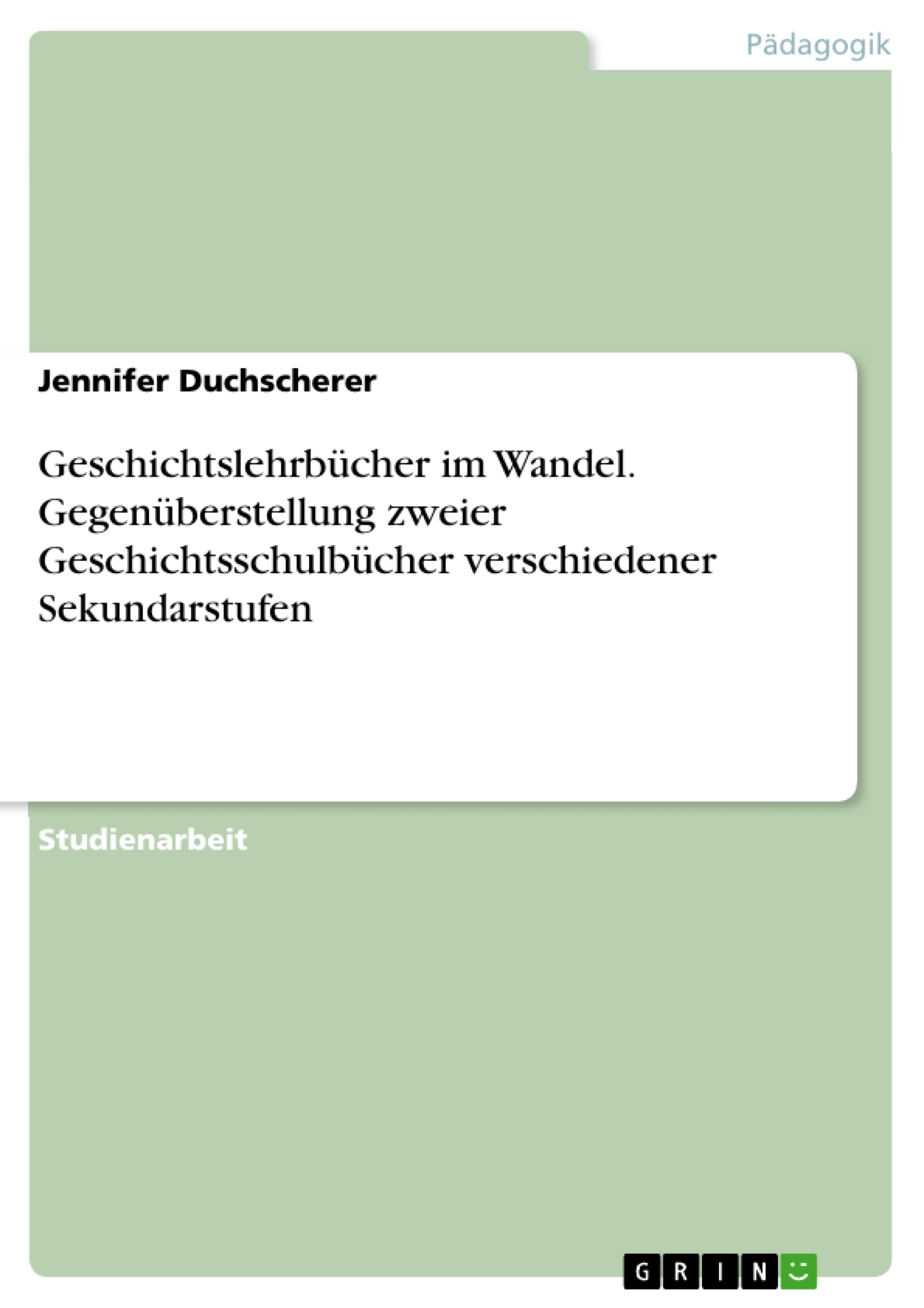Die Schulbuchforschung ist ein zentrales Feld der Geschichtsdidaktik, dennoch weist es die meisten Defizite auf. Auch Thünemann spricht davon, dass "obwohl wir empirisch nur relativ wenig darüber wissen, gilt das Schulbuch trotz eines rasanten medialen Wandels nach wie vor als 'Leitmedium des Geschichtsunterrichts'."
Aufgrund dessen soll diese Hausarbeit einen Beitrag zur Forschung leisten, indem der Wandel vom Schulbuchaufbau beleuchtet und der damit verbundenen Didaktik untersucht wird. Dazu werden zwei Geschichtsschulbücher, welche dem Verlag Cornelsen zugehörig sind, herangezogen. Nämlich das erste Lehrbuch "Grundwissen Geschichte – Von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart" aus dem Jahr 2008, welches für die Sekundarstufe I ausgerichtet ist und das zweite Buch "Grundwissen Geschichte – Sekundarstufe II" aus dem Jahr 2011, welches wie bereits der Untertitel deutlich macht, für die Sekundarstufe II ausgerichtet ist. Von Interesse ist hier also, ob es einen großen Unterschied zwischen den Geschichtsschulbüchern der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II gibt oder ob sie auch Gemeinsamkeiten aufweisen.
Um diesen Fragen weiter auf den Grund zu gehen, befasst sich die Hausarbeit im ersten Teil mit der generellen historischen Entwicklung des Geschichtsschulbuches. Im zweiten Teil wird erläutert, welche Inhalte zu einem idealen Lehrbuch führen, darunter sind die verschiedenen Bestandteile eines Kapitels zu verstehen, sowie die verschiedenen Aspekte, die für eine Analyse notwendig sind. Danach werden die beiden genannten Geschichtsschulbücher mit Hilfe der aufgeführten Aspekte analysiert. Daraufhin folgt das Fazit, wo geklärt wird, worin die grundlegenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen und was wichtig für die Vermittlung und Motivation der Schülerinnen und Schüler ist.
Für diese Hausarbeit dient hauptsächlich das Werk "Schulbucharbeit" von Bernd Schönemann und Holger Thünemann als Forschungsliteratur.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die historische Entwicklung der verschiedenen Typen des Geschichtsschulbuches
- 3. Das ideale Geschichtsschulbuch
- 3.1 Bestandteile eines Kapitels
- 3.1.1 Die Auftaktdoppelseiten
- 3.1.2 Der Darstellungsteil
- 3.1.3 Der Arbeitsteil
- 3.1.4 Die Paratexte
- 3.2 Bestandteile der Schulbuchanalyse
- 3.2.1 Die formal-gestalterische Ebene
- 3.2.2 Die fachwissenschaftlich-inhaltliche Ebene
- 3.2.3 Die fachdidaktisch-funktionale Ebene
- 3.1 Bestandteile eines Kapitels
- 4. Analyse zweier Kapitel der Geschichtsschulbücher für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II
- 4.1 Analyse des „Grundwissen Geschichte – Von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart“ Kapitels zur attischen Demokratie
- 4.1.1 Die formal-gestalterische Ebene
- 4.1.2 Die fachwissenschaftlich-inhaltliche Ebene
- 4.1.3 Die fachdidaktisch-funktionale Ebene
- 4.2 Analyse des „Grundwissen Geschichte – Sekundarstufe II“ Kapitels zur attischen Demokratie
- 4.2.1 Die formal-gestalterische Ebene
- 4.2.2 Die fachwissenschaftlich-inhaltliche Ebene
- 4.2.3 Die fachdidaktisch-funktionale Ebene
- 4.1 Analyse des „Grundwissen Geschichte – Von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart“ Kapitels zur attischen Demokratie
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Wandel im Aufbau von Geschichtsschulbüchern und die damit verbundene Didaktik. Sie vergleicht zwei Geschichtsschulbücher des Verlags Cornelsen für die Sekundarstufen I und II, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und deren Bedeutung für die Vermittlung und Motivation der Schüler zu beleuchten.
- Historische Entwicklung von Geschichtsschulbüchern
- Bestandteile eines idealen Geschichtsschulbuches
- Analyse der formal-gestalterischen, fachwissenschaftlich-inhaltlichen und fachdidaktisch-funktionalen Ebenen von Schulbüchern
- Vergleich der didaktischen Ansätze in Schulbüchern der Sekundarstufen I und II
- Bedeutung von visuellen Materialien und Arbeitsaufträgen für den Lernerfolg
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schulbuchforschung in der Geschichtsdidaktik ein und hebt die Bedeutung des Schulbuches als „Leitmedium“ hervor. Die Arbeit untersucht den Wandel des Schulbuchaufbaus und die damit verbundene Didaktik anhand zweier Geschichtsschulbücher von Cornelsen für die Sekundarstufen I und II. Die Zielsetzung ist der Vergleich der Bücher hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden und die Analyse ihrer Eignung zur Motivation und Vermittlung von historischem Wissen an Schüler.
2. Die historische Entwicklung der verschiedenen Typen des Geschichtsschulbuches: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von Geschichtsschulbüchern vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Es werden vier Haupttypen vorgestellt: die Katechese (Fragen-Antwort-Sequenzen), der klassische Leitfaden (erzählender Text), das reine Arbeitsbuch (Materialien und Arbeitsaufträge) und das kombinierte Lern- und Arbeitsbuch (kombiniert erzählenden Text, Materialien und Arbeitsaufträge). Die Entwicklung wird als Typenabfolge dargestellt, wobei jedes Buchtyp seine eigenen didaktischen Ansätze und Limitationen aufweist. Die Kapitel betont die Herausforderungen der verschiedenen Lehrbuchtypen, die vom Memorieren von Fakten bis hin zu selbstgesteuerten Lernprozessen reichen. Die Entwicklung zeigt einen klaren Wandel von der rein faktenorientierten Vermittlung hin zu aktiveren und Schüler-zentrierten Lernansätzen.
3. Das ideale Geschichtsschulbuch: Dieses Kapitel beschreibt die Bestandteile eines idealen Geschichtsschulbuches, wobei es sich auf die Struktur eines einzelnen Kapitels konzentriert. Es werden die Auftaktdoppelseiten mit ihren Funktionen der Orientierung und Motivation der Schüler hervorgehoben. Des Weiteren werden der Darstellungsteil, der Arbeitsteil und die Paratexte als wichtige Elemente für ein effektives Lernen diskutiert. Die Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen informierenden Texten, aktivierenden Arbeitsaufträgen und ansprechenden visuellen Materialien, um ein ansprechendes und effektives Lernumfeld zu schaffen. Die verschiedenen Ebenen der Schulbuchanalyse – formal-gestalterisch, fachwissenschaftlich-inhaltlich und fachdidaktisch-funktional – werden ebenfalls erläutert und liefern ein Rahmenwerk für die spätere Analyse der ausgewählten Schulbücher.
Schlüsselwörter
Geschichtsschulbücher, Geschichtsdidaktik, Schulbuchforschung, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Lehrbuchtypen, Didaktik, Lernprozess, Motivation, Visualisierung, Analysemethoden.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Analyse von Geschichtsschulbüchern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert den Wandel im Aufbau von Geschichtsschulbüchern und die damit verbundene Didaktik. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich zweier Geschichtsschulbücher des Verlags Cornelsen für die Sekundarstufen I und II, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und deren Bedeutung für die Vermittlung und Motivation der Schüler zu beleuchten.
Welche Aspekte der Geschichtsschulbücher werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung von Geschichtsschulbüchern, die Bestandteile eines idealen Geschichtsschulbuches (inkl. Kapitelstruktur: Auftaktdoppelseiten, Darstellungsteil, Arbeitsteil, Paratexte), sowie die formal-gestalterische, fachwissenschaftlich-inhaltliche und fachdidaktisch-funktionale Ebene der Bücher. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der didaktischen Ansätze in Schulbüchern der Sekundarstufen I und II und der Bedeutung visueller Materialien und Arbeitsaufträge für den Lernerfolg.
Welche Schulbücher werden verglichen?
Es werden zwei Geschichtsschulbücher des Verlags Cornelsen analysiert: eines für die Sekundarstufe I und eines für die Sekundarstufe II. Konkret wird ein Kapitel zur attischen Demokratie in beiden Büchern im Detail untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der beiden Schulbücher. Dabei werden die drei Ebenen der Schulbuchanalyse (formal-gestalterisch, fachwissenschaftlich-inhaltlich und fachdidaktisch-funktional) systematisch angewendet, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Welche Typen von Geschichtsschulbüchern werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet vier Haupttypen von Geschichtsschulbüchern: die Katechese (Fragen-Antwort-Sequenzen), den klassischen Leitfaden (erzählender Text), das reine Arbeitsbuch (Materialien und Arbeitsaufträge) und das kombinierte Lern- und Arbeitsbuch (kombiniert erzählenden Text, Materialien und Arbeitsaufträge). Die Entwicklung wird als Typenabfolge dargestellt.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung von Geschichtsschulbüchern, ein Kapitel zum idealen Geschichtsschulbuch, eine detaillierte Analyse zweier Kapitel (Sekundarstufe I und II) und ein Fazit. Es beinhaltet auch ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist die zentrale These oder Schlussfolgerung der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit lässt sich aus der Zusammenfassung der Kapitel und dem Fokus auf den Vergleich der didaktischen Ansätze ableiten. Es wird untersucht, wie sich der Aufbau und die didaktische Konzeption von Geschichtsschulbüchern im Laufe der Zeit verändert haben und welche Implikationen dies für den Lernerfolg und die Motivation der Schüler hat. Die konkrete Schlussfolgerung ergibt sich aus dem Vergleich der analysierten Schulbücher.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Geschichtsschulbücher, Geschichtsdidaktik, Schulbuchforschung, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Lehrbuchtypen, Didaktik, Lernprozess, Motivation, Visualisierung, Analysemethoden.
- Quote paper
- Jennifer Duchscherer (Author), 2021, Geschichtslehrbücher im Wandel. Gegenüberstellung zweier Geschichtsschulbücher verschiedener Sekundarstufen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1382844