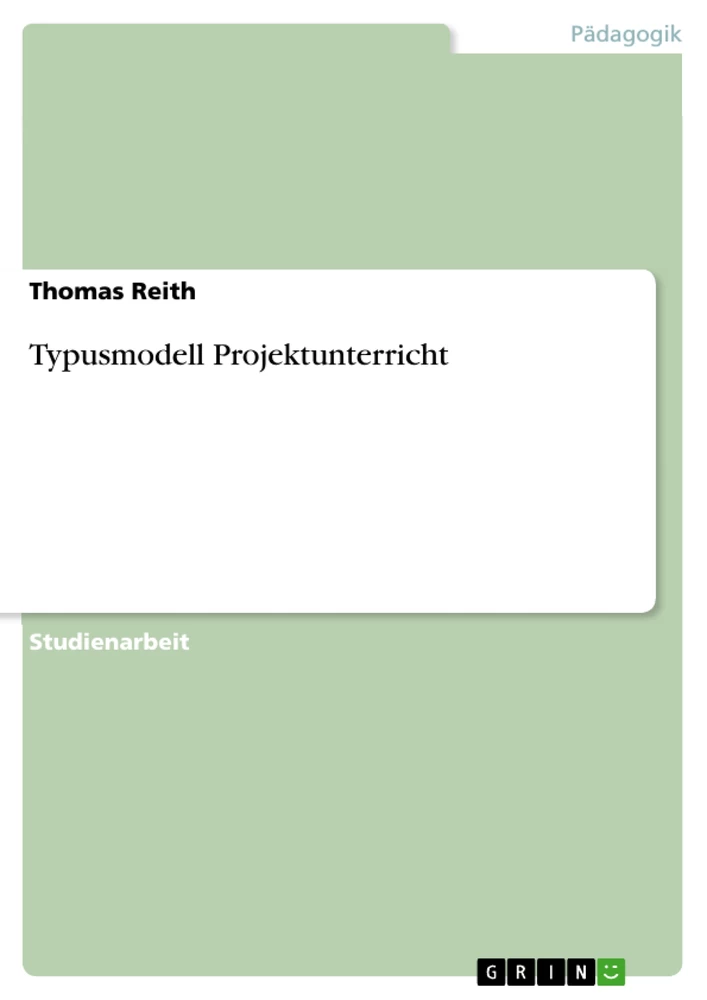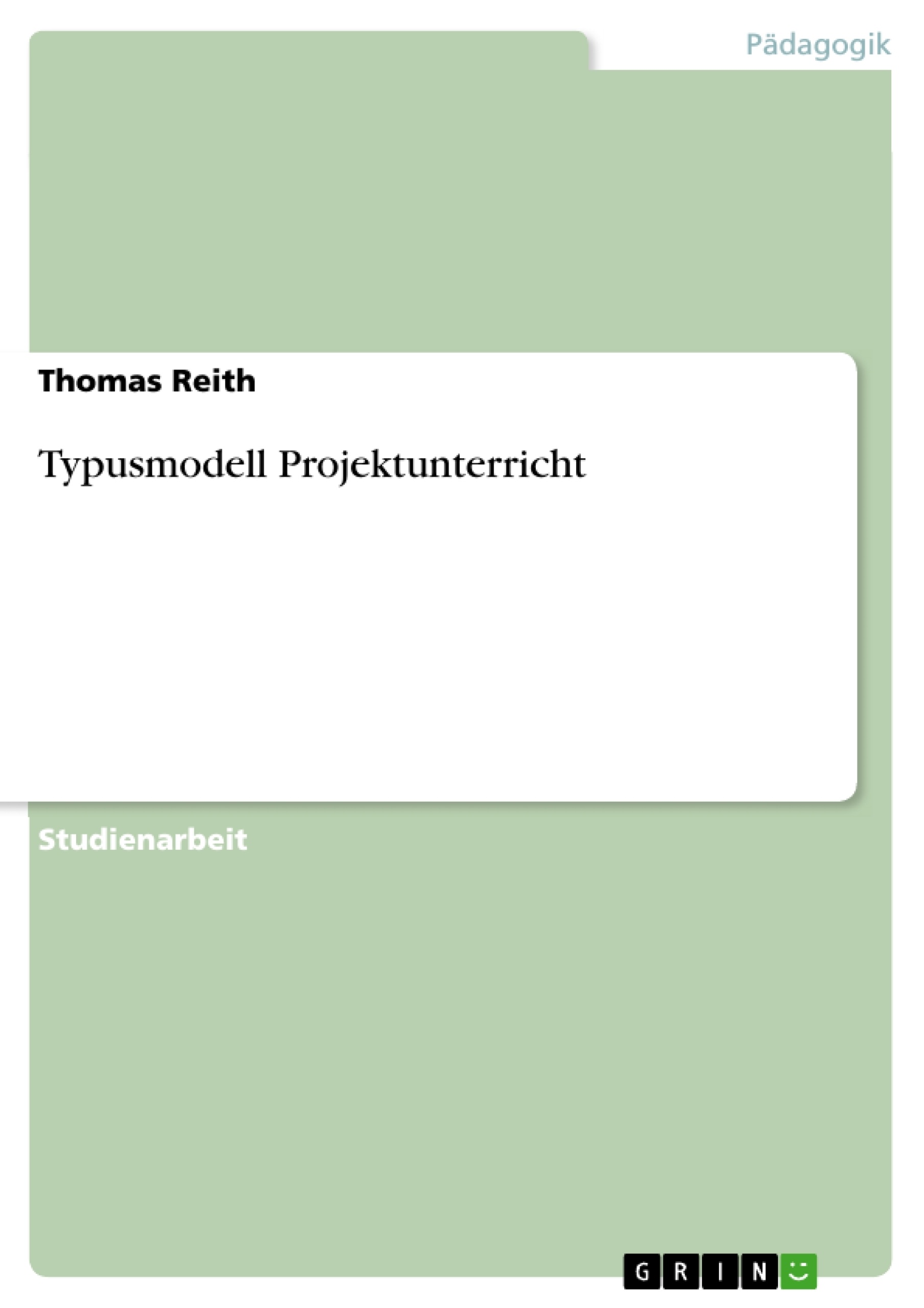1. Zentrale Begrifflichkeit
Der Begriff »Projekt« steht im Allgemeinen für die Planung und Durchführung eines Vorhabens und wird in diesem Sinne vor allem in der Industrie und in der Forschung verwendet. Auf den Bereich von Schule und Unterricht übertragen bedeutet er die Planung und Durchführung einer längeren Unterrichtseinheit.(1)
Nach JOHN DEWEY und WILLIAM HEARD KILPATRICK, die als die bedeutendsten Initiatoren des pädagogischen Pragmatismus angesehen werden, ist ein Projekt „ein planvolles Handeln, das von dem gesamten personalen Impetus getragen wird und in einer sozialen Umwelt abläuft“.(2)
[...]
_____
1 vergl. C. Wulf: Wörterbuch der Erziehung, 6. Auflage, München 1984, S. 470. (im folgenden zitiert als: C. Wulf: Wörterbuch der Erziehung.)
2 H. Röhrs: Projekt, Projektunterricht, in: Wörterbuch der Pädagogik, 3. Band, herausgegeben vom Willmann-Institut München – Wien (Leiter der Herausgabe: Prof. Dr. Heinrich Rombach), Freiburg 1977, S. 13. (im folgenden zitiert als: H. Röhrs: Projekt, Projektunterricht.)
Inhaltsverzeichnis
- Zentrale Begrifflichkeit
- Historischer Ursprung
- Begründung
- Möglichkeiten und Grenzen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung des Textes ist die umfassende Erläuterung des Begriffs „Projekt“ im Kontext von Schule und Unterricht, insbesondere die Analyse des Konzepts des Projektunterrichts. Der Text beleuchtet den historischen Ursprung des Projektbegriffs, die pädagogischen Begründungen für den Einsatz des Projektunterrichts und die Möglichkeiten und Grenzen dieser Unterrichtsform.
- Definition und Abgrenzung des Projektbegriffs
- Historische Entwicklung des Projektunterrichts
- Pädagogische Begründung des Projektunterrichts
- Merkmale und Prinzipien des Projektunterrichts
- Möglichkeiten und Grenzen des Projektunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Zentrale Begrifflichkeit
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Projekt“ und seinen Bezug zur Schul- und Unterrichtspraxis. Es werden die Ursprünge des Projektbegriffs im pädagogischen Pragmatismus von John Dewey und William Heard Kilpatrick beleuchtet und verschiedene Definitionen des Begriffs vorgestellt.
Historischer Ursprung
Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Projektbegriffs, beginnend mit den frühen Ansätzen des pädagogischen Pragmatismus bis hin zu modernen Konzepten des Projektunterrichts.
Begründung
Dieses Kapitel beleuchtet die pädagogischen Begründungen für den Einsatz des Projektunterrichts. Es werden Argumente für die Stärkung von Schüleraktivität, Selbstständigkeit und Selbstverantwortung im Unterricht erörtert.
Möglichkeiten und Grenzen
Dieses Kapitel analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Projektunterrichts. Es werden sowohl die Vorteile der Unterrichtsform, wie z.B. die Förderung von Lernmotivation, Kreativität und Sozialkompetenz, als auch die Herausforderungen und Grenzen, wie z.B. die notwendige Planung, Organisation und die Berücksichtigung individueller Lerngeschwindigkeiten, dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Textes sind Projektunterricht, Projekt, pädagogischer Pragmatismus, Handlungsorientierung, Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Soziales Lernen, interdisziplinäres Lernen, Praxisrelevanz, Grenzen des Projektunterrichts.
- Quote paper
- Thomas Reith (Author), 2000, Typusmodell Projektunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1373