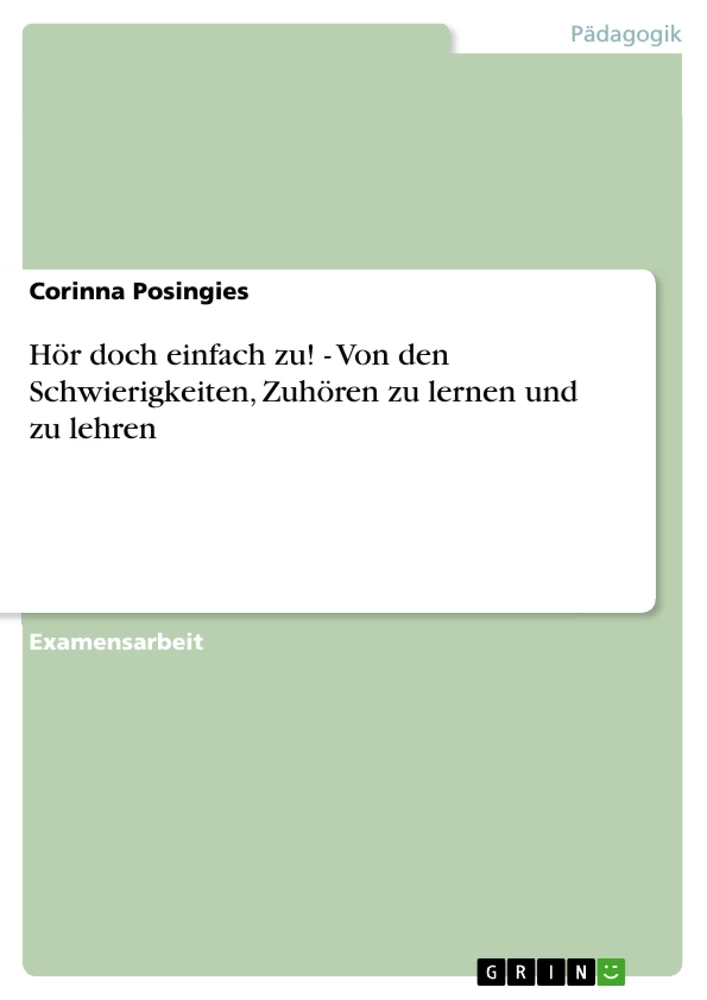Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht zuhören wollen oder zuhören müssen. Weil Hören und Zuhören so selbstverständlich sind (wie das Atmen), haben wir uns daran gewöhnt, Zuhören als eine Fähigkeit anzusehen, die jeder mit sich bringt. Man denkt nicht darüber nach, wie Zuhören entsteht, man glaubt es entsteht nebenbei oder es wird automatisch erworben. Bei näherer Betrachtung der täglichen Wahrnehmungen im Unterricht (Kinder können sich schlechter konzentrieren, lassen sich leichter ablenken, können weniger wahrnehmen, sind sprachlich geringer entwickelt und können nur unzureichend Informationen behalten) ist erkennbar, dass die Fähigkeit zum Zuhören dem Menschen nicht in die Wiege gelegt wird, sondern dass es sich um eine Fähigkeit handelt, die es zu fördern gilt. Kinder können sich schlechter konzentrieren, lassen sich leichter ablenken, können weniger wahrnehmen, sprachlich geringer entwickelt sind und nur unzureichend Informationen behalten können. „Es ist ein pädagogisches Paradox, dass Zuhören zwar am häufigsten von allen Sprachfähigkeiten verlangt wird, aber am wenigsten Zeit dafür aufgewendet wird, es zu schulen […].“ (IMHOF 2004, S.34)
Miteinander reden und sich zuhören ist aber nicht so einfach wie es erscheint. Nicht umsonst kennen wir die vorwurfsvollen Worte „Du hörst mir nie zu“ nur allzu gut. Erst dieser Mangel verdeutlicht, dass „die Fähigkeiten des Zuhörens der Schlüssel und die Voraussetzung dafür sind, an Gesprächen aktiv und interpretierend teilzunehmen, Informationen zu verstehen und zu verarbeiten, Sprachen zu lernen und sich an Musik, Hörbüchern, gelesener Literatur oder einer intakten akustischen Umwelt zu erfreuen“(BERNIUS 2004, S. 11).
Im pädagogischen Alltag wird das Zuhören täglich eingefordert und verlangt, doch wie die Kinder das erreichen können, findet in der Regel keine Beachtung. Die Durchsicht des Rahmenplans Grundschule für das Bundesland Hessen bestätigt, dass das Hören weitgehend als selbstverständlich angesehen wird, denn eine explizite Erwähnung dieser Kompetenz ist nicht zu finden. „Die Methoden, auf das Hören und Zuhören zu achten, sie zu lehren und zu lernen, sind vergessen oder haben sich verändert.“ (BERNIUS 2004, S. 11) Es ist also unbedingt notwendig und gehört zu den Aufgaben der Schule, durch ein gezieltes und differenziertes Methodentraining diese grundlegende Kompetenz des Hörens und Zuhörens im schulischen Bereich zu fordern und zu fördern [..]
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Teil
- Einleitung
- Gegenstand und Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Aktives Zuhören - Was ist das eigentlich?
- Definition „Aktives Zuhören“
- Pädagogischer Stellenwert
- Aufgaben, Ziele und Diagnostik
- Fördermöglichkeiten
- Praktischer Teil
- Die Förderung mit Methodenbausteinen
- Die Lerngruppe
- Beschreibung der Lerngruppe
- Die Beobachtungen in der Lerngruppe
- Fördermaßnahmen mit Schwerpunkt „Sprechen und Sprache“
- Sprache
- Stimme
- Kommunikation
- Erzählen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung des aktiven Zuhörens im Deutschunterricht der zweiten Klasse. Ausgehend von Beobachtungen im Unterricht, die die Schwierigkeit der Schüler beim Zuhören aufzeigen, entwickelt und evaluiert die Arbeit Maßnahmen zur Verbesserung der auditiven Wahrnehmung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration dieser Maßnahmen in den regulären Unterricht, um eine langfristige Förderung zu gewährleisten.
- Schwierigkeiten beim Zuhörenlernen von Grundschulkindern
- Entwicklung und Implementierung von Fördermaßnahmen für aktives Zuhören
- Der pädagogische Stellenwert von aktivem Zuhören
- Methoden zur Verbesserung der auditiven Wahrnehmung
- Integration von Fördermaßnahmen in den regulären Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des aktiven Zuhörens im Grundschulalter dar. Ausgehend von Goethes Zitat über Reden und Zuhören wird deutlich, dass Zuhören oft als selbstverständliche Fähigkeit angesehen wird, obwohl es eine gezielte Förderung benötigt. Die Arbeit untersucht die Schwierigkeiten von Schülern beim konzentrierten Zuhören und die mangelnde Berücksichtigung dieser Kompetenz im Rahmenplan der Grundschule in Hessen. Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Erprobung von Fördermaßnahmen für aktives Zuhören im Deutschunterricht der zweiten Klasse, die in den regulären Unterricht integrierbar sind und dem Leitbild der Schule gerecht werden, das die Förderung aller Schüler betont, insbesondere derer mit Deutsch als Zweitsprache.
Aktives Zuhören - Was ist das eigentlich?: Dieses Kapitel definiert aktives Zuhören und beleuchtet dessen pädagogischen Stellenwert. Es werden Aufgaben, Ziele und Möglichkeiten der Diagnostik des aktiven Zuhörens erörtert. Weiterhin werden verschiedene Fördermöglichkeiten diskutiert, die die Grundlage für den praktischen Teil der Arbeit bilden. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des aktiven Zuhörens nicht nur für den Lernerfolg, sondern auch für die soziale Interaktion und die Teilhabe am Unterricht. Es wird die Notwendigkeit einer expliziten Förderung dieser Kompetenz hervorgehoben, da sie nicht automatisch erworben wird.
Die Förderung mit Methodenbausteinen: Dieser Kapitel beschreibt die Lerngruppe und die Beobachtungen, die zu der Entscheidung für die spezifischen Fördermaßnahmen führten. Der Abschnitt behandelt verschiedene Fördermaßnahmen mit dem Schwerpunkt Sprechen und Sprache, unterteilt in die Bereiche Sprache, Stimme, Kommunikation und Erzählen. Es wird detailliert auf die praktische Umsetzung der gewählten Methoden eingegangen, wobei die Synthese aus Theorie und Praxis im Vordergrund steht. Der Fokus liegt auf der Anpassung der Maßnahmen an die individuellen Bedürfnisse der Schüler.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Förderung des aktiven Zuhörens im Deutschunterricht der zweiten Klasse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Förderung des aktiven Zuhörens im Deutschunterricht der zweiten Klasse. Sie basiert auf Beobachtungen, die Schwierigkeiten der Schüler beim Zuhören aufzeigen, und entwickelt und evaluiert Maßnahmen zur Verbesserung der auditiven Wahrnehmung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration dieser Maßnahmen in den regulären Unterricht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Schwierigkeiten beim Zuhörenlernen von Grundschulkindern, der Entwicklung und Implementierung von Fördermaßnahmen für aktives Zuhören, dem pädagogischen Stellenwert von aktivem Zuhören, Methoden zur Verbesserung der auditiven Wahrnehmung und der Integration von Fördermaßnahmen in den regulären Unterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der theoretische Teil umfasst eine Einleitung mit Gegenstand und Ziel der Arbeit, eine Definition von aktivem Zuhören, dessen pädagogischen Stellenwert, Aufgaben, Ziele und Diagnostik sowie Fördermöglichkeiten. Der praktische Teil beschreibt die Lerngruppe, die Beobachtungen in der Lerngruppe und die durchgeführten Fördermaßnahmen mit Schwerpunkt Sprechen und Sprache (Sprache, Stimme, Kommunikation, Erzählen). Ein Fazit und Ausblick schließen die Arbeit ab.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt die Problematik des aktiven Zuhörens im Grundschulalter dar. Ausgehend von Goethes Zitat über Reden und Zuhören wird die Notwendigkeit einer gezielten Förderung hervorgehoben. Die Arbeit untersucht Schwierigkeiten von Schülern beim konzentrierten Zuhören und die mangelnde Berücksichtigung dieser Kompetenz im hessischen Rahmenplan. Das Ziel ist die Entwicklung und Erprobung integrierbarer Fördermaßnahmen, die dem Leitbild der Schule gerecht werden, insbesondere für Schüler mit Deutsch als Zweitsprache.
Wie wird aktives Zuhören definiert und welche Bedeutung hat es?
Das Kapitel "Aktives Zuhören - Was ist das eigentlich?" definiert aktives Zuhören und beleuchtet dessen pädagogischen Stellenwert. Es werden Aufgaben, Ziele und Möglichkeiten der Diagnostik erörtert und verschiedene Fördermöglichkeiten diskutiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung für Lernerfolg, soziale Interaktion und Teilhabe am Unterricht. Die Notwendigkeit einer expliziten Förderung wird hervorgehoben.
Wie werden die Fördermaßnahmen im praktischen Teil beschrieben?
Der praktische Teil beschreibt die Lerngruppe und die Beobachtungen, die zu den spezifischen Fördermaßnahmen führten. Es werden Fördermaßnahmen mit Schwerpunkt Sprechen und Sprache (Sprache, Stimme, Kommunikation, Erzählen) detailliert beschrieben, mit Fokus auf die praktische Umsetzung und Anpassung an individuelle Schülerbedürfnisse. Die Synthese aus Theorie und Praxis steht im Vordergrund.
Welche konkreten Methoden werden eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt konkrete Methoden zur Förderung des aktiven Zuhörens im Unterricht. Die genauen Methoden werden im Kapitel "Die Förderung mit Methodenbausteinen" detailliert erläutert, unterteilt in die Bereiche Sprache, Stimme, Kommunikation und Erzählen. Die Auswahl der Methoden basiert auf den Beobachtungen in der Lerngruppe und zielt auf die Verbesserung der auditiven Wahrnehmung ab.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrkräfte der Grundschule, insbesondere im Deutschunterricht, sowie für Lehramtsstudierende und Personen, die sich mit der Förderung von auditiver Wahrnehmung und Kommunikationsfähigkeiten bei Grundschulkindern beschäftigen. Sie bietet praktische Anregungen und methodische Hilfestellungen für den Unterricht.
- Quote paper
- Corinna Posingies (Author), 2007, Hör doch einfach zu! - Von den Schwierigkeiten, Zuhören zu lernen und zu lehren, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/130092