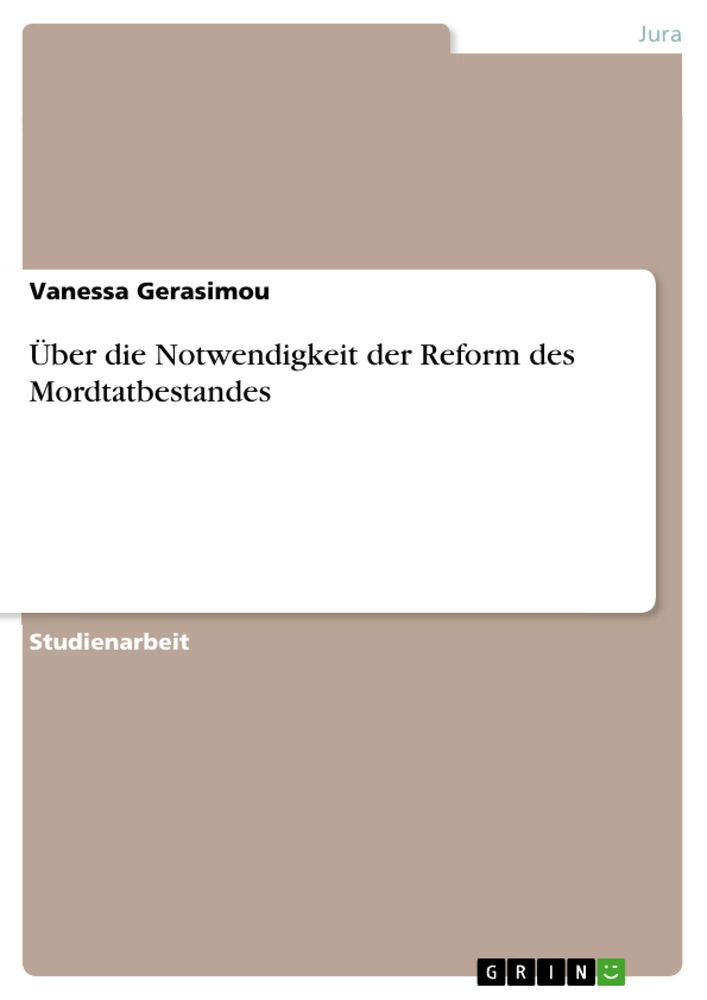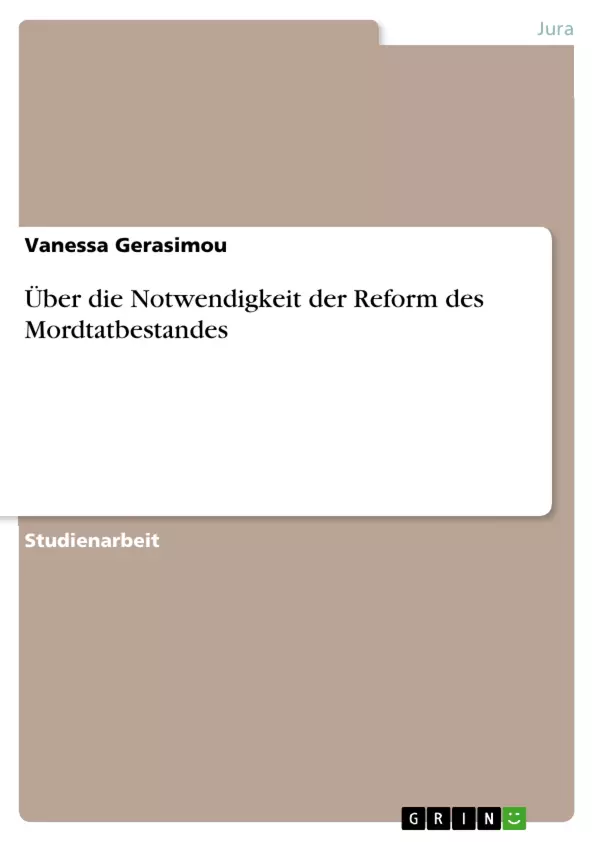Mord und Totschlag gelten durch die Vernichtung des menschlichen Lebens wohl unbestritten als die schlimmste Straftat, die dem deutschen Strafrecht bekannt ist. Nicht zuletzt daher hat nahezu keine Norm im StGB in den letzten Jahrzehnten für so viel Aufsehen gesorgt, wie die des Mordes in § 211 StGB1. Dies mag einerseits daran liegen, dass die gegenwärtige Fassung des § 211 immer noch die Grundintention des Gesetzes zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuches von 1941 enthält und damit noch immer einen Tätertypus beschreibt und dessen Gesinnung bestraft, was mit dem modernen Strafrechtsverständnis nicht mehr vereinbar ist.
Andererseits sorgt der Mordparagraph aber auch in der Bevölkerung immer wieder für Aufregung, da der Unterschied zwischen Mord und Totschlag für den juristischen Laien immer noch maßgeblich vom Überlegungsmerkmal abhängt und damit vor allem die zeitigen Freiheitsstrafen des Totschlages gem. § 212 auf großes Unverständnis in der Gesellschaft stoßen. Nicht zuletzt aufgrund der überwiegenden Überzeugung der Bevölkerung, der "Mörder" solle die "höchstmögliche Strafe" erhalten und "für immer weggesperrt" werden, als auch aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 21.06.1977, welches den Mordparagraphen und die lebenslange Freiheitsstrafe grundsätzlich für verfassungsgemäß erklärte, hat wohl die seit nunmehr 70 Jahren währende Reformdiskussion keinen Niederschlag im Bundesgesetzblatt gefunden.
Auch der letzte Reformentwurf des Bundesjustizministeriums im Jahre 2016, welcher in Anlehnung an den zuvor vom damaligen Bundesjustizminister Heiko Maas und einer Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte gefertigten Abschlussbericht entworfen wurde, konnte sich nicht durchsetzen. Die Reform des Mordtatbestandes erscheint aber nicht nur angesichts der längst überfälligen, aber wohlgemerkt eher symbolischen, notwendigen "Abschaffung der Nazi-Terminologie" dringend erforderlich, sondern vor allem aufgrund zahlreicher inhaltlicher Unstimmigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Problematik des Mordtatbestandes
- Mordmerkmale § 211 II
- Mordlust
- Zur Befriedigung des Geschlechtstriebes
- Habgier
- Niedrige Beweggründe
- Heimtücke
- Grausam
- Mit gemeingefährlichen Mitteln
- Verdeckungs- und Ermöglichungsabsicht
- Die Anwendbarkeit des § 28
- Rechtsfolgenseite
- Exklusivitäts-Absolutheits-Mechanismus
- Lebenslange Freiheitsstrafe
- Reformansätze
- Einheitstatbestand
- Zweistufiges Konzept
- Entwurf von Eser und Entwurf von AE-Leben
- Entwurf von Grünewald
- Dreistufiges Konzept
- Entwurf von Kubik/Zimmermann und Entwurf von Kargl
- Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums
- Eigener Vorschlag
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Reform des Mordtatbestandes (§ 211 StGB) und analysiert die Problematik des bestehenden Tatbestandes sowie verschiedene Reformansätze. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Lösungsvorschläge im Hinblick auf ihre Effektivität und Rechtssicherheit zu bewerten.
- Analyse der Problematik des bestehenden Mordtatbestandes
- Bewertung verschiedener Reformansätze
- Untersuchung der Rechtssicherheit und Effektivität der Reformvorschläge
- Diskussion der relevanten Argumente und juristischen Interpretationen
- Entwicklung eines eigenen Reformvorschlags
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Mordtatbestandes dar und beleuchtet die Notwendigkeit einer Reform. Das zweite Kapitel analysiert die Mordmerkmale des § 211 II StGB im Detail. Die Rechtsfolgenseite des Mordtatbestandes wird im dritten Kapitel behandelt. Das vierte Kapitel untersucht die verschiedenen Reformansätze, die in der Literatur und Rechtsprechung diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Mordtatbestand, Strafgesetzbuch, § 211 StGB, Reform, Tötungsdelikte, Mordmerkmale, Rechtssicherheit, Effektivität, Reformansätze, Einheitstatbestand, Zweistufiges Konzept, Dreistufiges Konzept, Lebenslange Freiheitsstrafe, Juristische Interpretationen
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die aktuelle Fassung des Mordparagraphen (§ 211 StGB) kritisiert?
Kritisiert wird vor allem die enthaltene „Nazi-Terminologie“, die einen Tätertypus und dessen Gesinnung bestraft, was nicht mehr mit dem modernen Schuldstrafrecht vereinbar ist.
Was sind die gesetzlichen Mordmerkmale?
Zu den Merkmalen gehören unter anderem Mordlust, Habgier, niedrige Beweggründe, Heimtücke, Grausamkeit und die Verdeckungsabsicht einer anderen Straftat.
Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag für Laien?
In der öffentlichen Wahrnehmung hängt der Unterschied oft fälschlicherweise maßgeblich vom Merkmal der Überlegung oder Planung ab.
Welche Reformkonzepte werden in der Rechtswissenschaft diskutiert?
Es werden Einheitsmodelle, zweistufige Konzepte (z.B. Entwurf von Eser oder AE-Leben) sowie dreistufige Konzepte diskutiert.
Ist die lebenslange Freiheitsstrafe verfassungsgemäß?
Das Bundesverfassungsgericht erklärte den Mordparagraphen und die lebenslange Freiheitsstrafe bereits 1977 grundsätzlich für verfassungsgemäß.
Was war das Ziel des Reformentwurfs von 2016?
Der Entwurf basierte auf dem Abschlussbericht einer Expertengruppe unter Heiko Maas und zielte darauf ab, inhaltliche Unstimmigkeiten zu beseitigen und die Tätertypenlehre abzuschaffen.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Gerasimou (Autor:in), 2022, Über die Notwendigkeit der Reform des Mordtatbestandes, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1280220