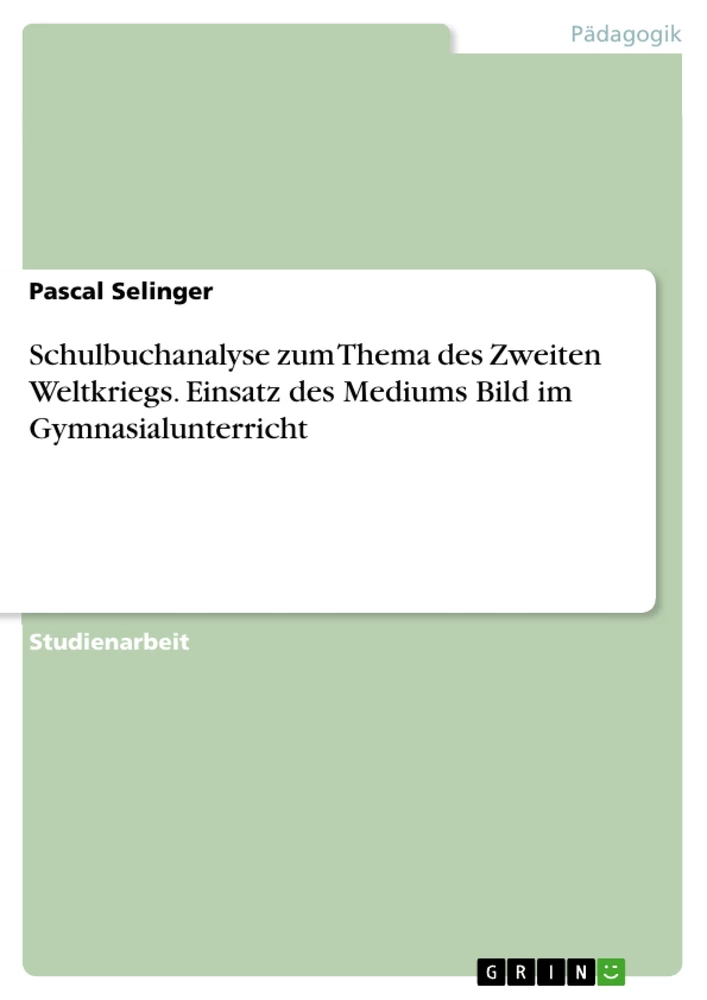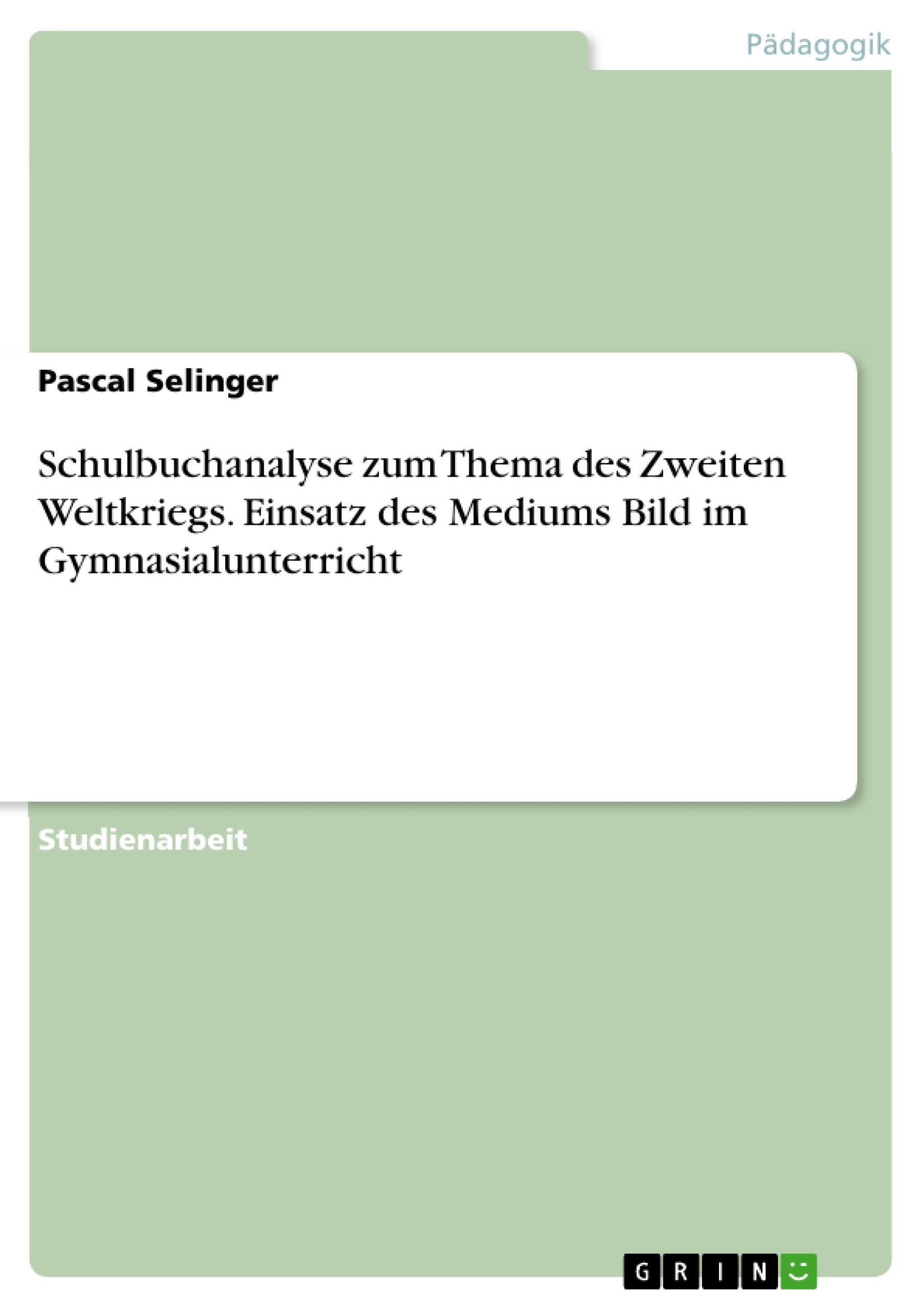Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, bildlichen Informations- und Bedeutungsträger dreier unterschiedliche Geschichtsbücher zu analysieren und zu vergleichen. Dabei soll aus dem Themengebiet des Zweiten Weltkrieges unterschiedliche Bilder hinzugezogen werden.
Die Untersuchungsgegenstände dieser Arbeit werden drei unterschiedliche Schulgeschichtsbücher sein. Zum einen das Schulgeschichtsbuch "Horizonte II", herausgegeben von Frank Bahr, für die Oberstufe eines beruflichen Gymnasiums der Fächerkombination Geschichte und Gemeinschaftskunde.
Zum anderen das Schulgeschichtsbuch "Geschichte und Geschehen", veröffentlicht von Felix Dietzsch u.a., für die Oberstufe eins allgemeinbildenden Gymnasiums und zu guter Letzt das Geschichtsbuch "Kursbuch Geschichte", veröffentlicht von Rudolf Berg u.a., für die Oberstufe eins allgemeinbildenden Gymnasiums.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse des Schulgeschichtsbuches „Geschichte und Geschehen“
- Bildanalyse: Geschichtskarte: Heeresbewegungen im Zweiten Weltkrieg
- Intension und Potenziale
- Bildanalyse: Realaussagen: Bombenkrieg und Untergangsideologie
- Intension und Potenziale
- Analyse des Schulgeschichtsbuches „Horizonte II“
- Bildanalyse Geschichtskarte: Das ``Dritte Reich´´ und Europa 1935-1939
- Intension und Potenziale
- Bildanalyse Geschichtskarte: Der Zweite Weltkrieg in Europa 1942-1945
- Intension und Potenziale
- Bildanalyse: Realaussagen: Dresden, Foto von 1945
- Intension und Potenziale
- Analyse des Schulgeschichtsbuches „Kursbuch Geschichte“
- Bildanalyse Plakat: NS-Plakat, 1943
- Intension und Potenziale
- Bildanalyse Realaussage: Die Zerstörte Innenstadt von Dresden, Blick vom Rathausturm, Fotografie, 1945
- Intension und Potenziale
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert und vergleicht bildliche Informations- und Bedeutungsträger in drei unterschiedlichen Geschichtsbüchern zum Thema Zweiter Weltkrieg. Die Arbeit untersucht die Intention und Potenziale dieser Bilder im Hinblick auf den Geschichtsunterricht.
- Rolle von Bildern im Geschichtsunterricht und deren Bedeutung für den Lernprozess
- Analyse der Intention und Funktion von Bildern in Schulgeschichtsbüchern
- Bewertung des Potenzials von Bildern für den Geschichtsunterricht
- Vergleich der Bildanalysen und Interpretationen in den unterschiedlichen Schulbüchern
- Relevanz von Bildern für die Konstruktion und Vermittlung von Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit analysiert die Bildquellen in drei verschiedenen Schulgeschichtsbüchern. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Bildinhalte, der Interpretation der Intentionen und der Bewertung des Potenzials der Bilder für den Unterricht. Die Arbeit zeigt, wie Bilder in Schulbüchern eingesetzt werden können, um den Lernprozess zu fördern und historische Themen zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Schulbuchforschung, Geschichtsdidaktik, Bildanalyse, Zweiter Weltkrieg, Geschichtskarte, Realaussagen, Schulgeschichtsbücher, Intention, Potenzial, Unterrichtspraxis.
- Quote paper
- Pascal Selinger (Author), 2021, Schulbuchanalyse zum Thema des Zweiten Weltkriegs. Einsatz des Mediums Bild im Gymnasialunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1275856