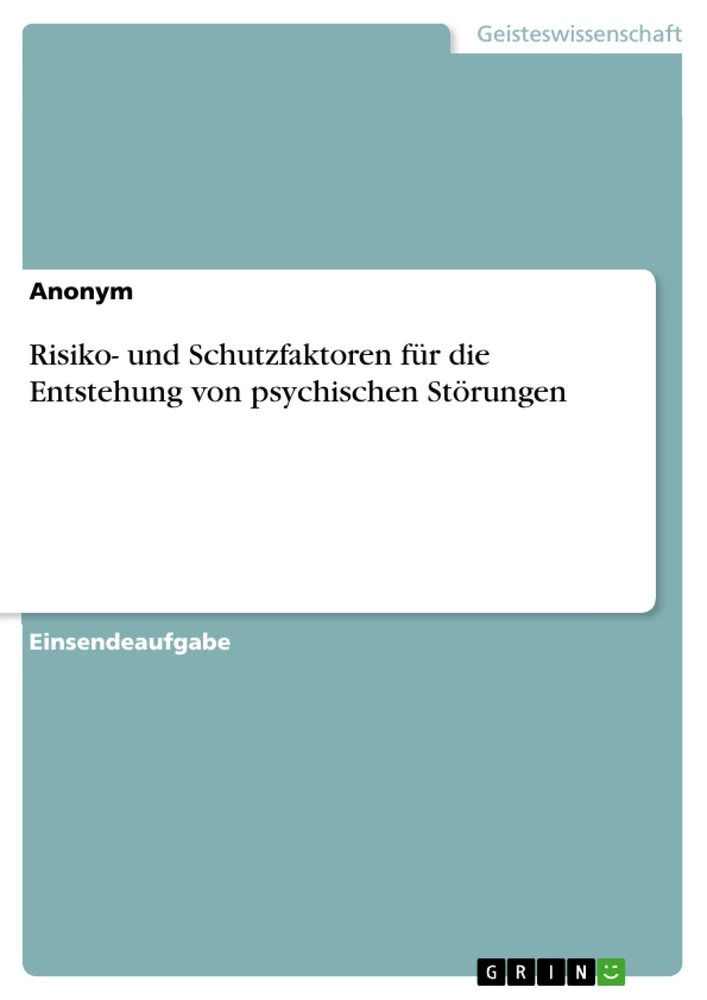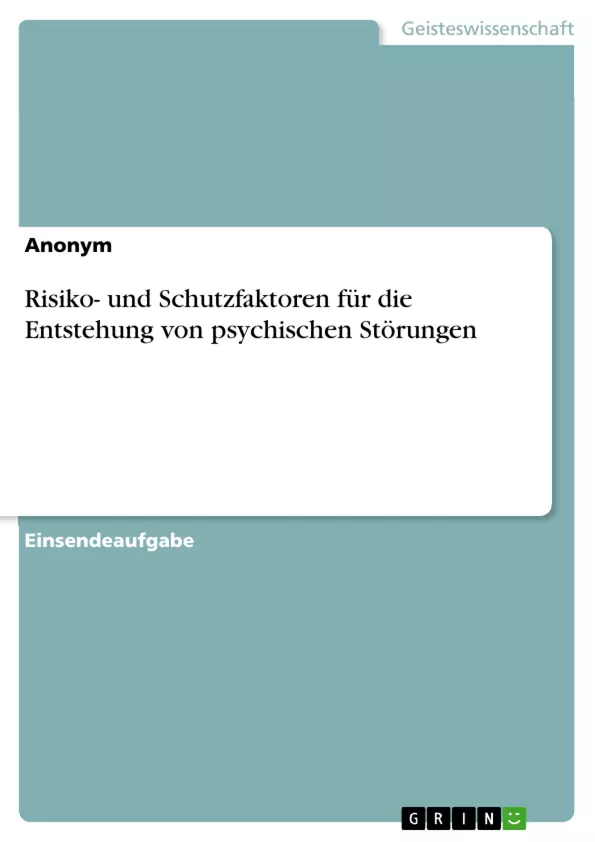Diese Arbeit behandelt die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen und erklärt mithilfe theoretischer Modelle und empirischer Ergebnisse den Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognitionen auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen.
Im Anschluss werden an einem selbstgewählten Beispiel die einzelnen Schritte des diagnostischen Prozesses im Rahmen psychotherapeutischer Interventionen genau dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Textteil zu Aufgabe 1
- Textteil zu Aufgabe 2
- Textteil zu Aufgabe 3
- Planungsphase
- Durchführungsphase
- Integrationsphase
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen. Sie analysiert die Rolle von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, die eine Fehlentwicklung begünstigen oder verhindern können. Dabei werden sowohl personale als auch soziale Faktoren betrachtet und in ihrer dynamischen Wirkung auf den Entwicklungsverlauf beleuchtet.
- Risikofaktoren und Schutzfaktoren bei der Entstehung psychischer Störungen
- Das Zusammenspiel von bio-psycho-sozialen Faktoren
- Die Rolle von genetischen und umweltbedingten Einflussfaktoren
- Der Einfluss soziodemografischer Faktoren wie Geschlecht und Alter
- Die Bedeutung von Temperament und Persönlichkeit für die Entstehung psychischer Störungen
Zusammenfassung der Kapitel
Textteil zu Aufgabe 1
Dieser Abschnitt erläutert die Rolle von Risikofaktoren und Schutzfaktoren bei der Entstehung von psychischen Störungen. Er definiert diese Konstrukte und beschreibt, wie sie im Zusammenspiel die Entwicklung einer Fehlentwicklung beeinflussen. Außerdem wird das Konzept der Vulnerabilität und Resilienz vorgestellt und anhand von Beispielen veranschaulicht.
Textteil zu Aufgabe 2
Dieser Teil fokussiert auf die verschiedenen Risikofaktoren, die zur Entstehung psychischer Störungen beitragen. Er beleuchtet genetische Faktoren, prä- und perinatale Einflüsse, soziodemografische Merkmale sowie temperamentsbedingte Variablen und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.
Textteil zu Aufgabe 3
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Planung, Durchführung und Integration von Interventionen zur Behandlung psychischer Störungen. Er diskutiert verschiedene Therapieansätze und deren Wirksamkeit im Hinblick auf die Reduktion von Symptomen und die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Vulnerabilität, Resilienz, bio-psycho-soziales Modell, genetische Faktoren, Umweltfaktoren, soziodemografische Faktoren, Temperament, Persönlichkeit, psychische Störungen, Interventionen, Therapieansätze, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Risikofaktoren für psychische Störungen?
Risikofaktoren sind Einflüsse wie genetische Vorbelastungen, ungünstige Umweltbedingungen oder traumatische Erlebnisse, die die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung erhöhen.
Was versteht man unter Schutzfaktoren?
Schutzfaktoren sind Ressourcen wie soziale Unterstützung oder eine hohe Resilienz, die helfen, Belastungen zu bewältigen und die psychische Gesundheit zu erhalten.
Was erklärt das bio-psycho-soziale Modell?
Es beschreibt die Entstehung psychischer Störungen als ein komplexes Zusammenspiel aus biologischen (Genetik), psychologischen (Temperament) und sozialen Faktoren.
Was ist der Unterschied zwischen Vulnerabilität und Resilienz?
Vulnerabilität bezeichnet die individuelle Verletzlichkeit gegenüber Störungen, während Resilienz die psychische Widerstandsfähigkeit beschreibt.
Wie läuft der diagnostische Prozess in der Psychotherapie ab?
Er unterteilt sich in eine Planungsphase, eine Durchführungsphase und eine Integrationsphase, um eine gezielte Intervention zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Risiko- und Schutzfaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1271776