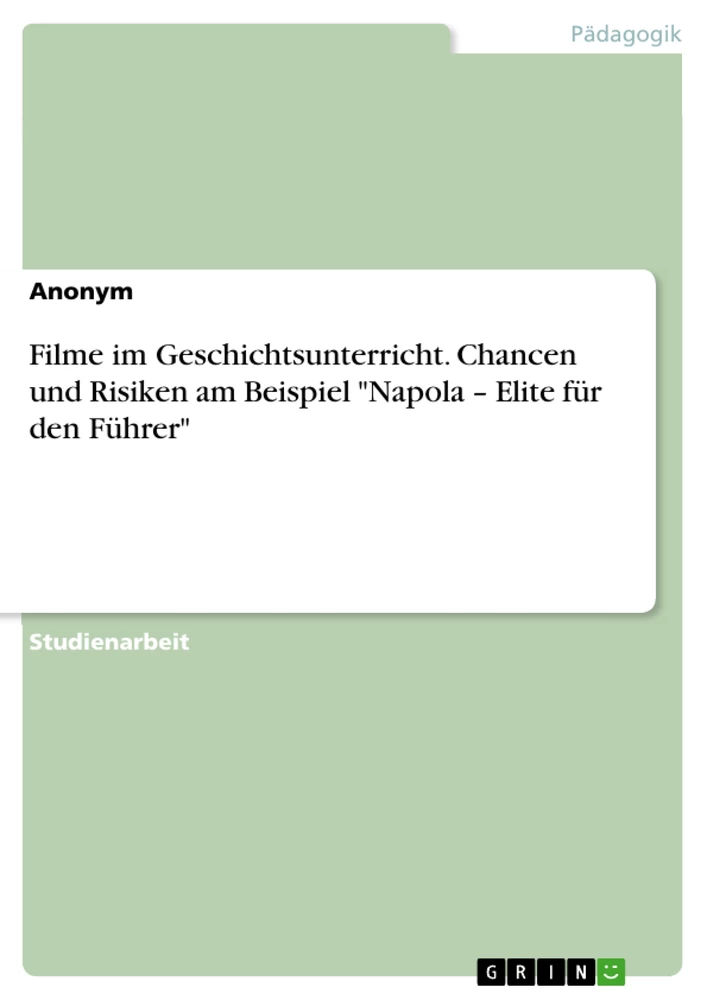Die Hausarbeit setzt sich mit Chancen und Risiken von Filmen im Geschichtsunterricht auseinander und zeigt Konsequenzen für Unterrichtsplanung und -durchführung auf. Anschließend wird ein selbst entworfenes Arbeitsblatt zum Film "Napola - Elite für den Führer" didaktisch präsentiert, begründet und diskutiert. Filme scheinen in vielen Situationen gern gesehen. Dies verwundert nicht: Kinder und Jugendliche verbringen in zunehmendem Alter viel Zeit mit Kommunikationsmedien wie zum Beispiel dem Fernsehen. Dies ist eine Chance, die genutzt werden kann: Filme lassen sich vielfältig für den Unterricht benutzen, ihr Potenzial erschöpft sich nicht in dem bloßen Zeigen eines Films um eine Vertretungsstunde zu füllen.
Viel mehr erfordert das Arbeiten mit filmischem Material besondere Vorbereitung und kann unterschiedliche Lernziele verfolgen: Im Geschichtsunterricht ermöglichen Filme nicht bloß eine ansprechende Darstellung von Geschichte. In der Tat sind vor allem Geschichtsspielfilme, die in den meisten Fällen primär mit der Motivation des Profits, nicht der Bildung, produziert werden, ein äußerst nützliches Mittel, um Dekonstruktionskompetenzen zu erlernen, indem das Material auf enthaltene Daten der Vergangenheit, Konstruktionsmuster, Bedeutungszumessungen und Orientierungsabsichten untersucht wird. Filme ermöglichen jedoch weitaus mehr Erkenntnisse, unter anderem abhängig davon, ob sie als Quelle oder als Darstellung verwendet werden, ob es sich um ein Filmdokument, einen historischen Dokumentar- oder Spielfilm, oder einen heutigen Dokumentar- oder Geschichtsfilm handelt.
Auf den theoretischen Hintergrund von Filmen im Geschichtsunterricht, vor allem auf die Chancen und Risiken und auf die Konsequenzen für den Unterricht soll im folgenden Abschnitt näher eingegangen werden, wobei der Fokus auf dem Genre des Geschichtsspielfilms liegt, da ein solcher in den Abschnitten „3. Empirie“ und „4. Pragmatik“ betrachtet wird. Hierfür wurde der Film „Napola – Elite für den Führer“ von 2004 ausgewählt. Dieser Film, der die Geschichte von Jugendlichen in einer Nationalpolitischen Erziehungsanstalt erzählt, soll im Abschnitt „Empirie“ auf die Darstellung von Geschichte überprüft und analysiert werden, um dann im Abschnitt „Pragmatik“ ein Arbeitsblatt zu dem Film vorzustellen und zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Chancen und Risiken des Einsatzes von Geschichtsspielfilmen im Unterricht
- Konsequenzen für die Unterrichtsplanung und -durchführung
- Empirie
- Pragmatik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes von Geschichtsspielfilmen im Geschichtsunterricht. Der Fokus liegt auf dem Genre des Geschichtsspielfilms und dem Film "Napola - Elite für den Führer" als Beispiel.
- Chancen und Risiken des Einsatzes von Geschichtsspielfilmen im Unterricht
- Entwicklung von Dekonstruktionskompetenzen
- Analyse von Konstruktionsmustern und Bedeutungszumessungen in Filmen
- Vermittlung historischer Narrative
- Kritische Auseinandersetzung mit filmischen Geschichtsdarstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Film im Geschichtsunterricht" dar und beleuchtet die vielfältigen Möglichkeiten, die Filme im Unterricht bieten. Der Fokus liegt auf Geschichtsspielfilmen, die sich als nützliches Mittel zur Förderung von Dekonstruktionskompetenzen erweisen können.
Theorie
Der Abschnitt "Theorie" behandelt die Chancen und Risiken, die mit dem Einsatz von Geschichtsspielfilmen im Unterricht einhergehen. Es wird betont, dass Filme die historische Realität nicht vollständig abbilden können und ein kritischer Umgang mit dem Medium notwendig ist. Zudem wird die Wichtigkeit der Dekonstruktionskompetenz im Geschichtsunterricht hervorgehoben.
Chancen und Risiken des Einsatzes von Geschichtsspielfilmen im Unterricht
Dieser Abschnitt untersucht die Möglichkeiten, die der Einsatz von Filmen im Unterricht bietet, und die damit verbundenen Herausforderungen. Es wird erläutert, dass Filme zwar nicht die historische Realität wiedergeben können, aber dennoch ein wertvolles Werkzeug zur Vermittlung von Geschichte sind. Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Darstellung und Quelle sowie der verschiedenen Narrationsformen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Geschichtsspielfilme, Dekonstruktionskompetenz, Konstruktionsmuster, Geschichtskultur, Narrative Kompetenz, Unterrichtsplanung, Geschichtsunterricht, Napola - Elite für den Führer.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Filme für den Geschichtsunterricht wertvoll?
Filme bieten eine ansprechende Darstellung von Geschichte und sind ein hervorragendes Mittel, um Dekonstruktionskompetenzen bei Schülern zu fördern.
Was versteht man unter "Dekonstruktionskompetenz"?
Es ist die Fähigkeit, filmisches Material kritisch auf enthaltene Daten, Konstruktionsmuster und die Absichten der Filmemacher hin zu untersuchen.
Welche Risiken birgt der Einsatz von Geschichtsspielfilmen?
Filme werden oft für Profit statt für Bildung produziert und können historische Fakten verzerren oder einseitige Narrative vermitteln, wenn sie nicht kritisch hinterfragt werden.
Worum geht es in dem Film "Napola – Elite für den Führer"?
Der Film thematisiert die Erziehung und Indoktrination von Jugendlichen in einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt während der NS-Zeit.
Wie sollte die Unterrichtsplanung für Filmarbeit aussehen?
Sie erfordert eine gezielte Vorbereitung, die über das bloße Zeigen hinausgeht und Arbeitsblätter zur Analyse der filmischen Darstellung umfasst.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Filme im Geschichtsunterricht. Chancen und Risiken am Beispiel "Napola – Elite für den Führer", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1254825