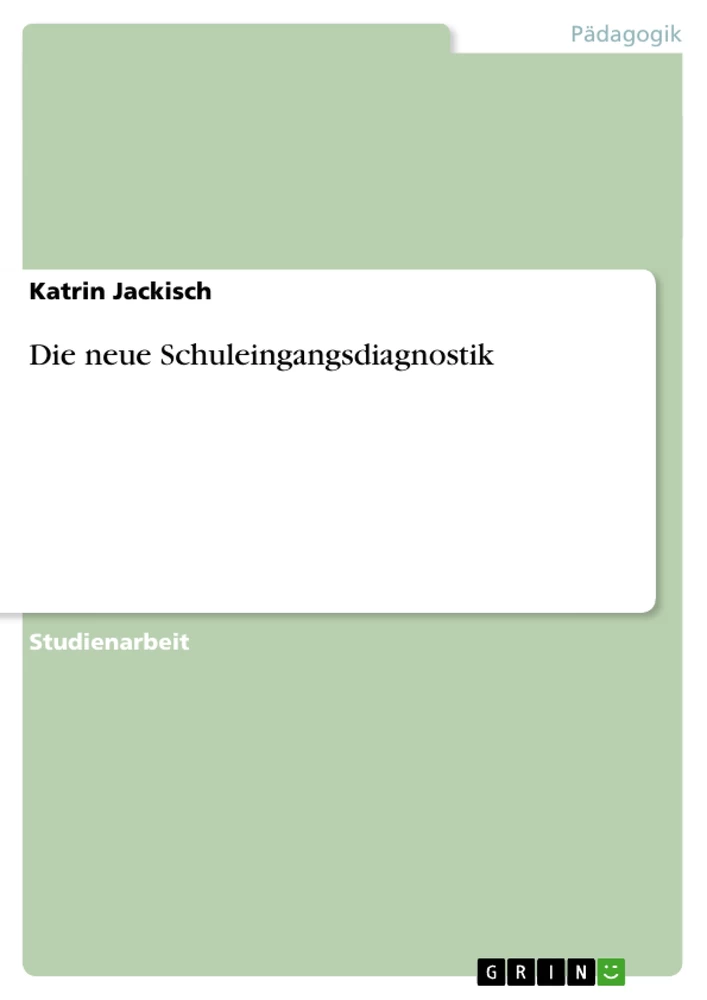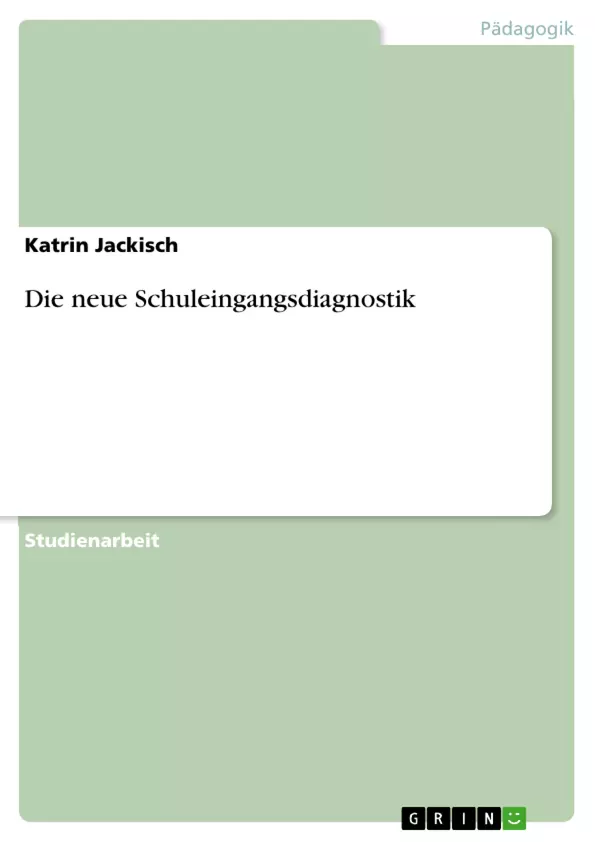Vor wenigen Jahren wäre die Frage nach einer Reform des Schulanfangs mit verständnislosem Staunen aufgenommen worden. Haben wir nicht ein bewährtes Konzept für den Schulanfang?
Im Mai 1994 verabschiedete die Kulturministerkonferenz die Neufassung der „Empfehlung zur Arbeit in der Grundschule“; sie enthalten zwar vielfältige Hinweise zum Schulanfang und Anfangsunterricht, aber das derzeit in allen Bundesländern praktizierte Konzept der Einschulung wird in seiner Grundstruktur nicht in Frage gestellt. In den Empfehlungen heißt es lediglich: „Mit der Zunahme individueller schulischen Förderangebote wird die Notwendigkeit zur Zurückstellung vom Schulbesuch verringert werden“.
Ein gutes Jahr später erteilt die Kulturministerkonferenz einen Auftrag an den Schulausschuss: Die gegenwärtige Einschulungspraxis soll aufgezeichnet werden und „Vorschläge für eine Verbesserung des Eintritts in die Schule erarbeitet werden“. Die gegenwärtige Struktur und der geistige Entwurf des Eintritts in die Schule werden als reformbedürftig angesehen.
In verschiedenen Bundesländern werden Schulversuche zur Neukonzeption der Schuleingangsstufe eingerichtet. Es zeichnet sich bereits nach einer kurzen und intensiven Diskussion ein bundesweiter Konsens dahingehend ab, dass die Zurückstellungen von schulpflichtigen Kindern weitgehend abgebaut und auf die Aufnahme von noch nicht schulpflichtigen Kindern auf Antrag der Eltern erleichtert werden soll.
In ihrer 280. Plenarsitzung am 23./24.10.1997 beschließt die Kulturministerkonferenz die „Empfehlung zum Schulanfang“. Die Empfehllungen haben das Ziel, Maßnahmen in den Ländern zu ermöglichen, die zur Reduktion der teilweise hohen Zurückstellungsquoten beitragen und Eltern zur vorzeitigen Einschulung ihrer Kinder ermutigen. Der Beschluss ermöglicht es den Ländern aber auch, durch eine Veränderung des Stichtages für die Einschulung regulär mehr Kinder eines Jahrganges einzuschulen
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Zielsetzungen und Entstehungsgeschichte
- Unterschiedliche Organisationsformen
- Altersmischung
- Didaktik und Methodik jahrgangsübergreifender Lerngruppen
- Halbjährliche Einschulung
- Verweildauer
- Sozialpädagogische Arbeit
- Förderdiagnostik
- Fortbildung
- Zurückstellungen, vorzeitige Einschulungen und Schuleintrittsalter
- Auswirkung auf die nachfolgenden Schulstufen
- Die neue Schuleingangsstufe in einigen Bundesländer
- Baden-Würtenberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Hamburg
- Veränderte Anforderungen an die Lehrkräfte
- Arbeiten im Team
- Förderdiagnostische Kompetenz
- Jahrgangsübergreifende Arbeit
- Fazit
- Literaturhinweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der neuen Schuleingangsstufe in Deutschland. Sie analysiert die Gründe für die Reform der Einschulungspraxis und beleuchtet die unterschiedlichen Konzepte und Modelle der neuen Schuleingangsstufe in verschiedenen Bundesländern. Die Arbeit untersucht auch die Auswirkungen der Reform auf die Anforderungen an die Lehrkräfte und die pädagogische Arbeit in der Grundschule.
- Reform der Einschulungspraxis und der neuen Schuleingangsstufe
- Unterschiedliche Organisationsformen und Modelle der neuen Schuleingangsstufe
- Auswirkungen der Reform auf die Anforderungen an die Lehrkräfte
- Didaktik und Methodik jahrgangsübergreifender Lerngruppen
- Sozialpädagogische Arbeit und Förderdiagnostik in der neuen Schuleingangsstufe
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Dieses Kapitel erläutert die Entstehung der neuen Schuleingangsstufe vor dem Hintergrund der Reformdebatte um die Einschulungspraxis in Deutschland. Es zeigt die Notwendigkeit einer Veränderung der bestehenden Praxis und die verschiedenen Perspektiven auf die neuen Schuleingangsstufen.
Zielsetzungen und Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Zielsetzung der neuen Schuleingangsstufe, die Reduktion der Zurückstellungsquoten und die Förderung der individuellen Entwicklung von Schulkindern. Es werden die verschiedenen fachlichen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen Diskussionspunkte erläutert, die die Entwicklung der neuen Schuleingangsstufe beeinflusst haben.
Unterschiedliche Organisationsformen: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Organisationsformen der neuen Schuleingangsstufe, die sich in den Bundesländern unterscheiden. Es werden die segregative und integrative Strategie der Einschulung beleuchtet und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
Altersmischung: Dieses Kapitel behandelt die Frage der Altersmischung in der neuen Schuleingangsstufe. Es werden die Auswirkungen der Altersmischung auf die pädagogische Arbeit und die Lernentwicklung der Kinder diskutiert.
Didaktik und Methodik jahrgangsübergreifender Lerngruppen: Dieses Kapitel beschreibt die didaktischen und methodischen Ansätze, die in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in der neuen Schuleingangsstufe angewendet werden. Es werden die Herausforderungen und Möglichkeiten der Arbeit mit unterschiedlichen Lerngruppen im Kontext der neuen Schuleingangsstufe beleuchtet.
Halbjährliche Einschulung: Dieses Kapitel setzt sich mit der Frage der halbjährlichen Einschulung auseinander. Es werden die Vor- und Nachteile der halbjährlichen Einschulung im Vergleich zur traditionellen Einschulung zum Schuljahresbeginn diskutiert.
Verweildauer: Dieses Kapitel behandelt die Flexibilisierung der Verweildauer in der neuen Schuleingangsstufe. Es werden die verschiedenen Verweildauermodelle in den Bundesländern und deren Auswirkungen auf die Lernentwicklung der Kinder diskutiert.
Sozialpädagogische Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Bedeutung der sozialpädagogischen Arbeit in der neuen Schuleingangsstufe. Es werden die verschiedenen Aufgaben und Schwerpunkte der sozialpädagogischen Arbeit und deren Beitrag zur Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung der Kinder erläutert.
Förderdiagnostik: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Förderdiagnostik in der neuen Schuleingangsstufe. Es werden die verschiedenen diagnostischen Verfahren und deren Anwendung in der pädagogischen Praxis erläutert.
Fortbildung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Fortbildung von Lehrkräften im Kontext der neuen Schuleingangsstufe. Es werden die spezifischen Fortbildungsbedarfe der Lehrkräfte und die Inhalte der Fortbildungsprogramme vorgestellt.
Zurückstellungen, vorzeitige Einschulungen und Schuleintrittsalter: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Zurückstellungen und vorzeitigen Einschulungen im Kontext der neuen Schuleingangsstufe. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die verschiedenen Entscheidungskriterien für die Einschulung diskutiert.
Auswirkung auf die nachfolgenden Schulstufen: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der neuen Schuleingangsstufe auf die nachfolgenden Schulstufen. Es werden die Herausforderungen und Chancen der Übergänge zwischen den Schulstufen im Kontext der neuen Schuleingangsstufe beleuchtet.
Die neue Schuleingangsstufe in einigen Bundesländer: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Umsetzung der neuen Schuleingangsstufe in einigen Bundesländern. Es werden die spezifischen Modelle und die Erfahrungen mit der neuen Schuleingangsstufe in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg und Hamburg vorgestellt.
Veränderte Anforderungen an die Lehrkräfte: Dieses Kapitel analysiert die veränderten Anforderungen an die Lehrkräfte im Kontext der neuen Schuleingangsstufe. Es werden die spezifischen Kompetenzen und Fähigkeiten, die Lehrkräfte für die Arbeit in der neuen Schuleingangsstufe benötigen, erläutert.
Fazit: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der neuen Schuleingangsstufe.
Schlüsselwörter
Schuleingangsdiagnostik, neue Schuleingangsstufe, Einschulung, Schulfähigkeit, Integration, Heterogenität, Förderdiagnostik, jahrgangsübergreifender Unterricht, Altersmischung, Zurückstellung, vorzeitige Einschulung, Lehrkräfte, Fortbildung.
- Arbeit zitieren
- Katrin Jackisch (Autor:in), 2002, Die neue Schuleingangsdiagnostik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12219