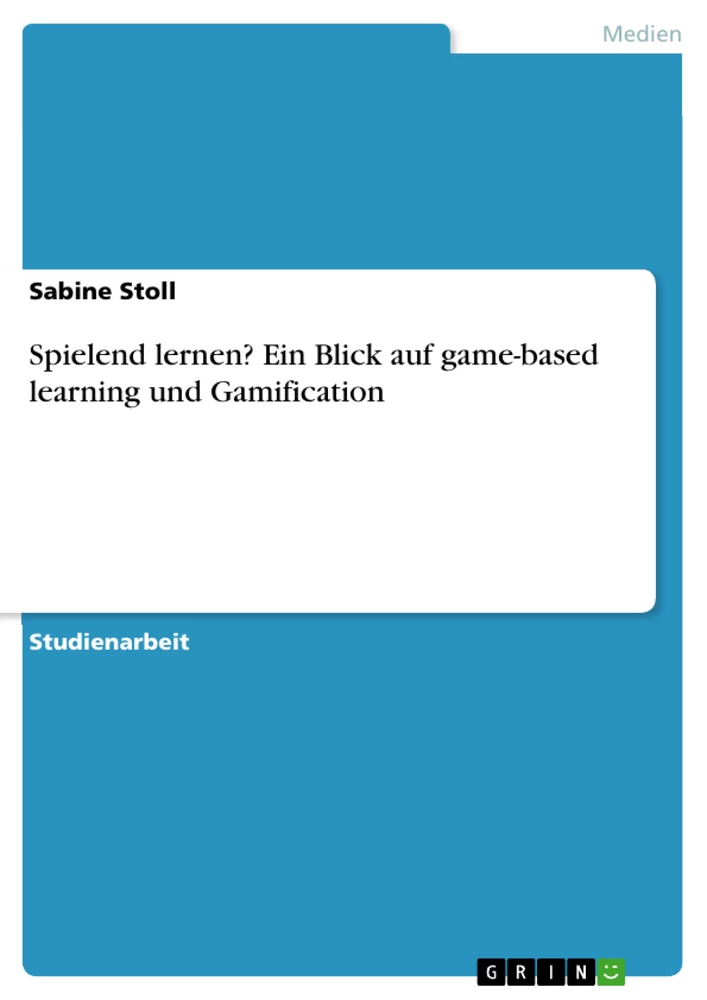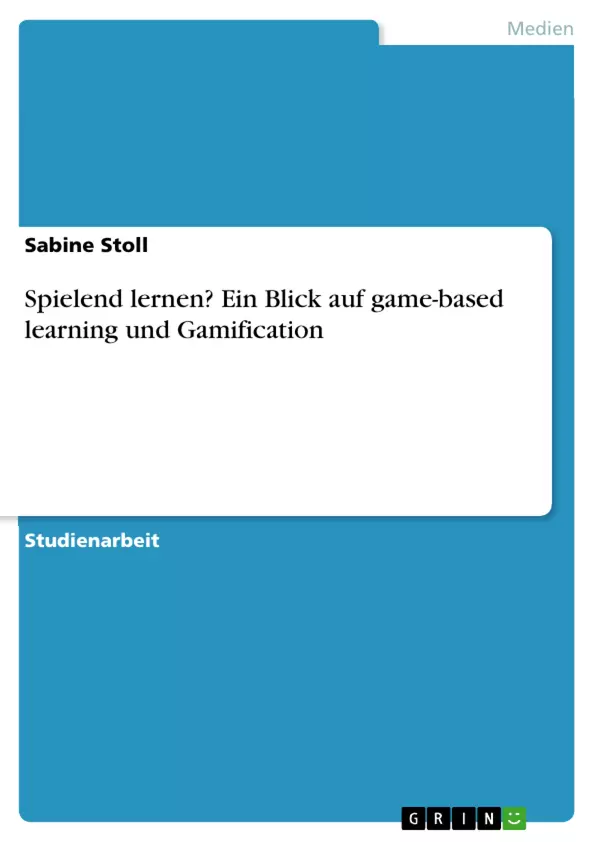Die steigende Verbreitung von Multimedia und Internet hat nicht nur massiven Einfluss auf Alltag und Freizeitgestaltung, sondern nimmt ebenso Einfluss auf moderne Lernprozesse in allen Bereichen, von der schulischen Ausbildung bis zur betrieblichen Weiterbildung. Gleichzeitig mit dieser “elektronischen Revolution” ging auch eine Digitalisierung der Spielwelt einher, verbunden mit der steigenden Bedeutung des Freizeitbereichs. Lernen ist damit nicht nur zu einem digitalen multimedialen Lernen geworden, sondern zugleich zu einem spielerischen Lernen. Modernes Lernen soll Spaß machen und die Lernenden aktiv in den Lernprozess einbeziehen. Genau um dies zu realisieren, gibt es ein wachsendes Angebot an sogenannten Serious Games bzw. Game-Based Learning.
Spielen ist dabei keine Erfindung der Neuzeit, sondern Spiel und Wettbewerb lassen sich in lange zurückliegenden Menschheitsepochen finden. So gab es bereits im siebten Jahrhundert Spiele, die militärische Aktionen nachahmten. Gerade in den letzten Jahren haben sich Computerspiele zu einem bedeutenden Teil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens entwickelt. Ein Grund für diese Entwicklung ist das zunehmende Maß an Freizeit, welche immer mehr Menschen zur Verfügung steht. Dieser Trend betrifft alle gesellschaftlichen Gruppen, ist also unabhängig von Alter und sozialer Herkunft. Spiele sind dabei nicht nur im Freizeitbereich von zunehmender Bedeutung, sondern gerade auch im Bereich von Aus- und Weiterbildung in Form sogenannter Serious Games. Gerade durch die rasante Verbreitung des mobilen Webs und der zunehmenden Zahl an mobilen Clients sind Gamification ebenso wie Game-Based Learning nicht mehr wegzudenkende Komponenten. Dabei geht es nicht nur um traditionelle Lernspiele, sondern auch um die Bearbeitung von seriösen Inhalten, die den Rezipient/innen spielerisch mittels Gamification näher gebracht werden. Dennoch sind bei der Verwendung von Gamifizierungsmethoden im Bereich E- Learning Kommunikations- und Medientheorien, Zielgruppen oder aktuelle Trends von enormer Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Gamification
- Serious Games
- Game-Based Learning
- Empirische Befunde
- Gamification
- Ziele und Schwierigkeitsgrad
- Regeln
- Belohnungssystem
- Feedback
- Levels
- Storytelling
- Flow und intrinsische Motivation
- Design und Ästhetik
- Grenzen und Potentiale
- Praktische Beispiele
- Kassenspiel
- Rails for Zombies
- Vipol
- Grenzen
- Quellen
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Einsatz von spielerischen Elementen im Lernprozess. Sie analysiert die Entwicklung und Anwendung von Game-Based Learning und Gamification und beleuchtet deren Potenziale und Grenzen. Der Fokus liegt dabei auf den didaktischen Möglichkeiten und den Auswirkungen auf die Lernmotivation und den Lernerfolg.
- Definition und Abgrenzung von Game-Based Learning und Gamification
- Empirische Befunde zur Wirksamkeit von spielbasierten Lernformen
- Analyse von Gestaltungsprinzipien und Designaspekten
- Bewertung von Grenzen und Herausforderungen
- Vorstellung von konkreten Anwendungsbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung von Medien und digitalen Spielen im modernen Lernprozess. Kapitel 2 befasst sich mit der Begriffsbestimmung von Gamification und Game-Based Learning und erläutert die grundlegenden Konzepte. Kapitel 3 stellt empirische Befunde zur Wirksamkeit von Gamification vor, wobei insbesondere die Gestaltungselemente von Spielen im Fokus stehen. In Kapitel 4 werden die Grenzen und Potentiale von Game-Based Learning und Gamification im Detail analysiert. Abschließend werden in Kapitel 5 einige praktische Beispiele für den Einsatz von Spieltechniken im Lernkontext vorgestellt.
Schlüsselwörter
Game-Based Learning, Gamification, Serious Games, Digitalisierung, Lernen, Motivation, Didaktik, E-Learning, Medienpädagogik, Spieltheorie, Empirische Forschung
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Gamification und Serious Games?
Gamification nutzt spieltypische Elemente in spielfremden Kontexten, während Serious Games vollständige Spiele sind, die primär zur Wissensvermittlung statt zur Unterhaltung entwickelt wurden.
Wie beeinflusst Game-Based Learning die Motivation?
Durch Belohnungssysteme, Feedback und Storytelling wird die intrinsische Motivation gesteigert und der Lernende in einen „Flow“-Zustand versetzt.
In welchen Bereichen wird spielerisches Lernen eingesetzt?
Die Einsatzgebiete reichen von der schulischen Ausbildung bis zur betrieblichen Weiterbildung (z.B. Kassenspiele oder Programmier-Lernplattformen wie „Rails for Zombies“).
Welche Rolle spielt die Digitalisierung beim Lernen?
Die Verbreitung von Multimedia, Internet und mobilen Endgeräten ermöglicht den ständigen Zugriff auf spielerische Lerninhalte und fördert modernes E-Learning.
Gibt es Grenzen bei der Anwendung von Gamification?
Ja, die Arbeit beleuchtet auch die Grenzen, wie etwa die Gefahr einer oberflächlichen Beschäftigung oder die Abhängigkeit von der richtigen Zielgruppenansprache.
- Quote paper
- Sabine Stoll (Author), 2014, Spielend lernen? Ein Blick auf game-based learning und Gamification, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1195454