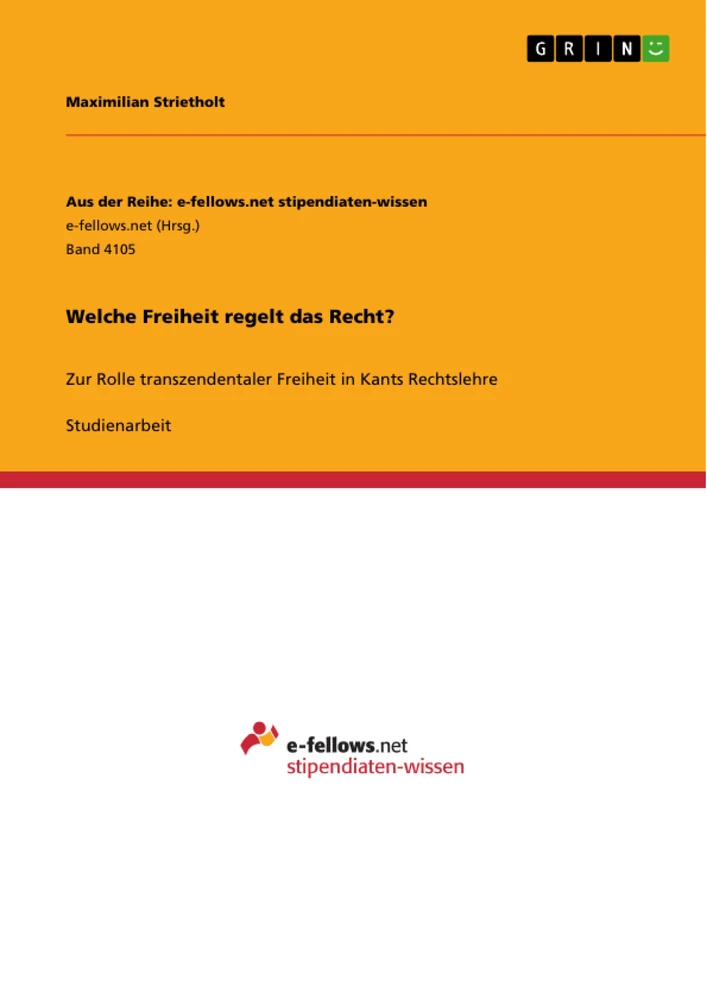Der Begriff des Rechts scheint unauflöslich mit dem der Freiheit verknüpft zu sein. Wir können eine Handlung offensichtlich nur dann sinnvoll als unrecht bezeichnen, wenn wir auch annehmen dürfen, dass der Täter die Möglichkeit hatte, anders zu handeln. Gleichzeitig ist es alles andere als eindeutig, wie das Verhältnis von Freiheit und Recht genau zu verstehen ist. Rechtsnormen, so scheint es, sollten unabhängig von spezifischen philosophischen Positionen über den freien Willen Gültigkeit beanspruchen können und daher ohne Rekurs auf kontroverse ontologische Annahmen dieser Art formuliert werden. Dieses Spannungsfeld spiegelt sich prägnant in der Rezeption von Kants Rechtslehre wider. Während Vertreter der Trennungsthese bestreiten, dass Kants Rechtsbegriff den transzendentalen Begriff von Freiheit, der seiner Moralphilosophie zu Grunde liegt, zur Voraussetzung hat, wird genau diese These von Verfechtern der Abhängigkeitsthese vehement verteidigt.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Argument zu Gunsten der Trennungsthese zu entwickeln, welches ich das Argument der epistemischen Opazität nennen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kants Theorie der Freiheit
- Wertteleologische und verbindlichkeitstheoretische Rechtsbegründungen
- Die epistemische Opazität der Freiheit
- Ein enigmatischer Rechtsbegriff?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Kants Rechtsphilosophie, insbesondere die Rolle des transzendentalen Freiheitsbegriffs, um ein Argument für die Trennungsthese zu entwickeln. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Kants Rechtsbegriff von der transzendentalen Freiheit abhängt oder ob er eigenständig ist.
- Kants Theorie der Freiheit
- Wertteleologische und verbindlichkeitstheoretische Rechtsbegründungen
- Die epistemische Opazität der Freiheit
- Der Zusammenhang zwischen Freiheit und Rechtsbegriff
- Die Rolle des politischen Prozesses in der Rechtsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Debatte um die Beziehung zwischen Freiheit und Recht in Kants Rechtslehre dar und präsentiert das Ziel der Arbeit, ein Argument für die Trennungsthese zu entwickeln.
- Kants Theorie der Freiheit: Dieses Kapitel behandelt Kants Freiheitsbegriff, insbesondere die Unterscheidung zwischen negativem und positivem Freiheitsbegriff. Es stellt dar, dass Kant Freiheit als das Vermögen definiert, nicht von sinnlichen Antrieben determiniert zu sein.
- Wertteleologische und verbindlichkeitstheoretische Rechtsbegründungen: Dieses Kapitel präsentiert zwei prominente Begründungsstrategien, mit denen Vertreter der Abhängigkeitsthese einen Zusammenhang zwischen transzendentaler Freiheit und Rechtsbegriff herstellen.
- Die epistemische Opazität der Freiheit: Dieses Kapitel entwickelt das Argument der epistemischen Opazität, das gegen die Abhängigkeitsthese argumentiert und die Trennungsthese stützt. Es argumentiert, dass die transzendentale Freiheit nicht direkt beweisbar ist und deshalb keine Grundlage für die Rechtsfindung liefern kann.
- Ein enigmatischer Rechtsbegriff?: Dieses Kapitel verteidigt die Trennungsthese gegen die potentielle Kritik, wonach diese zu einem technokratischen und normativ leeren Rechtsverständnis führt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Kants Rechtslehre, transzendentale Freiheit, Trennungsthese, epistemische Opazität, Wertteleologie, Verbindlichkeitstheorie, Rechtsbegründung, politischer Prozess, Rechtsfindung.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Strietholt (Autor:in), 2021, Welche Freiheit regelt das Recht?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1187511