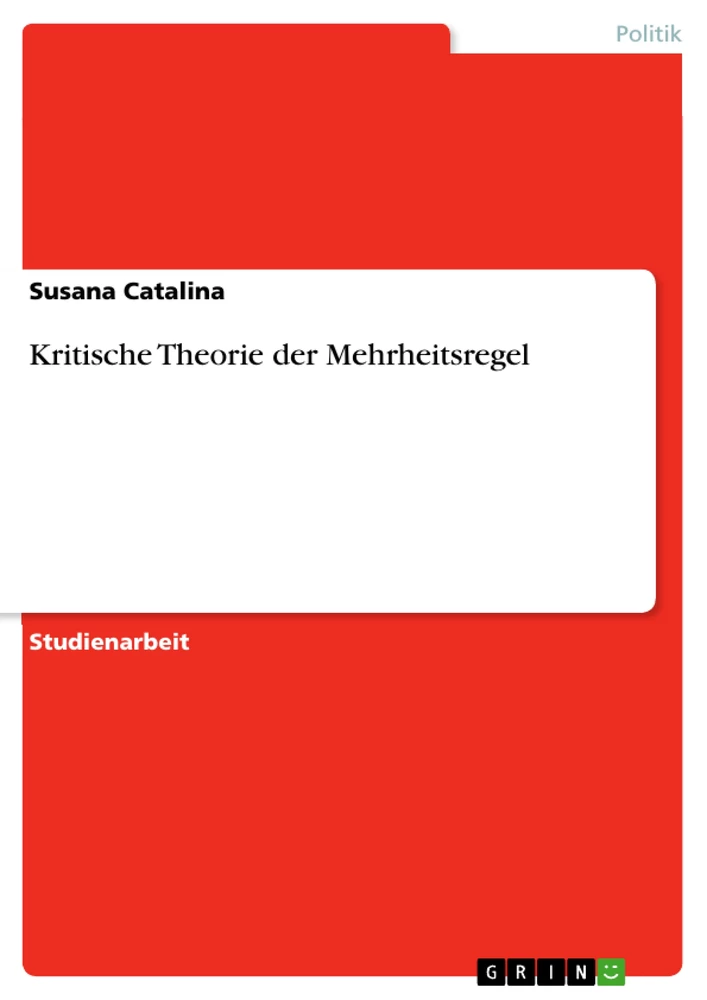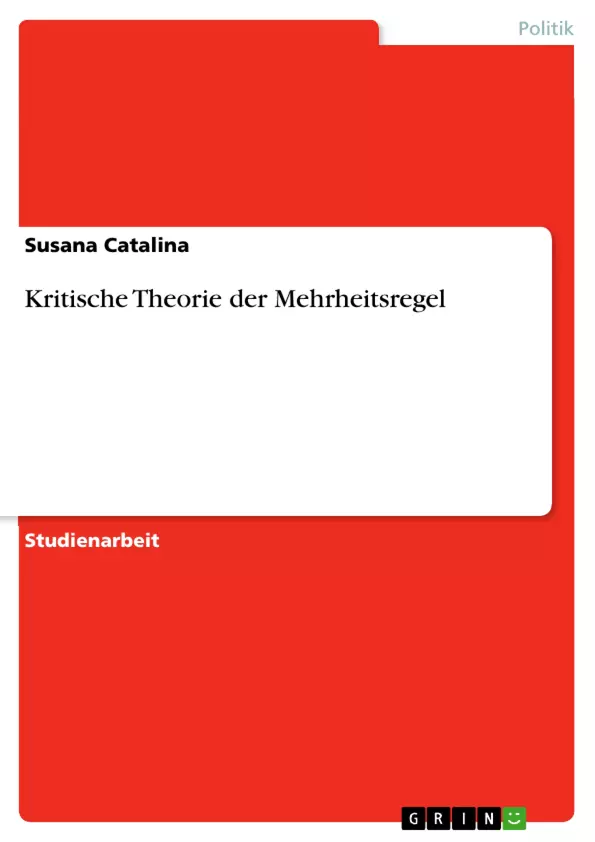Kritische Theorie der Mehrheitsregel 1
1. Einleitung
Bevor man sich mit der „Kritischen Theorie der Demokratie“ befaßt, sollte geklärt werden, daß es sich hierbei nicht um „Die eine Theorie“ handelt, sondern um eine Vielzahl von gesammelten Schriften, die sich alle im Laufe der Jahre - hauptsächlich im Exil entstanden - kritisch mit der Demokratie auseinandersetzten. Die Hauptvertreter der Kritischen Theorie, unter anderem Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Friedrich Pollock gehen alle aus der „Frankfurter Schule“ hervor, die auch den Begriff der „Kritischen Theorie“ geschaffen hat. Dennoch finden auch andere Vertreter Beachtung, die alle miteinander zweierlei gemeinsam haben: erstens, die schonungslos kritische Analyse demokratischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse und zweitens den Vorwurf an die Adresse konkurrierender Demokratietheorien, daß diese die Wertigkeit, Strukturdefekte und Folgeprobleme übersähen.1 Die Kritische Theorie gelangte in den siebziger Jahren zu ihrem Höhepunkt, nachdem sie - zuvor nur als philosophische Richtung bekannt - anfing, sich um ihre eigene wissenschaftstheoretische Begründungsfähigkeit zu kümmern und ihre Inhalte in der Fachterminologie moderner Kommunikations- und Demokratietheorien „reformierte“.2
Die Kritische Demokratietheorie stützt sich auf zwei Pfeiler. Der erste basiert auf theoretisch und empirisch orientierten Beiträgen zum Problem der Transformation individueller Präferenzen in Gruppen- oder Kollektiventscheidungen.3Der zweite Pfeiler der kritischen Demokratietheorie entstammt der kapitalismus- und demokratischen Politiktheorie und Verfassungssoziologie.4
In dieser Arbeit soll explizit auf die kritische Theorie der Mehrheitsregel eingegangen werden, für die in der deutschsprachigen Diskussion vor allem Beiträge von Claus Offe und Bernd Guggenberger maßgebend sind.
2. Kritik an der Mehrheitsregel
Das Mehrheitsprinzip ist bekanntlich eine Basisinstitution zur Herstellung von Kollektiventscheidungen.5Dennoch findet die Mehrheitsregel nicht nur Anhänger. Die kritische Theorie der Mehrheitsregel unterscheidet sich jedoch in dem Punkt, daß sie den Verstand nicht nur bei wenigen vermutet, wie elitäre Gesinnte verlauten ließen, ihr Bezugspunkt ist kritisch gewendeter Funktionalismus.6Die Theorie und Praxis der Mehrheitsregel wird von ihr vor allem daraufhin untersucht, ob - und wenn ja, in welcher Weise - die Mehrheitsregel den selbstgesetzten egalitären Anspruch durchkreuzt und unterminert. Die kritische Theorie der Mehrheitsregel basiert vor allem auf sieben Thesen:7
- Mehrheiten sind in der Regel schwankend, fehlbar und verführbar, weil geringfügige Variationen unterschiedliche Abstimmungsergebnisse erzielen können.
- Sie zählt die Stimmen, ohne diesen ein Gewicht beizumessen („one man, one vote“). Dies sei aber Fiktion.
- Vermischung des privaten und des öffentlichen Bereichs. Durch diese Vermischung entsteht das Folgeproblem, daß die Mehrheitsregel nicht mehr ausschließlich auf den öffentlichen Sektor angewendet werden kann. · Extreme Zeitpunktbezogenheit. Momentane Stimmungen, Ereignisse und Kalküle werden zur Basis zukunftsfähigen Handelns.
- Verletzung des Grundsatzes revidierbarer, reversibler und korriegierbarer Entscheidungen.
- Wachsende Diskrepanz zwischen Beteiligten und Betroffenen sowie
zwischen Entscheidungszuständigkeit und Entscheidungsreichweite. Die Lücke zwischen diesen Kreisen sei, gemäß den Kritikern, durch die Eingriffe des Sozial- und Interventionsstaates größer geworden.
- Spannung zwischen privater und öffentlicher Politik.
Mehrheitsentscheidungen haben nur dann verpflichtende Kraft, wenn sie sich ausschließlich auf öffentliche Angelegenheiten in ihrem vollem Umfang erstrecken. Eben diese Bedingung sei nicht erfüllt.
2.1 Schwankende Mehrheiten
Der Kern dieser These ist die Frage, ob individuelle Präferenzen überhaupt verfälschungsfrei zu Gruppen- oder Kollektiventscheidungen umgeformt werden können. Nach den Hauptkritikern kann bei der Mehrheitsentscheidung nicht die Rede vom Willen des Volkes sein. Bei den Mehrheiten handelt es sich meistens um aus unterschiedlichen Motiven gebildeten Entscheidungen, die von Institutionen der Willensbildung geprägt sind. Die Mehrheit sei nämlich, so Offe, „fehlbar und verführbar“8Schon unter geringfügig variierten Bedingungen hätten bei einer Mehrheitsentscheidung andere Alternativen Gegenstand der Abstimmung sein können und die Zustimmung einer Mehrheit erhalten können. Der Wert der Demokratie liegt also nicht in der Konsistenz, die nach den Kritikern sowieso nicht gegeben ist, sondern in der Projektion von Rechten mittels Vetos, die auferlegt werden können.9Des weiteren führen die Kritiker als Manko der Mehrheitsfindung das Condorcet-Paradoxon (siehe Anhang), unter dem wandernde oder zyklische Mehrheiten und das Ostrogorski-Paradoxon, in dem die „Tyrannei der Mehrheit“ angesprochen werden auf. Die zyklische Mehrheit wird am Beispiel von 3 Wahlpräferenzen deutlich. (A, B, C) Die Präferenzen sind A>B>C, C>A>B, B>C>A. Wenn man alle drei Möglichkeiten berücksichtigt gewinnt jeweils eine Präferenz mit 2:1. Es gewinnt aber nie eindeutig eine. Keine Abstimmung ist somit konsistent und verfälschungsfrei. Die „Tyrannei der Mehrheit“ bezieht sich darauf, daß unter bestimmten Voraussetzungen die Demokratie zur Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit führen kann. Dies zeigt das Ostrogorski-Paradoxon auf, bei dem klar wird, daß die Art der Auszählung entscheidet (siehe Anhang). Durch diese beiden Darstellungen wird klar, daß das Ideal einer Bündelung individueller Präferenzen zu unverfälschten Aussagen verfehlt wird. Dies könnte nur durch einen Konsens mit Vetorecht ermöglicht werden.
Varain führt noch eine andere Art der „Tyrannei der Mehrheit“ auf.10Hierbei handelt es sich um eine Abstimmung im bereits vom Volk gewählten Parlament. Im Regelfall ist festgelegt, daß die Beschlußfähigkeit der Parlamente bei Anwesenheit der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl gegeben ist, und daß zu einem Beschluß die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. In Varains Beispiel kann nun also ein Parlament, dem 100 Abgeordnete angehören, im Extremfall ein Beschluß von nur 26 Abgeordneten gefaßt werden.
2.2 Fiktion abstrakter Teilhabegleichheit
Die Stimmengleichheit „one man, one vote“ sei Fiktion, so die Kritiker. Denn dies würde voraussetzen, daß jeder Abstimmungsberechtigte Bürger das gleiche Niveau an Sachkenntnis besäße. Dies ist jedoch bei der breiten, durch Massenmedien beeinflußte Menge der Abstimmungsberechtigten Bürger nicht der Fall. Die Mehrheit entscheidet somit meist eine Menge beeinflußbarer Bürger, die eben das wählen, was ihnen vorgegeben wird. Die liberale Demokratie lebt also Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann; oder anders formuliert, kann das demokratische System die Sorte von Akteuren, die es zur Realisierung seiner Regeln benötigt nicht selbst produzieren.11
Als weiteres Beispiel gegen den Glauben, jede Stimme hätte das gleiche Gewicht läßt sich aufführen, daß bestimmte Formen von Interessen sich nicht in der Parteienlandschaft wiederfinden. Man könnte zwar sagen, daß sich die so oft erwähnten Arbeiter der SPD eher zugezogen fühlen, jedoch nicht immer unbedingt von ihr repräsentiert werden. Während die Arbeiterfront noch immerhin in den schwächelnden aber doch einflußreichen Gewerkschaften halbwegs repräsentiert werden, haben andere sozialpolitische Verbände keine so starke Lobby. Selbst die Umweltverbände von denen man meinen könnte, sie seien ausreichend repräsent haben im Vergleich zur Wirtschaft weniger Gewicht.12
Varain führt noch das Problem der Sitzverteilung im Parlament als Beispiel der unterschiedlichen Stimmenzählung auf und nimmt hierzu die Wahlen von 1953 und 1959 in Österreich als Beispiel.13Weil die Streuung der Mandate über das Land sich nach der Streuungsdichte der Einwohner richtet, werden die kinderreichen, ländlichen Gebiete vor den Städten im Hinblick auf die jeweils ansässige wahlberechtigte Bürgerschaft, die die eigentliche Wahlkörperschaft darstellt, bei der Mandatszuteilung bevorzugt. So erreichte in diesem Fall die Volkspartei jeweils einen Parlamentssitz mehr als die Sozialistische Partei. Auch in den USA konnte man in diesem Jahr bei dem eigenartigen Wahldebakel feststellen, daß Stimmen aus bestimmten Gebieten mehr zählen als andere.
2.3 Vermischung des privaten und öffentlichen Bereichs
„Alle neuzeitlichen Kommentatoren stimmen darin überein, daß das Mehrheitsprinzip eine Entscheidungsregel ist, die für den ,öffentlichen´ oder den ,politischen´ Bereich der menschlichen Angelegenheiten gilt, nicht jedoch für einen hiervon zu unterscheidenden Bereich ,privater´ Disposition.“14Offe führt jedoch sofort Gegenbeispiele zu dieser These an. Zuerst beschäftigt er sich jedoch mit den Gründen für die Trennung dieser Bereiche. Die sachliche Beschränkung des Mehrheitsprinzips auf öffentliche Angelegenheiten sei meist unter dem liberalen Gesichtspunkt des Schutzes von Freiheit und Eigentum gefordert worden, zum Teil aber auch zum Schutze des Mehrheitsprinzips selbst: würde das Mehrheitsprinzip auch die Verteilung von privaten Gütern regeln, würde sich keine Minderheit finden, die lange stillschweigend alles hinnehmen würde. Für die Kritiker existiert jedoch eine breiter Überschneidungsbereich zwischen der Sphäre des Entfaltungsbereich und der privaten Autonomie und der, der öffentlichen Angelegenheiten. Beispiele für diese Überschneidungsgebiete sind Beschlüsse über den Abriß bzw. die Sanierung städtischer Wohngebiete, über die Ansiedlung umweltschädlicher Industrien, die Frage der Abtreibung, die Probleme des gesundrechtlichen Freiheitschutzes bei sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen, Probleme der polizeilichen Überwachung und Strafverfolgung, Fragen des Datenschutzes und ähnliche Problemlagen, bei denen typischerweise der Konflikt nicht der zwischen einer Minderheit und einer Mehrheit ist, sondern sich vielmehr um vorgelagerte Fragen dreht: ob das Entscheidungsthema überhaupt eines ist, das nach der Mehrheitsregel behandelt werden darf.15Solange diese Frage Mehrheitsentscheidungen Widerstand entgegenzusetzen, so Offe.
2.4 Extreme Zeitpunktbezogenheit
Das Mehrheitsprinzip eignet sich für rasche, zuverlässige Produktionen von Entscheidungen.16Der hierfür zu entrichtende Preis ist den Kritikern zufolge allerdings hoch: er bestehe aus einer „extremen Zeitpunktbezogenheit der Entscheidung“. Diese spiegle vor allem zeitpunktspezifische Ereignisse, Stimmungen, Wahrnehmungen und Kalküle wieder, die nun zur Grundlage langfristig wirkender Weichstellungen würden.17 Somit ist wieder eine schwankende Mehrheit an die Macht gekommen, die die Mehrheit der Wahlberechtigten am liebsten beim nächsten Korruptionsskandal wieder absetzen möchte.
Des weiteren wird sich jede Regierung nach jeder Legislaturperiode mit ihren Errungenschaften brüsten wollen, d.h. während jeder Legislaturperiode werden nur solche Projekte angetreten, die auch in vier Jahren machbar sind. Keine Regierung möchte bei der Wahl mit unvollendeten Taten dastehen. Die wirklich eingreifenden, wichtigen Reformen bleiben somit jedoch außen vor. Auch macht sich in vier Jahren keine mögliche Regierungspartei Gedanken über die weitere Zukunft. Umweltfeindliche Entscheidungen zu treffen fällt nicht weiter schwer, da die Folgen in der Regel erst 10 Jahre später in Erscheinung treten. Eventuell hat dann ja auch die andere Partei derzeit die Macht und muß sich dann darum kümmern.
2.5 Verletzung des Grundsatzes revidierbarer, reversibler und korrigierbarer Entscheidungen
Diese These bezieht sich auf solche demokratischen Entscheidungen, die Langzeitwirkungen haben, wie z.B. die Atomenergie- und Militärpolitik. Sie überschneidet sich also mehr oder minder mit der vierten These der Zeitpunktbezogenheit. Denn wenn Beschlüsse von einer Mehrheit entschieden wurden, so muß die nächste Generation nicht unbedingt immer damit einverstanden sein. Am wenigsten bei den oben erwähnten Themen wie z.B. der Kernenergie. Nach dem Bau eines Kernkraftwerkes kann keine frisch gewählte Mehrheit die Konsequenzen tragen. Diese getroffenen Entscheidungen betreffen also weitgehenst die folgende Generation, die sich mit den Folgen auseinandersetzen muß, und nicht die der Entscheidungsträger. Die Hauptkritik lautet also, daß man die Zukunftsinteressen den Gegenwartsinteressen opfert. Unter anderem auch in Bereichen wie der Genbeeinflussung, der Datenerfassung und Kommunikationssteuerung, der Verkehrs- und Städteplanung, der Expansion in den Weltraum, der Waffentechnologie, der psychologisch-pharmakologischen Einwirkungen.18
An den Beispielen wird deutlich, daß die fünfte These mit der vierten zusammenhängt. Bei der vierten wird jedoch darauf hingewiesen, daß die Entscheidungen unter anderen Gesichtspunkten anders ausgefallen wären, während die fünfte darauf Bezug nimmt, wie mit den gemachten Entscheidungen umzugehen ist - nämlich fast gar nicht, da es hier unmöglich ist. Wie oben erwähnt, muß also die nächste Generation „ausbaden“, was die vorherige „in den Sand gesetzt hat“.
2.6 Wachsende Diskrepanz zwischen den Beteiligten und Betroffenen
Diese These betont die Diskrepanz zwischen dem Kreis der an öffentlichen Entscheidungen Beteiligten und den von ihnen Betroffenen sowie die Differenz zwischen Entscheidungszuständigkeit und Entscheidungsreichweite.19Offe sieht das Problem in der Extension, d.h. im räumlichen und sozialen Geltungsbereich von Mehrheitsentscheidungen.20Die Lücke zwischen beiden Kreisen und die Zuständigkeits-Reichweite-Lücke sei durch die Eingriffe des Sozial- und Interventionsstaates und infolge zunehmender internationaler Abhängigkeiten größer geworden. Besonders gewichtig sei die Differenz zwischen nationalstaatlich organisierter politischer Herrschaft und politischer Beteiligung einerseits und der Entscheidungszuständigkeit beispielsweise seitens der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union andererseits.21Nicht wenige Angelegenheiten von größter Wichtigkeit für die Lebensführung würden mittlerweile auf inter- und supranationaler Ebene entschieden, unter Mitwirkung von Vertretern der Regierungen der Mitgliedsstaaten, doch unter Ausschaltung von direkter demokratischer Legitimation durch die Bevölkerung der EU- Mitgliedsstaaten.22Damit breche eine weitere Grundlage der Rechtfertigung von Mehrheitsregeln zusammen: die Fiktion einer nationalen Schicksalsgemeinschaft. Sie werde in den modernen Demokratien „zunehmend unterhöhlt“.23
2.7 Spannung zwischen privater Politik und öffentlicher Politik
Nach den Kritikern gerät mit dieser Spannung zwischen privater und öffentlicher Politik die „wichtigste und problematischste Geltungsvoraussetzung für Mehrheitsentscheidungen“ ins Visier.24 Dieser Voraussetzung zufolge haben Mehrheitsentscheidungen nur dann verpflichtende Kraft, „wenn sie sich ausschließlich auf öffentliche Angelegenheiten, aber gleichzeitig auch auf ausnahmslos alle öffentlichen Angelegenheiten ihrem vollem Umfang erstrecken. Mit anderen Worten: Ebensowenig wie Mehrheitsentscheidungen in die Privatssphäre eingreifen dürfen, kann umgekehrt die private Präjudizierung durch private gesellschaftliche Machtpositionen hingenommen werden.25
Mehrheitsentscheidungen können nur dann zu Gehorsam verpflichten, wenn diese Entscheidungsregel für den Gesamtbereich der ,öffentlichen Angelegenheiten´ Anwendung findet, jedenfalls private Machtpositionen wirksam daran gehindert sind, öffentliche Entscheidungen anders als durch den egalitären Kampf um Mehrheiten zu beeinflussen“.26Diese Bedingungen sehen die Kritiker nicht erfüllt. Und zwar um so weniger, je stärker der Staat in die Gesellschaft eingreift.
3. Gesamtbetrachtung
Insgesamt erweist sich die Mehrheitsregel als wirkungsvoll, effizient und legitimationsfähig. Doch bei genauerer Betrachtung wird nach den Kritikern ihre begrenzte Eignung klar. Nach Guggenberger ist unser Parteien- und Regierungssystem hervorragend geeignet Gruppenkonflikte und Verteilungskämpfe zu schlichten, da dies keinen weitreichenden Konsens, sondern annähernde Konfliktfreiheit im Grundsätzlichen erfordert.27Auf der Basis dieses Systems sei es jedoch unmöglich, tiefgreifende Wertkonflikte und meinungspolarisierende Richtungsentscheidungen von historischer Tragweite auszufechten.28Die Grenzen der Integrationsfähigkeit könnten, würde in den letzten Dingen nicht nur um Geld, Macht, Einfluß und Privilegien gerungen, nach Guggenberger sehr schnell erreicht sein. Der Parteienstaat sei vor allem deshalb in wachsendem Maße mit dem Problem des Entzugs von Zustimmung konfrontiert, weil die Politik an neue Legitimationskriterien gemessen werde, für die weder die Wirtschafts- noch die Staatsordnung primär die Legitimationsgrundlage abgeben: Weder die Errungenschaften und Garantien des demokratischen Verfassungsstaats, noch die materielle Leistung der Wirtschaftsordnung verbürgen als solche humanverträgliche politische Problemlösungen.29
Die Kritiker der Mehrheitsdemokratie sind sich jedoch darüber uneinig, was zu tun ist. Guggenberger zieht das System nicht in Zweifel. Wie so viele ist auch er der Meinung, es gebe keine bessere Alternative. Offe hingegen skizziert zumindest theoretisch denkbare Erweiterungen oder Einschränkungen des Mehrheitsprinzips. Es könne durch alternative Entscheidungsverfahren eingeschränkt werden, z.B. durch föderale Entscheidungsverfahren, Dezentralisierung, Stärkung des Verhältniswahlrechts, Befestigung von Minderheitspositionen, Ausbau von Grundrechten, Sicherung der Autonomie und Entscheidungskompetenz von Wählern bzw. Abgeordneten, Eindämmung privater Drohpotentiale gegenüber der Politik und dergleichen mehr.30Erwägenswert wäre auch eine gezielte Ausweitung des Mehrheitsprinzips, z.B. durch Anwendung des Mehrheitsprinzips auf sich selbst, so daß die Abstimmungsberechtigten auch darüber entscheiden könnten, ob und gegebenenfalls wann und wie nach dem Mehrheitsprinzip entschieden werden soll.31
4. Fazit
Die kritische Theorie der Mehrheitsdemokratie ist eine Ansammlung von Kritikpunkten, die jedoch keine Alternativen vorstellt. Lediglich Offe hat ein paar Vorschläge geliefert. Eine weitverbreitete Anti-Kritik ist, daß die kritische Theorie nur nach Kritik, nicht nach Praxis strebe. Dies trifft auch zu. Man sollte dennoch ein paar Punkte betrachten und überdenken, da Kritik nie schadet, ob effizient oder nicht. Eine weitere Anti-Kritik ist, daß die Kritische Theorie der Mehrheitsregel nicht angemessen zwischen den Hauptformen der Mehrheitsregel - relative, absolute und qualifizierte Mehrheit - differenziert. Problematisch ist auch die These der Verletzung von Zukunftsinteressen vor allem im Fall von Hochrisikoprojekten. Bei solchen Projekten plädieren die Kritiker der Mehrheitsregel für Unentscheidbarkeit und Unantastbarkeit. Allerdings ist Unentscheidbarkeit „Entschiedenes“, nämlich Nichtentscheidung zugunsten des Status quo.32
Die Kritik ist also vielerorten angebracht, weißt jedoch keine Alternative auf, da sich ja selbst die Kritiker untereinander nicht einig sind, ob es Alternativen gibt oder nicht.
Anhang
Ostrogorski-Paradoxon
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
- M.G.Schmidt:Demokratietheorien, 2.Aufl., Opladen: Leske+Budrich, 1997 · C.Türcke/ G.Bolte:Einführung in die kritische Theorie, Darmstadt:
Wiss.Buchges., 1994
- H.Buchstein: „Die Zumutungen der Demokratie. Von der normativen
Theorie des Bürgers zur institutionell vermittelten Präferenzkompetenz“, in: K.von Beyme/ C.Offe:Politische Theorien in derÄra der Transformation. Politische Vierteljahresschrift, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996 · B.Guggenberger: „An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie“, in: B.Guggenberger/ C.Offe:An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984
- C.Offe: „Politische Legitimation durch Mehrheitsentscheidungen?“, in:
B.Guggenberger/ C.Offe:An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie,Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984
- H.J.Varain: „Die Bedeutung des Mehrheitsprinzip“, in: B.Guggenberger/
C.Offe:An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie,Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984
[...]
1Vgl. M.G.Schmidt: „Demokratietheorien“, S.182
2Vgl. C.Türcke/ G.Bolte: „Einführung in die kritische Theorie“ S.VII
3M.G.Schmidt, S.182
4 ebenda
5ebenda, S.198
6Vgl. ebenda
7 Vgl. ebenda, S.199ff
8Vgl. ebenda, S.184
9 Vgl. ebenda
10H.J.Varain: „Die Bedeutung des Mehrheitsprinzip“, S.52
11Vgl. H.Buchstein: „Die Zumutungen der Demokratie“, S.295
12Vgl. ebenda, S.301
13 H.J.Varain, S.52
14 C.Offe: „Politische Legitimation durch Mehrheitsentscheidungen?“, S.158
15 ebenda, S.159
16M.G.Schmidt, S.201
17 ebenda
18Vgl. B.Guggenberger: „An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie“, S.190
19M.G.Schmidt S.201
20C.Offe, S.169
21 M.G.Schmidt, S.202
22ebenda
23C.Offe, S.170
24Vgl. M.G.Schmidt, S.202
25C.Offe, S.171
26 ebenda
27B.Guggenberger, S.185
28ebenda
29ebenda
30 M.G.Schmidt, S.203
31ebenda
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kritische Theorie der Mehrheitsregel?
Die Kritische Theorie der Mehrheitsregel ist keine einzelne Theorie, sondern eine Sammlung von Schriften, die demokratische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse kritisch analysieren und konkurrierenden Demokratietheorien vorwerfen, Wertigkeit, Strukturdefekte und Folgeprobleme zu übersehen. Sie stützt sich auf Beiträge zur Transformation individueller Präferenzen in Gruppenentscheidungen und auf die Kapitalismus-, Politik- und Verfassungssoziologie.
Welche sieben Thesen liegen der Kritik an der Mehrheitsregel zugrunde?
Die kritische Theorie der Mehrheitsregel basiert auf sieben Thesen:
- Mehrheiten sind schwankend, fehlbar und verführbar.
- Sie zählt Stimmen, ohne diese zu gewichten ("one man, one vote").
- Es erfolgt eine Vermischung des privaten und öffentlichen Bereichs.
- Extreme Zeitpunktbezogenheit.
- Verletzung des Grundsatzes revidierbarer, reversibler und korrigierbarer Entscheidungen.
- Wachsende Diskrepanz zwischen Beteiligten und Betroffenen sowie zwischen Entscheidungszuständigkeit und Entscheidungsreichweite.
- Spannung zwischen privater und öffentlicher Politik.
Was versteht man unter "Schwankenden Mehrheiten" im Kontext der kritischen Theorie der Mehrheitsregel?
Dieser These liegt die Frage zugrunde, ob individuelle Präferenzen verfälschungsfrei zu Gruppen- oder Kollektiventscheidungen umgeformt werden können. Kritiker bemängeln, dass Mehrheitsentscheidungen oft auf unterschiedlichen Motiven basieren und von Institutionen der Willensbildung geprägt sind. Sie verweisen auf das Condorcet-Paradoxon (zyklische Mehrheiten) und das Ostrogorski-Paradoxon (Tyrannei der Mehrheit).
Was kritisieren die Theoretiker an der "Fiktion abstrakter Teilhabegleichheit"?
Die Kritiker argumentieren, dass die Stimmengleichheit "one man, one vote" eine Fiktion sei, da sie voraussetze, dass jeder Bürger das gleiche Niveau an Sachkenntnis besitze. Die Mehrheit wird somit meist von beeinflussbaren Bürgern entschieden. Zudem spiegeln sich bestimmte Interessen nicht in der Parteienlandschaft wider. Außerdem, beziehen sich Sitzverteilungs-Probleme im Parlament als Beispiel der unterschiedlichen Stimmenzählung auf.
Was bedeutet die "Vermischung des privaten und öffentlichen Bereichs" im Kontext der Mehrheitsregel?
Das Mehrheitsprinzip sollte sich auf öffentliche Angelegenheiten beschränken, nicht jedoch auf den privaten Bereich. Kritiker sehen jedoch eine breite Überschneidung zwischen den Sphären der Entfaltungsfreiheit und der privaten Autonomie und den öffentlichen Angelegenheiten, z.B. bei Beschlüssen über den Abriss von Wohngebieten, die Ansiedlung umweltschädlicher Industrien oder Fragen des Datenschutzes.
Was wird an der "extremen Zeitpunktbezogenheit" von Mehrheitsentscheidungen kritisiert?
Mehrheitsentscheidungen spiegeln oft zeitpunktspezifische Ereignisse, Stimmungen und Kalküle wider, die zur Grundlage langfristig wirkender Weichstellungen werden. Dies führt zu schwankenden Mehrheiten und kurzfristigen Entscheidungen, die die langfristige Planung und die Berücksichtigung zukünftiger Konsequenzen vernachlässigen.
Warum wird der Grundsatz revidierbarer, reversibler und korrigierbarer Entscheidungen verletzt?
Demokratische Entscheidungen mit Langzeitwirkungen (z.B. Atomenergiepolitik) können von nachfolgenden Generationen nicht revidiert werden, obwohl diese die Konsequenzen tragen müssen. Zukunftsinteressen werden somit den Gegenwartsinteressen geopfert.
Wie äußert sich die wachsende Diskrepanz zwischen Beteiligten und Betroffenen?
Die Diskrepanz zwischen den an öffentlichen Entscheidungen Beteiligten und den von ihnen Betroffenen sowie die Differenz zwischen Entscheidungszuständigkeit und Entscheidungsreichweite ist durch den Sozial- und Interventionsstaat und zunehmende internationale Abhängigkeiten größer geworden. Viele wichtige Angelegenheiten werden auf inter- und supranationaler Ebene entschieden, unter Ausschluss direkter demokratischer Legitimation durch die Bevölkerung.
Welche Spannung besteht zwischen privater und öffentlicher Politik?
Mehrheitsentscheidungen haben nur dann verpflichtende Kraft, wenn sie sich ausschließlich auf öffentliche Angelegenheiten erstrecken und private Machtpositionen öffentliche Entscheidungen nicht beeinflussen. Diese Bedingungen sehen die Kritiker jedoch nicht erfüllt, insbesondere in einem Staat mit starken staatlichen Eingriffen in die Gesellschaft.
Welches Fazit ziehen die Kritiker der Mehrheitsdemokratie?
Die Mehrheitsregel ist zwar wirkungsvoll und legitimationsfähig, ihre Eignung ist jedoch begrenzt. Sie ist gut geeignet, Gruppenkonflikte und Verteilungskämpfe zu schlichten, jedoch ungeeignet, tiefgreifende Wertkonflikte auszufechten. Die Kritiker sind sich jedoch uneinig, welche Alternativen es gibt.
- Arbeit zitieren
- Susana Catalina (Autor:in), 2000, Kritische Theorie der Mehrheitsregel, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102970