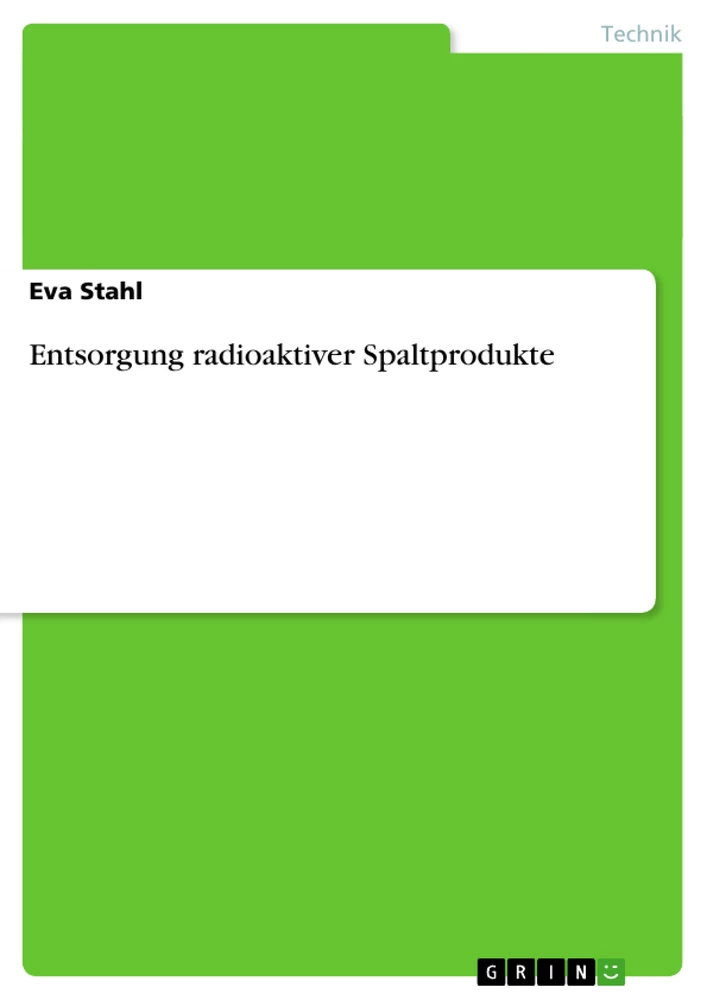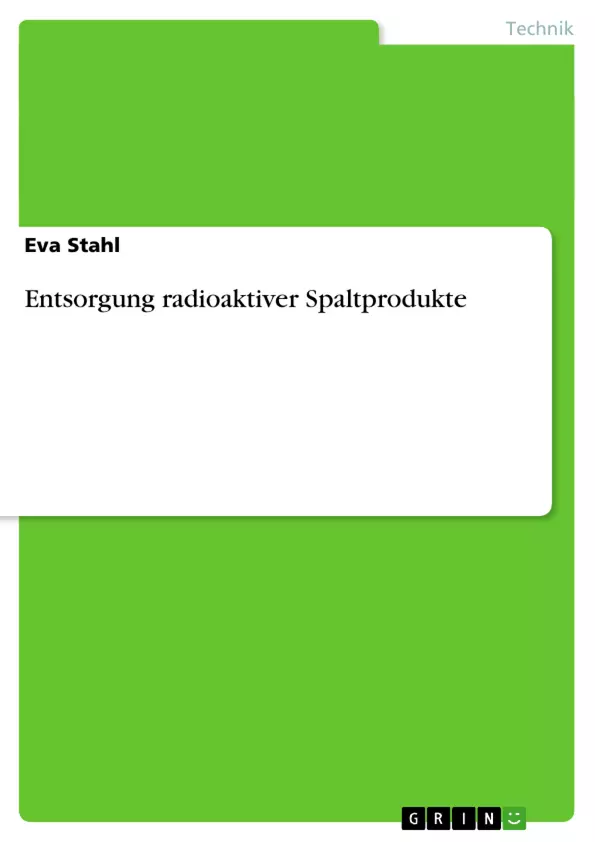Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeiner Teil
2. Wiederaufarbeitung
3. Zwischenlagerung
4. Endlagerung
5. Transport
6. Strahlenschutzgesetz
1. Allgemein:
Die Definition des Begriffes Entsorgung besagt: " Entsorgung ist die sachgerechte und sichere Verbringung der während der gesamten Betriebszeit der Anlage ( Kernkraftwerk ) anfallenden bestrahlten Brennelemente in ein für diesen Zweck geeignetes Lager mit dem Ziel ihrer Verwertung durch Wiederaufarbeitung oder ihrer Behandlung zur Endlagerung ohne Wiederaufarbeitung und die Behandlung und Beseitigung der hierbei erhaltenen radioaktiven Abfälle. "
Bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb der Kernkraftwerke wird ein Sicherheitskonzept berücksichtigt, dass die ent stehenden radioaktiven Stoffe bei allen Betriebs- und Störfallbe- dingungen unter Kontrolle hält, um Störfälle in der Anlage zu unterbinden. Die Kernkraftwer- ke werden mit Nuklearen Brennstoffen versorgt. Ausgediente Brennelemente sind für eine weitere Energieerzeugung nicht mehr zu gebrauchen, enthalten aber noch andere Energieroh- stoffe und sind somit wiederverwertbar. Wenn die radioaktiven Stoffe heute nicht entsorgt werden, dann haben zukünftige Generationen an den Altlasten zu leiden. Kernkraftwerke in Deutschland sind dazu verpflichtet 6 Jahre im Voraus den Nachweis zu erbringen, wo die Brennelemente verbleiben und ob radioaktive Abfälle in einem Endlager verschwinden. Kön- nen die Kernkraftwerke diesen Nachweis nicht erbringen, so erhalten sie keine neue Betriebs- genehmigung. Wiederverwertbare Energierohstoffe, wie zum Beispiel Uran oder Plutonium, dienen zur Herstellung neuer Brennelemente, mit denen neue Kernkraftwerke versorgt werden können. Die bei der Wiederaufarbeitung anfallenden radioaktiven Abfälle werden in eine endlagergerechte Form gebracht, um im Endlager über einen längeren Zeitraum ohne jegli- chen Kontakt zur Biosphäre liegen zu können. Für Hochtemperatur-Reaktoren und Schnell- brüter-Reaktoren gelten besondere Entsorgungs vorsorgeregelungen. Brennelemente des Hochtemperatur-Reaktors die nach dem heutigem Stand der Technik nicht wiederaufgearbei- tet werden können, sind zur Endlagerung vorgesehen. In den Schnellbrüter-Reaktoren können Brennelemente nur zur Elektrizitätserzeugung genutzt werden, wenn sie der Wiederaufarbei- tung zugeführt worden sind. Laut § 9a Abs. 1 des Atomgesetzes sind alle Kernkraftwerksbe- treiber für die Entsorgung zuständig ( Verursacherprinzip ) und müssen die hier entstandenen Kosten selbst tragen. Die Kosten für die Entsorgung der Kernkraftwerke sind den Stromer- zeugungskosten zuzurechnen
2. Wiederaufarbeitung:
Reaktorbrennelemente dienen für 3 Jahre der Energieerzeugung im Reaktor, bevor sie ausge- wechselt werden. In jedem Jahr werden ca. ein Drittel aller Brennelemente ausgetauscht. Das entspricht bei einem 1300-MWa- Kernkraftwerk der Menge von 35 Tonnen Uran. Zum Ver- gleich: ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland hat einen durchschnittlichen Energiejah- resverbrauch von 9 kWa. Wenn die Brennelemente den Reaktor verlassen wird die Zusam- mensetzung der Brennelemente wesentlich verändert. Aufgrund der physikalischen Halb-wertzeiten verschiedener Spaltprodukte nimmt die Radioaktivität zu Anfang sehr schnell ab, wird allerdings im Laufe der Zeit immer weniger. Die chemische Wiederaufarbeitung der Brennelemente wird einfacher, je geringer die Radioaktivität ist. Eine Wiederaufarbeitung der verbrauchten Kernbrennelemente ist langfristig notwendig. Dafür gibt es laut Klaus G. Th. Kopp zwei Gründe:
1. "... Nur durch die Rückführung des nicht verbrauchten Spaltstoff Uran und der im Reaktor erbrüteten neuen Spaltstoffe - Pu-239 oder U-233 - ist es möglich, die natürlichen Uran- und Thoriumvorkommen dieser Erde sinnvoll zu nutzen. Ein Verzicht auf Wiederaufarbeitung hieße wertvolle Rohstoffe vergeuden "
2. "... Mit der Wiederaufarbeitung erreicht man die risikoärmste Endbeseitigung aller zwangsläufig anfallenden radioaktiven Stoffe "
Die Zwischenlagerung, der dem Reaktor entnommenen Brennelemente, ist bis zu 30 Jahre ohne erhöhte Umweltgefährdung zu verantworten, bevor sie der Wiederaufarbeitung zuge- führt werden. Auch eine spätere Endbeseitigung der zwischengelagerten Brennelemente ohne Wiederaufarbeitung ist realisierbar. Dazu müßte man die Brennelemente mit einer zusätz- lichen Sicherheitsbarriere ausrüsten, bevor man sie tief im Untergrund einlagert. Die Notwen- digkeit der Wiederaufarbeitung wird aus politischen und wirtschaftlichen Gründen in Frage gestellt. Die politische Seite sieht die Gefahr des Mißbrauchs zu militärischen Zwecken und die wirtschaftliche Seite zweifelt an der Wirtschaftlichkeit der Kernenergie. Die bestrahlten Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren werden überwie- gend im Ausland wiederaufgearbeitet. Die Betreiber der Kernkraftwerke haben Verträge zur Lagerung und Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelementen abgeschlossen. Zu den Vertragspartnern gehören unter anderem Großbritannien mit British Nuclear Fuels ( BNFL ), deren Anlage Sellafield ca. 900 Tonnen aufnimmt, und Frankreich mit der Compagnie Gene- rale des Matieres Nucleaires ( COMEGA ), deren Anlage La Hague ca. 4340 Tonnen auf- nimmt. Die zurückgewonnenen Kernbrennstoffe und die bei der Wiederaufarbeitung ange- fallenen radioaktiven Abfälle werden lagerfähig gemacht und nach Deutschland zurückge-liefert. Die bei der Wiederaufarbeitung zurückgewonnenen Kernbrennstoffe Uran und Pluto-nium werden zur Herstellung frischer Brennelemente genutzt, die erneut in den Kernkraftwerken eingesetzt werden können.
3. Zwischenlagerung:
Die Zwischenlagerung dient zur zeitlichen beschränkten Aufbewahrung von Brennelementen, bevor sie der Wiederaufarbeitung oder der Endlagerung zugeführt werden. Die Brenne lemen- te werden in sogenannten Brennelement-Lagerhallen aufbewahrt. Die Lagerbehälter werden in regelmäßiger Anordnung aufgestellt. Sie geben je nach Menge, Abbrand und Alter der Brennelemente eine bestimmte Wärmeleistung ab und müssen somit also ständig gekühlt wer- den. Zur Kühlung werden allerdings keine Pumpen oder Gebläse genutzt, sondern es wird auf natürliche Kühlung zurückgegriffen ( siehe Bild 1 ). Die kühle Luft strömt durch die Kaltluft- zufuhröffnungen in die Zwischenlagerhalle und kompensie rt die Wärme, welche von den Be- hältern mit den Brennelementen ausgeht. Nach einer bestimmten Zeit hat sich die hereinge- strömte Luft aufgrund der Wärme selbst erhitzt. Da die Luft jetzt durch die Erwärmung eine geringere Dichte hat, steigt sie nach oben. An der Decke der Zwischenlagerhalle befinden sich mehrere Warmluftabfuhröffnungen durch die sie jetzt entweichen kann. Desweiteren existieren auch Zwischenlager in der Form von Transportbehälterlagern. Ein Beispiel dafür ist das Zwischenlager bei Gorleben in Niedersachsen (siehe Bild 2 ). Dieses Lager besitzt eine Lagerkapazität von 1500 Tonnen Kernbrennstoff, das entspricht etwa 420 Behältern. Zwischen dem Abschirmdeckel und dem Dichtdeckel wird ein Schutzgasüberdruck aufgebaut. Dieser Überdruck wird durch Anschluß an die Messgeräte des zentralen Überwa- chungssystems ständig überwacht. Wenn die äußere Dichtung versagen sollte, könnte sie im Wartungsbereich des Zwischenlagers erneuert werden und somit der Urzustand wiederherge- stellt werden. Würde die innere Dichtung nachlassen, kann man sie durch Aufschweißen eines Flügeldeckels wiederherstellen.
4. Endlager:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Endlagerung radioaktiver Abfälle. Sie haben alle das Ziel, die deponierten Abfallstoffe durch richtige Lagerung, Verpackung und Art der End- lagerung auf eine Form zu bringen, in der ihre Radioaktivität so stark abnimmt, bis sie auf dem Stand von natürlichen Uranerzlager ist. In Deutschland findet die Endlagerung überwie- gend im geologischen Untergrund statt. Hierfür besonders geeignet sind die Salzstöcke ( siehe Bild 1 ). Der Abfall wird in Fässern in den Räumen des Salzstocklagers untergebracht. Obwohl Salze wasserlöslich sind, ist es bewiesen, dass Salzstöcke seit ihrer Entstehung nic ht mehr mit Wasser in Berührung gekommen sind, weil sie sonst längst ausgelaugt wären. In ihnen gelagerte radioaktive Abfälle müssten somit genauso gut gegen Wasser geschützt sein. Ein weiterer Punkt ist die Stabilität der Salzstöcke. Geologen glauben das sie sich im Verlauf der nächsten Millionen Jahre, wenn überhaupt, nur gering- fügig bewegen. Zum Vergleich: der Zeitraum, in dem die Radioaktivität des Abfalls soweit abnimmt, dass der Mensch keinen Gesundheitlichen Schaden nimmt, beträgt mehrere 1000 Jahre. Das Steinsalz ist durch das Fehlen von Rissen und Löchern gasdicht. Da das Salz plastisch ist, schließen sich die Risse schnell und können die Dichte wahren. Eine weitere positive Eigenschaft von Salz ist, dass es Wärme ableitet: da die radioaktiven Abfälle zerfallen und Wärme entwickeln. Zur Einlagerung sind nur feste, in Fässern verpackte Abfallstoffe zugelassen. Je nach Art des Abfalls werden unterschiedliche Einlagerungsmethoden angewendet. Die Fässer mit den schwachradioaktiven Abfällen werden nach einer Überprüfung der Oberflächendosisleistung mit einem Gabelstapler in den Salzstock gefahren. Dort angekommen können sie bis zu 12 Fässer gleichzeitig mit einem Förderkorb in die 750 m tief gelegene Sohle transportiert werden ( siehe Bild 1 ). Die in der Lagerkammer eintreffenden Fässer werden in kürzeren Abständen mit Abraumsalz überschüttet. Nach der Zuschüttung der Fässer füllt man die restlichen Hohlräume mit Abraumsalz und verschließt die Kammern. Die Einlagerung von mittelradioaktiven Abfällen kann wegen der hohen Radioaktivität nicht ohne luftdichte Ab- schirmung erfolgen. Diese Art von Abfällen wird in Abschirmbehältern zur Schachtanlage geliefert. Die Einlagerung der mittelradioaktiven Abfallfässer erfolgt in einer isolierten Kammer auf der 511 m Sohle ( siehe Bild 2 ). Auf der 490 m Sohle wird der Abschirmbe- hälter mit einem Kran vom Transportband genommen, auf einen Tieflader gesetzt und zur Beschickungskammer gefahren. In der Beschickungskammer wird der Abschirmbehälter auf die Beschickungseinrichtung gehoben. Nachdem der Boden und der Verschluss des Behälters geöffnet worden sind, wird das Fass an ein Stahlseil gehangen und auf den Bo- den der Lagerkammer gesetzt. Die Kontrolle der Einlagerung erfolgt über einen Monitor am Steuerpult der Beschickungsanlage. Die Einlagerung von hochradioaktiven und ver- glasten Spaltprodukten wird heutzutage in Deutschland noch nicht vollzogen. Die einzigen bisher angefallenen flüssigen hochradioaktiven Abfallprodukte lagern bei der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe / WAK ( Stand 1990 ).
5. Transport:
Die Brennstoffe müssen auf ihrem Weg zu den verschiedenen Anlagen transportiert werden. Fabrikneue Brennelemente senden keine besonders große Strahlung aus und werden vor allem zum Schutz gegen Transportschäden in stabilen Behältern transportiert. Ausgediente Brenn- elemente hingegen sind starke Strahlenquellen und somit auch Wärmequellen. Deswegen muss während des Transportes die ionisierende Strahlung abgeschirmt und die produzierte Wärme abgeführt werden. Deshalb haben die Transportbehälter bis zu 45 cm dicke Stahl- wände als Abschirmung. An der Oberfläche besitzen sie Kühlrippen, um die Wärme abzu- führen. Der doppelte, absolut dichte Deckel gewährleistet, dass der Behälter bei Belastungen, wie zum Beispiel Verkehrsunfällen oder Stürzen aus größerer Höhe, seine Dichtheit behält. Die Transportbehälter werden in den im Kernkraftwerk vorhandenen Wasserbecken beladen, damit die ausgedienten Brennelemente im Verlauf der Beladung abgeschirmt und gekühlt sind. Bevor sie abtransportiert werden können, müssen sie noch ungefähr 1 Jahr in Abkling- becken verbringen. Ehe ein Transporter für die Beförderung von radioaktiven Stoffen zuge- lassen wird, muss er noch einige Tests, wie zum Beispiel den Fallversuch aus 9 m Höhe auf ein Beton-Stahl-Fundament oder den Feuertest, bei dem der Behälter über eine halbe Stunde lang Temperaturen von mehr als 8000°C aushalten muss, bestehen. Der Transport giftiger oder radioaktiver Stoffe ist in den 50er Jahren durch eine UNO-Kommission reglementiert worden. Die UNO-Kommission schreibt die Kennzeichnung, die Verpackung und die Doku- mentation vor. Um den grenzüberschreitenden Verkehr beim Transport radioaktiver Stoffe kümmert sich die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ( Wien ).
6. Gesetzesauszüge
(Strahlenschutzvorsorgegesetz - StrVG)
Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung
Vom 19. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2610); (BGB1. III 2129- 16), zuletzt geändert durch Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungsgesetz vom 24. Juni 1994 (BGB1. I S. 1416)
§ 1 Zweckbestimmung
Zum Schutz der Bevölkerung ist
1. die Radioaktivität der Umwelt zu überwachen.
2. die Strahlenexposition und Kontamination so gering wie möglich zu halten.
§ 8 Befugnisse im grenzüberschreitenden Verkehr
1. Die zuständigen Behörden haben Maßnahmen zur Dekontamination zu treffen.
2. Die zuständige Verwaltungsbehörde hat alles zu überprüfen.
§ 12 Betretungsrecht und Probenahme
Die zuständige Behörde ist berechtigt
1. Grundstücke, Geschäftsräume usw. während Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten.
2. die Radioaktivität zu ermitteln.
3. Proben zu nehmen.
Strahlenschutzverordnung - StrlSchV
(Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen)
Die Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 (BGB1. I S. 2905, 1977 S. 184, 269) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1989 (BGB1. I S. 1321, ber. S. 1926) wurde zuletzt am 25. Juli 1996 durch die Verordnung zur Änderung der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung (BGB1. I S. 1172) geändert.
§ 3 Genehmigungsbedürftiger Umgang
1. Jeder Umgang mit radioaktiven Stoffen bedarf laut § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Atomgesetzes einer Genehmigung.
§ 6 Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang
Genehmigungen werden laut § 3 erteilt, wenn
1. keine Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers vorhanden sind.
2. Strahlenschutzbeauftragte oder Antragstellte mit Fachkunde vorhanden sind.
3. Kenntnisse über mögliche Strahlengefährdung und über Schutzmaßnahmen vorhanden sind.
4. Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz getroffen sind.
5. eine Schadensersatzvorsorge betrieben wird.
6. der Schutz gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen gewährleistet ist.
7. nicht gegen öffentlicher Interessen (Bsp.:Umweltschutz) verstoßen wird.
§ 8 Genehmigungsbedürftige Beförderung
1. Die Beförderung radioaktiver Stoffe oder kernbrennstoffhaltiger Abfälle auf öffentlichen Verkehrswegen bedarf einer Genehmigung.
§ 10 Genehmigungsvoraussetzungen für die Beförderung
Genehmigungen werden laut § 8 erteilt, wenn
1. keine Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Absenders oder des Beförderers vorhanden sind.
2. genügend fachkundige Personen beim Transport für eine sichere Ausführung anwesend sind.
3. die bestmögliche Vorsorge gegen Schäden getroffen wird.
4. der Schutz gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen gewährleistet ist.
§ 15 Genehmigungsbedürftige Errichtung von Anlagen
Wer eine Anlage errichtet bedarf der Genehmigung
1. einer Beschleuniger- oder Plasmaanlage, in der je Sekunde mehr als 1012 Neutronen erzeugt werden können.
2. eines Elektronenbeschleunigers mit einer Endenergie der Elektronen von mehr als 10 Megaelektronvolt, sofern die mittlere Strahlleistung 1 Kilowatt übersteigen kann.
3. eines Elektronenbeschleunigers mit einer Endenergie der Elektronen von mehr als 150 Megaelektonvolt
4. eines Ionenbeschleunigers mit einer Endenergie der Ionen von mehr als 10 Megaelektronvolt je Nukleon, sofern die mittlere Strahlleistung 50 Watt übersteigen kann.
5. eines Ionenbeschleunigers mit einer Endenergie der Ionen von mehr als 150 Mega-elektronvolt je Nukleon.
§ 16 Genehmigungsbedürftiger Betrieb von Anlagen
Wer eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen betreibt oder die Anlage und deren Betrieb so ändert, dass der Strahlenschutz beeinflusst werden kann, bedarf der Genehmigung.
§ 18 Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung von Anlagen
Genehmigungen für die Errichtung einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen wird laut § 15 erteilt, wenn
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben und falls ein Strahlenschutz- beauftragter nicht notwendig ist und der Antragsteller die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde besitzt.
2. gewährleistet ist, dass für die Errichtung der Anlage ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt wird, der die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde besitzt und der die Anlage entsprechend der Genehmigung errichten oder errichten lassen kann. Es dürfen keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Strahlenschutzbeauftragten ergeben.
3. gewährleistet ist, dass in den allgemein zugänglichen Bereichen außerhalb des Anlagengeländes die Strahlenexposition von Personen bei dauerndem Aufenthalt infolge des Betriebs der Anlage die für die Bevölkerung zugelassenen Grenzwerte nicht überschreitet, wobei die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser und die austretende und gestreute Strahlung zu berücksichtigen sind.
4. die Vorschriften über den Schutz von Luft, Wasser und Boden bei dem beabsichtigten Betrieb der Anlage sowie bei Störfällen eingehalten werden können,
5. überwiegende öffentliche Interessen, besonders im Hinblick auf die Begrenzung des Umfangs der Bevölkerungsgruppe, die in der Umgebung der Anlage bei deren Betrieb einer Strahlung ausgesetzt ist, oder im Hinblick auf die Reinhaltung der Luft, des Wassers und des Bodens, der Wahl des Ortes der Anlage nicht entgegenstehen.
6. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist.
§ 19 Genehmigungsvoraussetzungen für den Betrieb von Anlagen
(1) Genehmigungen werden laut § 16 erteilt, wenn
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Antragsteller die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde besitzt.
2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Strahlenschutzbeauftragten ergeben, und sie die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde besitzen.
3. die für eine sichere Ausführung des Betriebs notwendige Anzahl der Strahlenschutzbeauftragten vorhanden ist, der ihnen übertragende Entscheidungsbereich festgelegt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind.
4. gewährleistet ist, dass die beim Betrieb sonst tätigen Personen die notwendigen Kennt- nisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen.
5. gewährleistet ist, dass beim Betrieb die Einrichtungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden.
6. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenersatzverpflichtungen getroffen ist.
7. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist, soweit die Errichtung der Anlage der Genehmigung nach § 15 bedarf.
8. überwiegende öffentliche Interessen, besonders im Hinblick auf die Reinhaltung der Luft, des Wassers und des Bodens, dem beabsichtigten Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.
(3) Dem Genehmigungsantrag sind folgende zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizu- fügen
1. ein Sicherheitsbericht, der die Anlage und ihren Betrieb beschreibt und mit Hilfe von Lageplänen und Übersichtszeichnungen darstellt, sowie die mit der Anlage und dem Betrieb verbundenen Auswirkungen und Gefahren beschreibt und die nach Absatz 1 Nr. 5 vorzusehenden Einrichtungen und Maßnahmen darlegt.
2. ergänzende Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen der Anlage und ihrer Teile.
3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die Schutzvorschriften des Absatzes 1 Nr. 7 und 8 eingehalten sind.
4. Angaben, die es ermöglichen, die Zuverlässigkeit und die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde der Strahlenschutzverantwortlichen und der Strahlenschutzbeauftragten zu prüfen.
5. Vorschläge über die Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen.
(4) Läßt sich erst während eines Probebetriebs beurteilen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 5 vorliegen, kann die zuständige Behörde die Genehmigung nach § 16 befristet erteilen. Der Betreiber hat zu gewährleisten, dass die Vorschriften über die Dosisgrenzwerte, über die Sperrbereiche, Kontrollbereiche sowie über den Schutz von Luft, Wasser und Boden während des Probebetriebs eingehalten werden.
§ 22 Verfahren der Bauartzulassung
(1) Die Bauart von Anlagen, Geräten oder sonstigen Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten oder ionisierende Strahlen erzeugen, kann auf Antrag zugelassen werden, wenn die in Anlage VI genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 gilt nicht für Vorrichtungen, die Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes sind.
(2) Der Antrag ist vom Hersteller oder Einführer schriftlich bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde) zu stellen. In dem Antrag ist der Ver- wendungszweck anzugeben. Dem Antrag sind die für die Bauartprüfung erforderlichen Zeichnungen sowie die Beschreibung der Bauart und der Betriebsweise beizufügen.
(3) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten des Antragstellers eine Bauartprüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zu veranlassen. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt prüft insbesondere, ob das Baumuster den technischen Bauartvoraussetzungen der Anlage VI entspricht. Der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sind auf Verlangen die zur Prüfung erforderlichen Baumuster zu überlassen. Sie teilt das Ergebnis der Prüfung der Zulassungsbehörde in einem Prüfungsgutachten mit.
§ 23 Entscheidung über die Bauartzulassung
(1) Die Zulassungsbehörde entscheidet über die Zulassung der Bauart der nach § 22 Abs. 3 geprüften Vorrichtungen.
(2) Die Zulassung der Bauart ist auf höchstens zehn Jahre zu befristen. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden. Vorrichtungen, die vor Ablauf der Frist in den Verkehr gebracht worden sind, dürfen nach Maßgabe des § 4 weiter betrieben werden, es sei denn, dass die zuständige Behörde feststellt, dass ein ausreichender Schutz gegen Strahlenschäden nicht gewährleistet ist.
(3) Die Zulassung der Bauart ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich gegen die Zuverlässigkeit des Herstellers oder des für die Leitung der Herstellung Verantwortlichen oder gegen die für die Herstellung erforderliche technische Erfahrung dieses Verantwortlichen oder gegen die Zuverlässigkeit des Einführers Bedenken ergeben, oder wenn die in Anlage VI genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn überwiegende öffentliche Interessen der Zulassung entgegenstehen.
§ 24 Pflichten des Zulassungsinhabers
Der Zulassungsinhaber hat
1. eine Qualitätskontrolle durchzuführen, um sicherzustellen, dass die gefertigten Vorrichtungen den für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmalen der Bauartzulassung entsprechen und mit dem Bauartzeichen und weiteren von der Zulassungsbehörde zu bestimmenden Angaben versehen werden.
2. die Qualitätskontrolle durch einen von der zuständigen Behörde zu bestimmenden Sachverständigen überwachen zu lassen.
3. dem Erwerber einer zugelassenen Vorrichtung einen Abdruck des Zulassungsscheins auszuhändigen, auf dem das Ergebnis der Qualitätskontrolle nach Nummer 1 bestätigt ist.
4. dem Erwerber einer zugelassenen Vorrichtung eine Betriebsanleitung auszuhändigen, in der insbesondere auf die dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen hingewiesen ist.
§ 25 Zulassungsschein
Wird die Bauart nach § 23 Abs. 1 zugelassen, so hat die Zulassungsbehörde einen Zulassungsschein zu erteilen, in welchen folgendes aufzunehmen ist
1. die für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der Vorrichtung.
2. der zugelassene Gebrauch der Vorrichtung.
3. inhaltliche Beschränkungen und Auflagen für den Inhaber der Vorrichtung sowie Befristungen.
4. das Bauartzeichen und die Angaben, mit denen die Vorrichtung zu versehen ist.
5. ein Hinweis auf die Pflichten des Inhabers der Vorrichtung nach § 4 Abs. 1 und § 27.
§ 27 Pflichten des Inhabers einer zugelassenen Vorrichtung
(1) Der Inhaber einer zugelassenen Vorrichtung hat einen Abdruck des Zulassungsscheins nach § 25 bei der Vorrichtung bereitzuhalten und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.
(2) An der Vorrichtung dürfen Änderungen nicht vorgenommen werden, die für den Strahlenschutz wesentliche Merkmale betreffen.
(3) Eine Vorrichtung, die infolge Abnutzung, Beschädigung oder Zerstörung nicht mehr den Vorschriften dieser Verordnung, den in dem Zulassungsschein bezeichneten, für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmalen oder späteren Anordnungen oder Auflagen der zuständigen Behörde entspricht, darf nicht mehr verwendet werden. Der Inhaber der Vorrichtung hat unverzüglich die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um Strahlenschäden zu verhüten. Er hat die zuständige Behörde unverzüglich zu unterrichten.
(4) Ist die Rücknahme oder der Widerruf einer Bauartzulassung bekanntgemacht worden oder hat die zuständige Behörde eine Feststellung nach § 23 Abs. 2 Satz 3 getroffen, so hat der Inhaber eine Vorrichtung, die von der Rücknahme, dem Widerruf oder der Feststellung betroffen ist, unverzüglich stillzulegen und die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um Strahlenschäden zu verhüten. Der Inhaber hat die Stillegung der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.
§ 28 Strahlenschutzgrundsätze
(1) Wer eine Tätigkeit nach § 1 dieser Verordnung ausübt oder plant ist verpflichtet
1. jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von Personen, Sachgütern oder der Umwelt zu vermeiden.
2. jede Strahlenexposition oder Kontamination von Personen, Sachgütern oder der Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auch unterhalb der in dieser Verordnung festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich zu halten.
§ 29 Strahlens chutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte
(1) Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer einer Genehmigung nach den § 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder nach den § 3, 15, 16 oder 20 dieser Verordnung oder der Planfest- stellung nach § 9 b des Atomgesetzes bedarf oder wer eine Anzeige nach § 4 Abs.1 oder §17 Abs. 1 zu erstatten hat oder wer aufgrund des § 3 Abs. 3 keiner Genehmigung nach §3 Abs. 1 bedarf. Besteht bei Kapitalgesellschaften das vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern oder sind bei Personengesellschaften mehrere vertretungsberech- tigte Gesellschafter vorhanden, so ist der zuständigen Behörde anzuzeigen, wer von ihnen nach den Bestimmungen über die Geschäftsführungsbefugnis für die Gesellschaft die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahrnimmt.
(4) Strahlenschutzbeauftragte nur Personen, bei denen keine Bedenken gegen Zuverlässigkeit undund die für Strahlenschutz benötigte Fachkunde besitzen.
§ 36 Maßnahmen bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen
1. Bei Unfä llen und Störfällen sind alle Maßnahmen einzuleiten, um dieGefahr auf ein Mindestmaß zu beschränken.
2. Bei einemUnfall/Störfall ist sofort die atomrechtliche Aufsichtsbehörde, wenn notwendig auch die zuständige Behörde für Ordnung und Sicherheit sowie die zuständige Behörde für Katastrophenschutz anzuzeigen.
§ 38 Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei Unfällen oder Störfällen
(1) Zur Eindämmung und Beseitigung, durch Unfälle oder Störfälle, entstandener Gefahren im Kontrollbereich sind erforderliches Personal und Hilfsmittel bereitzuhalten.
(2) Informationen über die Beseitigung von Unfall- und Störfallfolgen sind der zuständigen Behörde zu übermitteln.
(3) Das gilt auch für die Planung der Beseitigung.
§ 39 Belehrung
(1) Personen mit Zutritt zu Sperrbereichen oder zu Kontrollbereichen sind beim 1. Mal über mögliche Gefahren, Strahlenexpositionen, anzuwendende Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zu belehren. Die Belehrung hat halbjährlich oder öfter zu erfolgen.
Sie gilt auch für jeglichen Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen.
(2) Personen mit Zutritt sind über Gefahren und mögliche Verhütung zu informieren.
§ 44 Dosisgrenzwerte für außerbetriebliche Überwachungsbereiche
(1) Die effektive Dosis durch Direktstrahlung aus Anlagen oder Einrichtungen oder sonst aus genehmigungsbedürftiger Tätigkeit darf unter Einbeziehung der nach § 45 zu erwartenden Strahlenexposition aus Ableitungen für keine Person im außerbetrieblichen Überwachungsbereich den Grenzwert von 1,5 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten; für die Ableitung gilt § 45.
(2) Die zuständige Behörde kann zulassen, dass der in Absatz 1 genannte Grenzwert in bestimmten Einzelfällen bis auf 5 Millisievert erhöht wird.
§ 45 Dosisgrenzwerte für Bereiche, die nicht Strahlenschutzbereiche sind
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat die technische Auslegung und den Betrieb seiner Anlagen oder Einrichtungen so zu planen, dass die durch Ableitung radioaktiver Stoffe aus diesen Anlagen oder Einrichtungen mit Luft oder Wasser bedingte Strahlenexposition des Menschen jeweils die folgenden Grenzwerte der Körperdosen im Kalnederjahr nicht überschreitet:
1. Die effektive Dosis, d.h. Teilkörperdosis für Keimdrüsen, Gebärmutter und rotes Knochenmark darf nicht mehr als 0,3 Millisievert aufweisen.
2. Die Teilkörperdosis für alle Organe und Gewebe, soweit sie nicht unter Nummer 1 und Nummer 3 genannt ist, darf nicht mehr als 0,9 Millisievert aufweisen.
3. Die Teilkörperdosis für Knochenoberfläche und Haut darf nicht mehr als 1,8 Millisievert Aufweisen.
§ 46 Schutz von Luft, Wasser und Boden
(1) Bei Tätigkeiten laut § 6, 7, 9 oder 9b und § 3, 4 Abs. 1 des Atomgesetzes und laut
§ 16 oder 17 dieser Verordnung ist, falls die Möglichkeit des Entweichens radioaktiver Stoffe in Luft, Wasser, Boden besteht, dafür zu sorgen, dass
1. eine unkontrollierte Ableitung vermieden wird.
2. die abgeleitete Aktivität so gering wie möglich ist.
3. die Ableitung überwacht und nach Art und Aktivität spezifiziert der zuständigen Behörde mindestens jährlich angezeigt wird.
(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall abweichend der Vorschriften niedrigere AkAktivitätskonzentrationen vorschreiben, wenn es zum Schutz Einzelner, der Allgemeinheit od oder der Umwelt ist.
Die zuständige Behörde kann auch höhere Ak tivitätskonzentrationen zulassen, wenn durdurch Schutzmaßnahmen gesichert ist, dass Einzelne, die Allgemeinheit oder die Umwelt nicnicht gefährdet werden.
Dabei sind unmittelbare Einwirkungen und mittelbare Einwirkungen über Er Ernährungsketten zu berücksichtigen.
(6) Bei Tätigkeiten laut § 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder nach §§ 3, 4 Abs. 1, § 16 oder 17 dieser Verordnung ist dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe nicht in den Boden gelangen, außer es ist durch eine Genehmigung zugelassen worden.
§ 48 Umgebungsüberwachung
1. Die zuständige Behörde kann Messungen in der Umgebung einer genehmigungspflichtigen Anlage vornehmen lassen.
2. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
§ 54 Dauereinrichtungen
1. Die Personen, die beruflich mit Radioaktivität in Kontakt treten, sind durch Dauereinrichtungen (Abschirmung, Abstandhaltung) vor äußerer Strahlenexposition zu schützen.
§ 64 Kontamination und Dekontamination
(1) Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen ist in Kontroll- und Überwachungsbereichen, wenn zum Schutz der sich dort befindenden Personen oder Sachgüter nötig ist, festzu- stellen, ob eine Kontamination durch diese Stoffe ausgelöst wird.
(2) Personen, die Kontrollbereiche verlassen, in denen radioaktive Stoffe sind, sind zu überprüfen, ob Kontamination mit Haut oder Kleidung stattgefunden hat.
(3) Bei eventuellen Kontamination sind Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung zu treffen.
Die Dekontamination ist nur von Personen mit erforderlichen Kenntnissen durchzuführen.
Die kontaminierten Gegenstände sind von Personen fernzuhalten, gesichert aufzubewah- ren ren oder als radioaktiver Abfall zu behandeln.
(5) Laboratorien und Arbeitsplätze sind erst nach der Dekontaminierung wieder für andere Zw Zwecke zu verwenden.
§ 74 Lagerung und Sicherung radioaktiver Stoffe
(1) Radioaktive Stoffe sind
1 ,wenn sie nicht genutzt werden, in geschützten Räumen oder Schutzbehältern zu lagern.
2. gegen Abhandenkommen und Zugriff unbefugter Personen zu sichern.
3. nicht mit anderen Gege nständen zu lagern.
(2) Radioaktive Stoffe müssen so gelagert werden, dass ein kritischer Umstand unmöglich ist.
§ 76 Wartung und Überprüfung von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen und von Einrichtungen und Geräten mit radioaktiven Quellen
(1) Eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen ist mindestens einmal pro Jahr zu wa warten. Zwischen den Wartungen ist die Anlage von behördlich bestimmten Sach- ve sverständigen auf sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und Strahlenschutz zu prüfen.
§ 78 Buchführung und Anzeige
(1) Wer mit radioaktiven Stoffen umgeht, hat
1. der zuständigen Behörde Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Abgabe und Verbleib von radioaktiven Stoffen innerhalb eines Monats anzuzeigen.
2. über die Gewinnung, die Erzeugung, den Erwerb, die Abgabe und den Verbleib von radioaktiven Stoffen Buch zu führen.
(4) Die zuständige Behörde ist berechtigt Bücher einzusehen und zu prüfen.
§ 79 Abhandenkommen radioaktiver Stoffe
1. Die Besitzer radioaktiver Stoffe haben ein Abhandenkommen der Stoffe unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.
§ 81 Ablieferung an Anlagen des Bundes
(1) Radioaktive Abfälle sind an eine Anlage des Bundes abzuliefern, wenn sie
1. bei staatlicher Verwahrung von Kernbrennstoffen nach § 5 des Atomgesetzes entstanden sind.
2. bei Aufbewahrung nach § 6 des Atomgesetzes entstanden sind.
3. in nach § 7 des Atomgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen entstanden sind.
4. bei Tätigkeiten nach § 9 des Atomgesetzes entstanden sind.
§ 84 Umgehungsverbot
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Entsorgung laut diesem Dokument?
Entsorgung ist die sachgerechte und sichere Verbringung der während der gesamten Betriebszeit der Anlage (Kernkraftwerk) anfallenden bestrahlten Brennelemente in ein für diesen Zweck geeignetes Lager mit dem Ziel ihrer Verwertung durch Wiederaufarbeitung oder ihrer Behandlung zur Endlagerung ohne Wiederaufarbeitung und die Behandlung und Beseitigung der hierbei erhaltenen radioaktiven Abfälle.
Was besagt das Verursacherprinzip im Zusammenhang mit der Entsorgung?
Laut § 9a Abs. 1 des Atomgesetzes sind alle Kernkraftwerksbetreiber für die Entsorgung zuständig (Verursacherprinzip) und müssen die hier entstandenen Kosten selbst tragen. Die Kosten für die Entsorgung der Kernkraftwerke sind den Stromerzeugungskosten zuzurechnen.
Warum ist die Wiederaufarbeitung von Kernbrennelementen notwendig?
Die Wiederaufarbeitung ist notwendig, um die natürlichen Uran- und Thoriumvorkommen sinnvoll zu nutzen, indem nicht verbrauchter Spaltstoff Uran und die im Reaktor erbrüteten neuen Spaltstoffe (Pu-239 oder U-233) zurückgeführt werden. Außerdem ermöglicht die Wiederaufarbeitung die risikoärmste Endbeseitigung aller zwangsläufig anfallenden radioaktiven Stoffe.
Wie lange können Brennelemente zwischengelagert werden, bevor sie der Wiederaufarbeitung zugeführt werden müssen?
Die Zwischenlagerung der dem Reaktor entnommenen Brennelemente ist bis zu 30 Jahre ohne erhöhte Umweltgefährdung zu verantworten, bevor sie der Wiederaufarbeitung zugeführt werden. Auch eine spätere Endbeseitigung der zwischengelagerten Brennelemente ohne Wiederaufarbeitung ist realisierbar.
Was passiert mit den zurückgewonnenen Kernbrennstoffen und den radioaktiven Abfällen nach der Wiederaufarbeitung?
Die zurückgewonnenen Kernbrennstoffe Uran und Plutonium werden zur Herstellung frischer Brennelemente genutzt, die erneut in den Kernkraftwerken eingesetzt werden können. Die bei der Wiederaufarbeitung anfallenden radioaktiven Abfälle werden lagerfähig gemacht und nach Deutschland zurückgeliefert.
Wie funktioniert die Zwischenlagerung von Brennelementen?
Die Brennelemente werden in Brennelement-Lagerhallen in Lagerbehältern aufbewahrt. Die Behälter werden regelmäßig angeordnet und geben Wärme ab, die durch natürliche Kühlung (Kaltluftzufuhr und Warmluftabfuhr) kompensiert wird. Es gibt auch Transportbehälterlager wie das Zwischenlager bei Gorleben.
Welche Möglichkeiten gibt es für die Endlagerung radioaktiver Abfälle?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Endlagerung radioaktiver Abfälle, die alle das Ziel haben, die Abfallstoffe durch richtige Lagerung, Verpackung und Art der Endlagerung auf eine Form zu bringen, in der ihre Radioaktivität so stark abnimmt, bis sie auf dem Stand von natürlichen Uranerzlager ist. In Deutschland findet die Endlagerung überwiegend im geologischen Untergrund statt, besonders in Salzstöcken.
Wie werden radioaktive Abfälle in Salzstöcken endgelagert?
Der Abfall wird in Fässern in den Räumen des Salzstocklagers untergebracht. Schwachradioaktive Abfälle werden mit einem Gabelstapler und Förderkorb in die Sohle transportiert und mit Abraumsalz überschüttet. Mittelradioaktive Abfälle werden in Abschirmbehältern in isolierten Kammern auf der 511 m Sohle eingelagert. Hochradioaktive Abfälle werden derzeit (Stand 1990) bei der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe / WAK gelagert.
Welche Sicherheitsmaßnahmen sind beim Transport von Brennelementen zu beachten?
Ausgediente Brennelemente sind starke Strahlenquellen und Wärmequellen, daher müssen die Transportbehälter die ionisierende Strahlung abschirmen und die produzierte Wärme abführen. Die Behälter haben dicke Stahlwände und Kühlrippen. Sie müssen Tests wie Fallversuche und Feuertests bestehen. Der Transport ist durch eine UNO-Kommission und die Internationale Atomenergiebehörde IAEA reglementiert.
Welche Gesetze und Verordnungen regeln den Strahlenschutz?
Das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) und die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) regeln den Schutz der Bevölkerung vor Strahlenbelastung. Sie umfassen Bestimmungen zu Genehmigungen für den Umgang und die Beförderung radioaktiver Stoffe, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen sowie die Pflichten von Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten.
Welche Dosisgrenzwerte gelten für außerbetriebliche Überwachungsbereiche und Bereiche, die nicht Strahlenschutzbereiche sind?
Die effektive Dosis durch Direktstrahlung darf im außerbetrieblichen Überwachungsbereich 1,5 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreiten. Für Bereiche, die nicht Strahlenschutzbereiche sind, gelten Grenzwerte für die Körperdosen, die durch Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser bedingt sind (z.B. 0,3 Millisievert für die effektive Dosis).
Welche Pflichten haben Inhaber von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen?
Inhaber müssen die Anlagen warten, prüfen lassen, Buch führen, Abhandenkommen anzeigen, radioaktive Abfälle an Anlagen des Bundes abliefern und das Umgehungsverbot beachten. Sie müssen auch sicherstellen, dass beruflich strahlenexponierte Personen durch Dauereinrichtungen geschützt werden.
Was ist bei Kontamination und Dekontamination zu beachten?
Es muss festgestellt werden, ob eine Kontamination vorliegt. Personen, die Kontrollbereiche verlassen, müssen auf Kontamination überprüft werden. Bei Kontamination sind Maßnahmen gegen Weiterverbreitung zu treffen. Die Dekontamination darf nur von Personen mit Kenntnissen durchgeführt werden. Kontaminierte Gegenstände sind zu sichern oder als radioaktiver Abfall zu behandeln.
- Quote paper
- Eva Stahl (Author), 2001, Entsorgung radioaktiver Spaltprodukte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99969