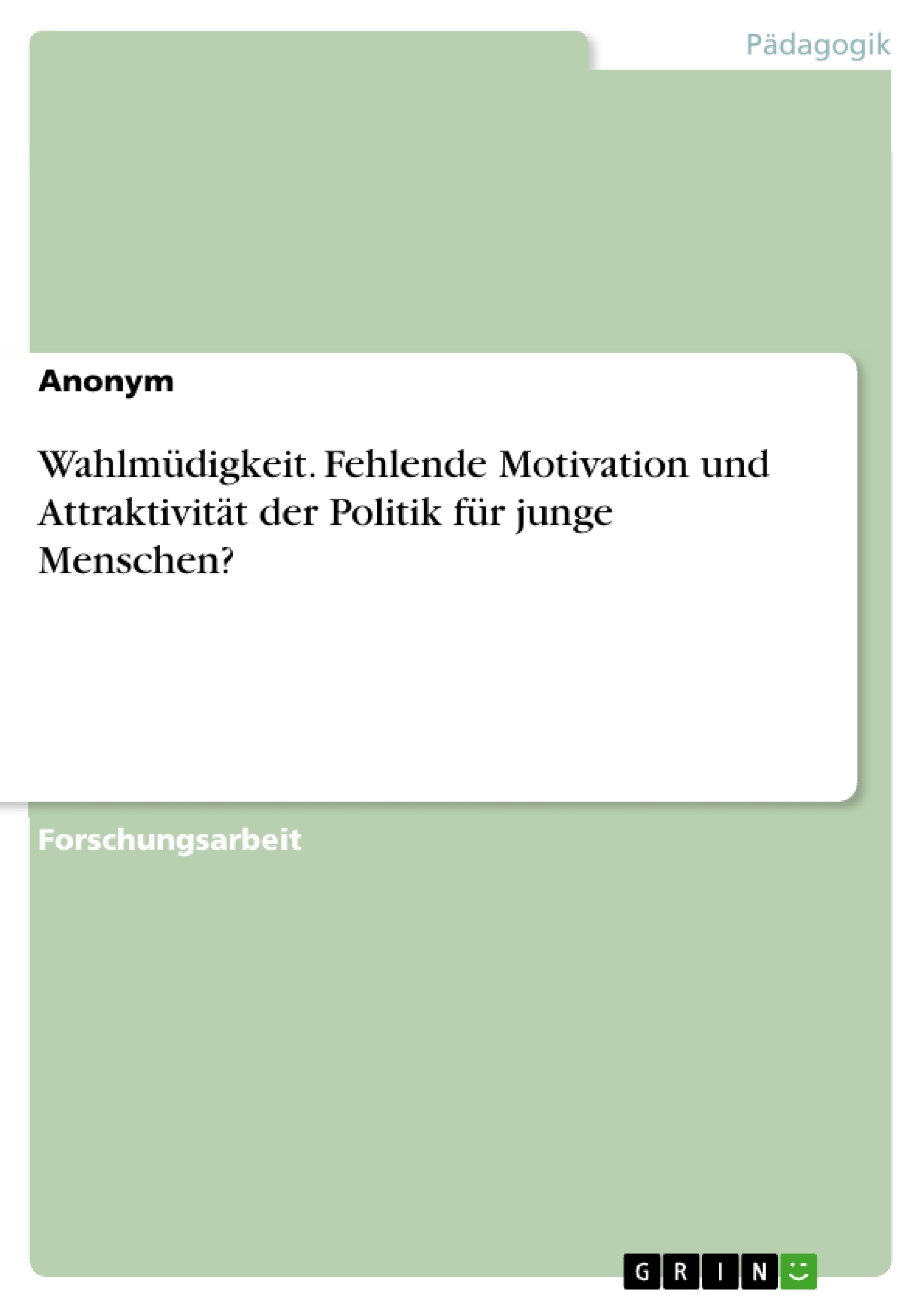Betrachtungen der Wahlstatistiken der Bundesrepublik Deutschland zufolge, lässt sich deutlich erkennen, dass die Wahlbeteiligung der Wahlberechtigen seit den 1980er Jahren abnimmt. Die Folgen dieser passiven Stimmenthaltung auf die Wahlergebnisse sind bedenklich. Auf welche Legitimation stützt sich ein Parlament, wenn seine Abgeordneten nicht von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt sind? Die Politikverdrossenheit der Wahlberechtigten zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. So konstatiert auch Bytzek alle Altersgruppen seien gleichermaßen von der Wahlverdrossenheit betroffen, diese sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Während auch aufgrund des demografischen Wandels bei den abgegebenen Stimmen der Anteil der älteren Generationen zunimmt, lässt sich insgesamt eine immer geringere Wahlbeteiligung der Bevölkerung feststellen. Die herrschende Dissonanz der Bevölkerung zur Politik führt in dieser Entwicklung dabei nicht zu einem Wendepunkt, vielmehr wird der Missmut allumfassend und ansteigend flächendeckend.
Wichtige Funktionen des politischen Systems werden zunehmend außer Kraft gesetzt und können politische Entscheidungen und Handlungen nicht mehr legitimieren. Die Bedeutung der im demokratischen System mitbestimmenden Bevölkerung gewinnt an Einfluss und verursacht, dass kleine Minderheiten politische Dominanz gewinnen.
Dem gegenüber werden die Bedürfnisse und Meinungen großer Bevölkerungsgruppen zunehmend vernachlässigt. Hier ist besonders zu benennen, dass die Wahlbeteiligung der Wählerschaft der bis zu 29-Jährigen scheinbar überdurchschnittlich abgenommen hat. „Bei den vergangenen sieben Bundestagswahlen war die Wahlbeteiligung in der Altersklasse der 60- bis 70-Jährigen am höchsten. [...], von den 21- bis 25-Jährigen sogar nur 60 Prozent“.
Die Klagen über die sogenannte „Politikverdrossenheit“ besonders der jungen Generation haben sich in den vergangenen Jahren deutlich vermehrt. Während dieser Mythos bei den Berichterstattungen zu den Bundestagswahlen immer wieder gerne medial bedient wird, lässt sich mit Blick auf die tatsächlich erhobenen Daten zur Wahlbeteiligung jedoch ein anderes Bild zeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- FORSCHUNGSPROBLEM
- FORSCHUNGSSTAND
- FORSCHUNGSFRAGE
- THEORETISCHER RAHMEN
- METHODISCHER RAHMEN
- EXEMPLARISCHER RAHMEN UND ERGEBNIS
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Miniprojekt im Propädeutikum untersucht die sinkende Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Wahlverdrossenheit junger Menschen. Das Ziel ist es, die Ursachen für diese Entwicklung zu ergründen und die wissenschaftliche Relevanz des Themas aufzuzeigen.
- Sinkende Wahlbeteiligung in Deutschland
- Wahlverdrossenheit junger Menschen
- Ursachen für die fehlende Wahlbereitschaft
- Wissenschaftliche Relevanz des Themas
- Einfluss von Medien auf das Wahlverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
I1 Forschungsproblem
Das Forschungsproblem befasst sich mit der sinkenden Wahlbeteiligung in Deutschland, insbesondere der Wahlverdrossenheit junger Menschen. Es werden die Folgen der passiven Stimmenthaltung auf die Wahlergebnisse und die Legitimation des Parlaments erörtert. Der Fokus liegt dabei auf der überdurchschnittlich sinkenden Wahlbeteiligung der Altersklasse der bis zu 29-Jährigen.
2 Forschungsstand
Dieser Abschnitt beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema Wahlverhalten. Es wird auf die mediale Berichterstattung über die Wahlbeteiligung eingegangen, wobei die subjektive Wahrnehmung und die Tendenzen in der medialen Aufbereitung beleuchtet werden. Zudem werden verschiedene Ansichten über das Wahlverhalten junger Menschen aufgezeigt, die sowohl auf die Generation selbst als auch auf äußere Umstände verweisen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Miniprojekts umfassen: Wahlbeteiligung, Wahlverdrossenheit, junge Menschen, Politikverdrossenheit, mediale Berichterstattung, Wahlverhalten, Generationenunterschiede, politische Legitimation, Demokratie.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Wahlmüdigkeit. Fehlende Motivation und Attraktivität der Politik für junge Menschen?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/998074