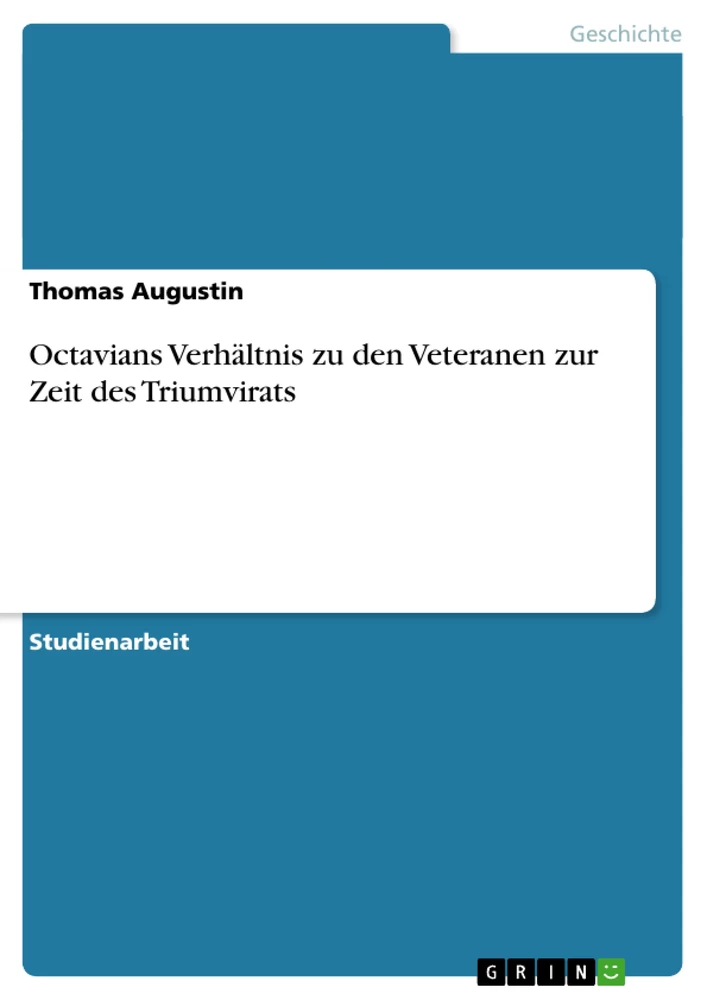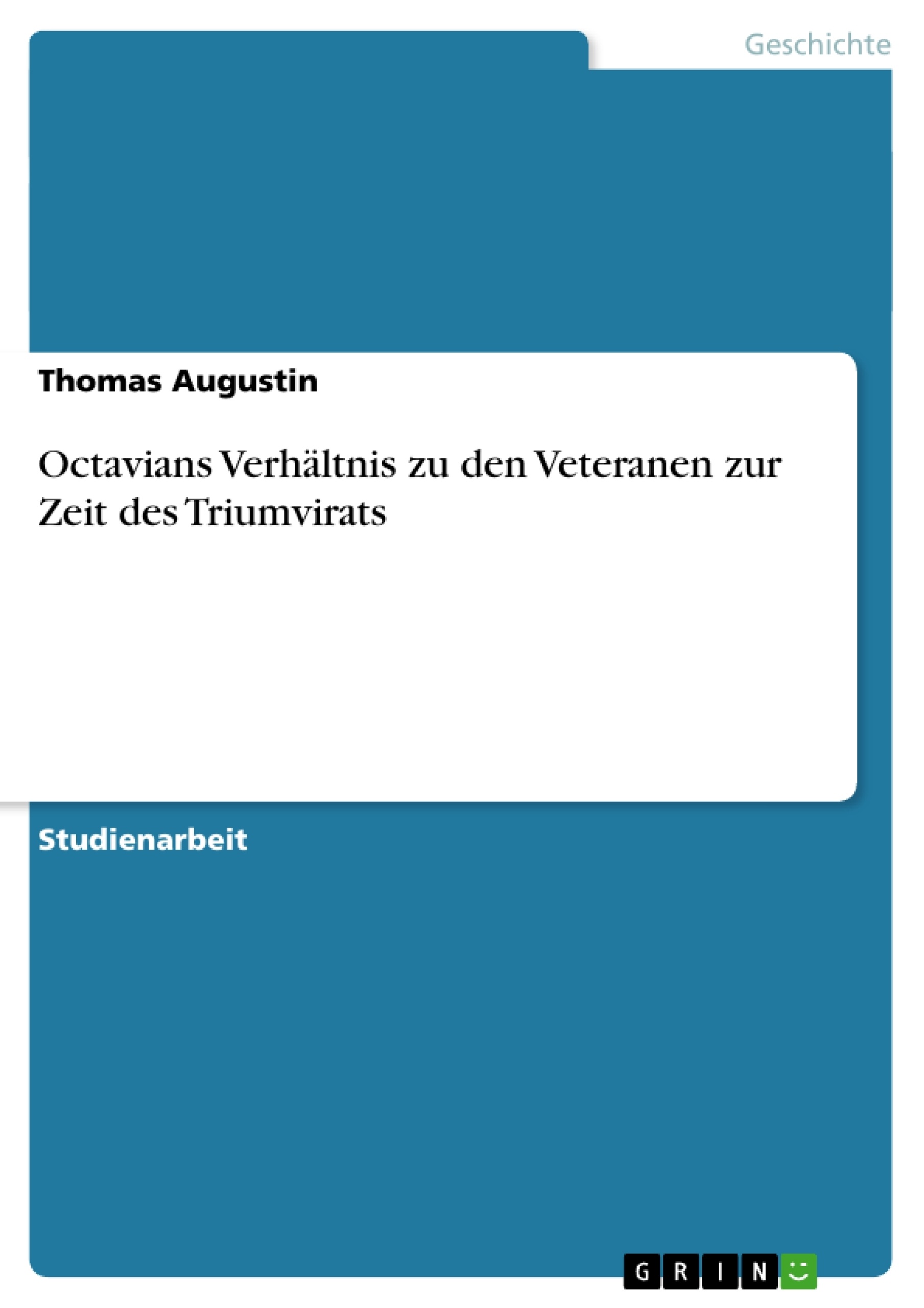2.1. Entstehung des Veteranenproblems
Das römische Heer sah sich im ersten Jahrhundert vor Christus einer erheblichen Aufgabenverschiebung gegenübergestellt. Je größer sich der Machtbereich der Römischen Republik ausdehnte, um so höher war der Bedarf an Soldaten, die nicht nur zwischen März und September, also zwischen Aussaat und Ernte, die Waf- fen für Rom tragen konnten, sondern gar für mehrere Jahre ver- fügbar sein mußten. Diese Aufgabe konnte mit dem herkömmlichen Milizsystem nicht ausreichend bewältigt werden.2
Aus diesem Grund war eine Reform am Ende des 2. Jh. v. Chr. notwendig, durch die nun auch Besitzlose zum Militärdienst herangezogen werden konnten. Daraus ergab sich nun aber das Problem der Besoldung dieser Soldaten nach ihrer Entlassung. Sie konnten nicht auf ihr Land und Gut zurück wie die Milizionäre, denn sie besaßen keines. Deshalb erwarteten sie vom Staat eine entsprechende Vergütung für ihre Dienste. So war es allgemein üblich geworden, den besitzlosen Veteranen am Ende ihrer Dienstzeit Land zu übergeben, das sie als Bauern bewirtschaften konnten.
Im letzten halben Jahrhundert der Republik führte diese Praxis zu beachtlichen Problemen. Die Nobilität war nicht mehr ohne weiteres bereit, Land an die Veteranen zu verteilen, das ohne Enteignungen ohnehin kaum noch zur Verfügung stand.3 Da die Feldherren als patronus für ihre Soldaten zuständig waren, mußten sie nun auf den Senat Druck ausüben, damit die Veteranen ihre Vergütung erhielten.4 Diese Entwicklung führte nicht nur zu einem Spannungsverhältnis zwischen dem Senat und den Feldherren, sondern knüpfte die Soldaten und Veteranen noch enger an ihre Befehlshaber.