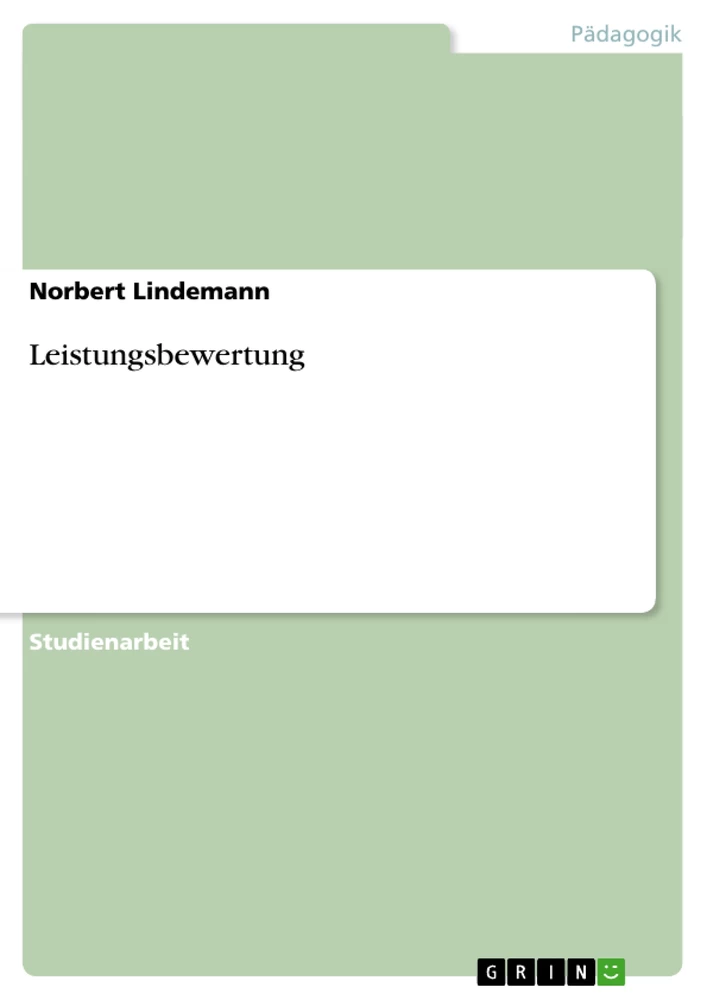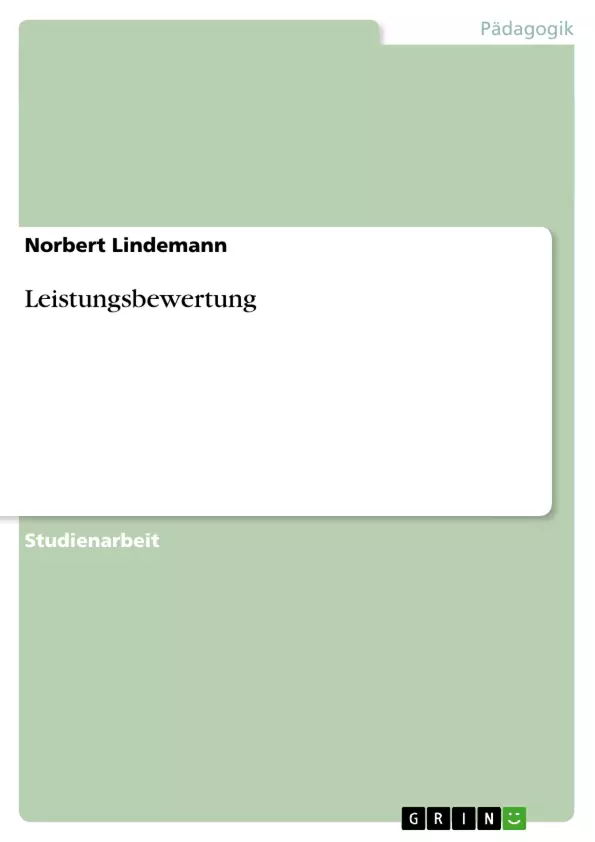Inhalt
1. Einleitung
2. Leistung
3. Leistungsbewertung
- Um welche Leistungen geht es?
- Wie können Kinder ihre Leistungen zeigen?
- Wie können die Leistungen beurteilt werden?
4. Leistungserziehung
- Wie können Kinder zu Leistungen angeregt werden?
- Welche Bedingungen können die Leistungen der Kinder beeinflussen?
- Wie können die Beurteilungen für das Zeugnis zusammengefaßt werden?
5. Differenzierender Unterricht
- Möglichkeiten der Differenzierung – Beispiele
6. Fördern oder Auslesen
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Die Klasse 3 einer Grundschule nimmt das Rechtschreibproblem „äu“ durch. Im gemeinsamen Klassenunterricht ist die Ableitung von Wörtern mit „au“ in der Grund- form erarbeitet worden. Zur Sicherung und Vertiefung erhalten die Schüler Arbeits- blätter, die nach dem Grad der Schwierigkeit differenziert sind (...). Frau Müller, die Lehrerin, hat sich allerhand dabei gedacht:
Arbeitsblatt A enthält Aufgaben, bei denen ausschließlich die Wörter geübt werden, die in der Stunde behandelt worden sind. Arbeitsblatt B enthält darüber hinaus noch andere Wörter, die analog zu den erarbeiteten Wörtern zu üben sind. Arbeitsblatt C enthält zusätzlich eine qualitativ andere Übung: Anfertigung einer kurzen Geschichte „Bäume im Herbst“, zu der einige Reizwörter vorgegeben sind. Während die Schüler fleißig arbeiten, überlegt Frau Müller: Wie muß das Diktat übermorgen aussehen, damit die unterschiedlichen Lernergebnisse berücksichtigt werden? Gebe ich den Schülern der A-Gruppe bessere Noten als den B/C-Schülern bei gleichen Leistungen? Bei welcher Leistung kann ich die Note „sehr gut“ geben? Ist das für die drei Grup- pen gleich oder unterschiedlich? Oder gebe ich doch lieber Noten nach der Fehlerzahl wie sonst?“1
Dieses Beispiel zeigt eine Lehrerin bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe besteht darin, den ihr anvertrauten Schülern etwas beizubringen. Sie soll dafür sorgen, daß die Schüler etwas lernen und dazu soll die Lehrerin sie anregen. Gleichzeitig hat sie die Aufgabe, zu messen, ob und wenn ja was und wieviel die Schüler gelernt haben. Das Beispiel zeigt aber bereits auch die Schwierigkeiten ihrer Arbeit. Bei 20 oder mehr Schülern in einer Klasse kann sie nicht davon ausgehen, daß alle auf dem gleichen Könnens- und Wissens- tand sind. Kann sie allen Schülern zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche beibringen? Wie kann sie bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler deren Lernergebnisse einstu- fen?
Diese Problematik soll im Folgenden näher betrachtet werden. Wenn Schule als gesell- schaftliche Institution einen Erziehungsauftrag hat, müssen wir uns fragen, wozu sie er- ziehen soll? Von entscheidender Bedeutung ist auch, wie beurteilt werden kann, in wel- chem Maße die Ziele dieser Erziehung erreicht worden sind. Diese Fragestellungen sind deshalb für uns von großer Bedeutung, weil sie die tägliche Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer prägen.
In diesem Zusammenhang werden wir um die Begriffe „Leistung“, „Leistungsbewer- tung“ und „Leistungserziehung“ nicht herumkommen und es soll der Versuch unter- nommen werden, ihren Zusammenhang und ihre gegenseitige Abhängigkeit voneinander zu verdeutlichen.
Dazu wird zunächst der Leistungsbegriff als solcher geklärt und die Notwendigkeit von Leistung in der Schule erörtert. In den beiden folgenden Kapiteln sollen die Begriffe „Leistungsbewertung“ und „Leistungserziehung“ näher erläutert werden. Hierzu dienen im wesentlichen die Leitfragen zum Umgang mit Zensuren von BARTNITZKY. Da die Begriffe eng miteinander verknüpft sind, wird es bei ihrer Betrachtung sicherlich Über- schneidungen geben.
In den Ausführungen von PREUSS über Leistungserziehung und Leistungsbeurteilung wird ein dritter Aspekt genannt, ohne den die beiden bereits genannten nicht auskommen, der differenzierende Unterricht. Er soll anhand von praktischen Beispielen konkretisiert werden. Abschließend stellt sich die Frage, wie Gesellschaft, Schule und Individuum
zueinander in Beziehung treten und ob in diesem Zusammenhang der Begriff Fördern oder Auslesen der treffendere ist.
2. Leistung
Der Begriff Leistung ist vielfältig verwendbar. Er begegnet uns in den verschiedensten Bereichen und Zusammenhängen. Man spricht in der Technik ebenso von Leistung wie in der Wirtschaft. Leistungsgesellschaft, Leistungssport, Leistungsprinzip, Leistungskurs, Leistungsnachweis - dies alles sind fest in unseren Sprachgebrauch verankerte Begriffe. Über die Bedeutung von Leistung heißt es bei FEIKS:
„Nach dem Selbstverständnis unserer Leistungsgesellschaft bemessen sich der be- rufliche Aufstieg, die Verbesserung des Arbeitseinkommens, Autoritäts- und Pre- stigegewinn nach der erbrachten individuellen Leistung. Die gesellschaftliche Position des einzelnen wird somit zur abhängigen Variablen seiner Leistung. Leistung scheint damit das demokratiegemäße Zuteilungsprinzip sozialer Chan- cen und sozialer Positionen zu sein.“2
Der hier beschriebene Leistungsbegriff ist eindeutig durch die Ansprüche der Gesell- schaft an das Individuum geprägt. Jeder einzelne unterliegt den Anforderungen der Ge- sellschaft, die sich selber als demokratische Leistungsgesellschaft versteht. Durch die ständige Beurteilung individueller Leistungen erfolgt eine Auslese der Besten, die da- durch in den Genuß höheren sozialen Ansehens gelangen.
Die Schule und insbesondere die Grundschule als Pflichtschule ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Gesellschaft. Aus diesem Grund kann sie sich, ob sie will oder nicht, der gesellschaftlichen Forderung nach Auslese nicht entziehen. Die Bedeutung schuli- scher Leistungen wird bei der Empfehlung an weiterführende Schulen, der Vergabe von Studienplätzen oder Ausbildungsplätzen offensichtlich.3 Damit übernimmt die Schule und jede einzelne Lehrperson eine hohe pädagogische Verantwortung. Es ist die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer bei jedem einzelnen Schüler eine optimale Leistungsfähig- keit zu ermöglichen. Nur so kann ansatzweise gewährleistet werden, daß allen Schülern eine Chancengleichheit im Hinblick auf das Erreichen persönlich erstrebenswerter sozia- ler Positionen geboten wird. Damit ist bereits untrennbar der Auftrag an die Schule ver- bunden, Angebote zum Ausgleich von Defiziten und Benachteiligungen der Schüler zu bieten. Denn wie sollen die Unterschiede im Könnens- und Wissensstand der jeweiligen Schüler ausgeglichen und damit Chancengleichheit erzielt werden, wenn nicht durch ge- zielte Förderung?
Neben der Aufgabe der Lehrpersonen, Maßnahmen zur Ermöglichung optimaler Leis- tungsfähigkeit sowie der Förderung zu ergreifen, steht die Verpflichtung, die Schülerleis- tungen so objektiv wie möglich zu beurteilen.4
Ungeachtet der unterschiedlichen Bedeutungen des gesellschaftlichen und des pädagogi- schen Leistungsbegriffs bleibt beiden gemeinsam, daß „Leistung ... immer ein an be- stimmten Gütemaßstäben orientiertes Handeln“5 darstellt.
3. Leistungsbewertung
- Um welche Leistungen geht es?
Die Grundschule ist Pflichtschule und unterliegt somit einem gesellschaftlichem Auftrag.6 In Richtlinien und Lehrplänen wird verbindlich vorgeschrieben, was die Schule im Hin- blick auf die Erziehung ihrer Schüler zu leisten hat. Die pädagogische Verantwortung tragen dabei die Lehrkräfte, indem sie konkret festlegen, welchen Anforderungen die Schüler genügen und welche Ziele sie erreichen sollen. Daß diese konkreten Ziele indivi- duell vom jeweiligen Lehrer formuliert werden ist deshalb sinnvoll, weil er aufgrund seines täglichen Umgangs mit den Schülern am besten beurteilen kann, welche Leistun- gen jeder einzelne vollbracht hat, um das ihm gesteckte Ziel zu erreichen. Dazu hat er sowohl die Ergebnisse als auch die Mühen und Anstrengungen auf dem Weg zu diesem Ergebnis zu berücksichtigen und als Leistung zu bewerten.
- Wie können Kinder ihre Leistungen zeigen?
Lehrerin Müller aus unserem Beispiel könnte die Diktathefte einsammeln, die Arbeiten zuhause korrigieren und den schul- und jahrgangsstufeninternen Benotungsspiegel her- vornehmen. Daraus würde sie eindeutig ablesen können, daß 7 Fehler der Note 3 entspre- chen. Sie würde diese Note dann unter die Arbeit schreiben und am Ende des Schulhalb- jahres aus dem Durchschnitt der einzelnen Noten eines Schülers eine für die Recht- schreibung gültige Gesamtnote in sein Zeugnis eintragen. So könnte sie es machen – sie tut es aber hoffentlich nicht!
Wenn von Leistung in der Schule die Rede ist, meint das bei weitem mehr als die Fehler- zahl in einem Diktat, die Anzahl der gelösten Mathematikaufgaben oder die Zeit bei ei- nem 100-m-Lauf. Leistungen werden von den Schülern täglich und auf verschiedenste Art und Weise gezeigt. Die Schwierigkeit des Schulalltags (der Lehrer) besteht darin, die eigentliche Leistung zu erkennen - nämlich die Anstrengung, die Überwindung und den Fleiß, die ein Schüler aufbringen muß, um am Ende des Lernprozesses ein sichtbares Ergebnis abzuliefern. Deshalb ist es nicht ausreichend, ausschließlich das Endprodukt für die Leistungsbeurteilung heranzuziehen.
Die obersten Ziele der Erziehung sind nach KLAFKI Mündigkeit und Emanzipation. Diese Ziele rechtfertigen einen pädagogisch fundierten Leistungsbegriff, wenn mit ihnen die Fähigkeit zur Selbst- und Mitbestimmung, Kritik- und Urteilsfähigkeit, Kommunika- tionsfähigkeit und Bereitschaft zu Kompromissen gemeint sind. Die Zielsetzungen faßt er als „Anbahnen, Erweitern und Festigen von Ich-, Sozial- Sachkompetenz“7 zusammen.
Den pädagogischen Leistungsbegriff definiert KLAFKI so:
„Versteht man Leistung als Ergebnis und Vollzug einer zielgerichteten Tätigkeit, die mit Anstrengung und ggf. Selbstüberwindung verbunden ist und für die Gütemaßstäbe anerkannt werden, die also beurteilt wird, so erfordern die genannten Zielsetzungen ein hohes Maß an Anstrengung und an spezifischem Können.“8
Dieser pädagogische Leistungsbegriff kann nur dadurch bestehen, daß der Lehrer seinen leistungserzieherischen Pflichten wie Beobachten, Erkennen und Feststellen der Indivi- duallage des Schülers, ermutigende Hinwendung und Reflexion seines pädagogischen Handelns nachkommt. Dazu bedarf es der ständigen Auseinandersetzung mit den Erzie- hungszielen. Leistungen in den Bereichen Ich-, Sozial- und Sachkompetenz werden dabei sowohl im aktiven Vorgang des Lernprozesses als auch im jeweiligen Zuwachs, Stand oder Ergebnis des Prozesses sichtbar. Demnach wird Leistung gleichermaßen in Lerner- gebnissen und -produkten wie in Lernprozessen sichtbar.9
- Wie können die Leistungen beurteilt werden?
Leistung stellt immer ein an bestimmten Gütemaßstäben orientiertes Handeln dar. Eine Bewertung von Leistungen (in der Schule) kann folgerichtig auch nur anhand eines zu- grunde gelegten Maßstabes erfolgen.
Wenn unsere Lehrerin Frau Müller die Diktathefte zurückgibt, herrscht große Spannung bei allen Schülern. Zunächst interessiert jeden einmal die Note, die unter seiner Arbeit steht. Freude, Erleichterung, Enttäuschung und Trauer werden die Reaktionen in der Klasse sein. Was anschließend von großem Interesse ist, ist die Note des Tischnachbarn, der Freundin oder des Freundes oder die Note des Klassenbesten. Gibt die Lehrerin dann noch den Klassenspiegel bekannt, ist es für jeden Schüler leicht möglich, seine Leistung einzuordnen und Vergleiche zu ziehen. Als Maßstab dienen dann die Ergebnisse der Mit- schüler, an denen der einzelne Schüler seine eigene Leistung mißt.
Eine Orientierung an der Klasse führt unweigerlich dazu, daß die Note eines Schülers nicht mehr alleine von seiner Leistung abhängig ist, sondern auch, wie sie im Verhältnis zu den Leistungen der übrigen Schüler steht. Dieses Verfahren berücksichtigt aber nicht, inwiefern der Schüler die an ihn gestellten Anforderungen erreicht hat.10 Leider ist dieses Denkmuster jedoch weit verbreitet und in der Praxis täglich zu beobachten. Es beruht auf dem Konkurrenzprinzip und verleitet insbesondere die Eltern, daraus verläßliche Rück- schlüsse über die Leistungen ihrer Kinder zu ziehen.
Sinnvolle pädagogische Maßstäbe für die Leistungsbeurteilung in der Schule sind der individuelle und der anforderungsbezogene Maßstab:
- Der individuelle Bewertungsmaßstab beurteilt die persönlichen Lernfortschritte des Schülers. Er findet besonders in den ersten beiden Schuljahren Beachtung, da jeder Schüler mit anderen Vorerfahrungen, Interessen und Erwartungen den Schulanfang erlebt. Die zentrale Frage lautet, was das Kind dazugelernt hat.11 Die Bedeutung des Lernprozesses ist dabei wichtiger als das Ergebnis.
- Der anforderungsbezogene Bewertungsmaßstab ergänzt den individuellen allmählich und wird durch die Vergabe von Noten verdeutlicht. Noten sollen schließlich Aus- kunft darüber geben, ob und in welchem Maße die Leistung des Schülers den gestell- ten Anforderungen entspricht.12
Die Lernziele und damit die jeweiligen Anforderungen werden individuell für jeden Schüler oder die Lerngruppe ausgewählt. Die Verantwortung für diese Auswahl liegt ebenso bei den Lehrkräften wie die anschließende Bewertung der Leistung. Die Vermu- tung, daß diese nicht frei von Fehlern ist, liegt nahe und erhielt bereits 1927 durch ameri- kanische Forschungsergebnisse Nahrung, die in den drei folgenden Sätzen zusammenge- faßt wurden:
- „Dieselben Schüler erhalten verschiedene Noten in verschiedenen Schulen.
- Verschiedene Lehrer geben gleichen Arbeiten verschiedene Noten.
- Derselbe Lehrer gibt zu verschiedenen Zeiten der gleichen Arbeit verschiedene Noten.“13
4. Leistungserziehung
- Wie können Kinder zu Leistungen angeregt werden?
Leistungen finden täglich und in den verschiedensten Formen statt. Diese zu beobachten und zu beurteilen reicht jedoch für eine Leistungserziehung nicht aus. Die erzieherische Aufgabe des Lehrers besteht darin, ständig zu pädagogisch verwertbaren Leistungen an- zuregen. Legt man die unterschiedlichen Voraussetzungen zugrunde, mit denen Kinder in die Schule kommen, wird die Notwendigkeit eines differenzierten Lernangebotes deut- lich. Dieses muß auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet sein, da nicht alle Schüler zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche lernen können und auch nicht müssen. Das erfordert sowohl Lernzeiten als auch Übungsprogramme, die den einzelnen Schülern eine Mitbestimmung ihrer Lernziele ermöglicht.
Eine sehr große Rolle in der Erziehung zu Leistungen spielt der Motivationsaspekt. Fehlt den Schülern der Spaß und der Erfolg an der Sache, kann man keine Begeisterung für den Unterricht erwarten. Lernprozesse sollten täglich (wenn auch nur kleine) Erfolgser- lebnisse bereitstellen und Erfolgszuversicht aufrechterhalten.14
- Welche Bedingungen können die Leistungen der Kinder beeinflus- sen?
Die Leistungsfähigkeit und –bereitschaft der Kinder ist häufig schon beeinflußt, bevor sie in die Schule kommen. Dafür sind ihre Vorerfahrungen im Elternhaus, im Kindergarten und im sozialen Umfeld entscheidend. Je nachdem ob die Kinder in einer anregungsrei- chen oder eher anregungsarmen Umgebung aufgewachsen sind, haben sie vor dem ersten Schultag mehr oder weniger Erfahrungen sammeln können. Dabei wirkt eine ungestörte, freundliche Lernatmosphäre anregender als z.B. eine ständige Auseinandersetzung mit Konfliktsituationen. Hinzu kommen nicht selten physische Beeinflussungen wie motori- sche Schwächen, Sprachfehler, Seh- oder Hörstörungen.
Im Schulalltag beeinflussen neben den vielfältigen sozialen Erfahrungen vor allem die Handlungen der Lehrerinnen und Lehrer die Kinder in ihren Leistungen. Ihre Fachkom- petenz und ihr unterrichtsmethodisches Vorgehen sind dafür verantwortlich, ob die Schü- ler einen Zugang zum Unterrichtsgeschehen finden und daraus Lernleistungen entwi- ckeln können. Eine unterstützende und motivierende Hinwendung des Lehrers sind dabei ebenso wichtig wie eine Gestaltung der Schule, die zum Lernen anregt.15
- Wie können die Beurteilungen für das Zeugnis zusammengefaßt werden?
Bei der Leistungsbeurteilung müssen die Lernprozesse ebenso wie die Lernergebnisse berücksichtigt werden. Zur Bewertung dienen neben individuellen auch anforderungsbe- zogene Maßstäbe. Dies ist zu berücksichtigen, bevor Noten vergeben und Zeugnisse ge- schrieben werden. Ein Lehrer, der die Zeugnisnote eines Schülers als Durchschnittswert aller Einzelnoten ansieht, vernachlässigt entscheidend dessen Leistungen auf dem Weg zu diesen Ergebnissen. Ihre Berücksichtigung muß in jede Note ergänzend mit einfließen. Nur eine regelmäßige und genaue Beobachtung des Lernverhaltens und der Lernentwick- lung der Schüler kann dies gewährleisten. Aus der Gesamtheit der Ergebnisse und der Beobachtungen soll dann eine Note ermittelt werden, die dem Leistungsstand des Schü- lers gerecht wird. Diese kann (auch im Zeugnis) zusätzlich durch Kommentare erläutert werden.16 Über die allgemeine Beurteilungsproblematik heißt es an anderer Stelle:
„Trotz vielfältiger Mängel, die der Notengebung angelastet werden, sind daraus kaum Konsequenzen gezogen worden, etwa die Notengebung abzuschaffen. Le- diglich in den ersten beiden Schuljahren werden ... anstelle der Ziffernbenotung Zeugnisse in Form eines Berichtes erstellt. Allerdings sind damit die Beurtei- lungsprobleme als solche nicht aus der Welt ...“17
5. Differenzierender Unterricht
Möglichkeiten der Differenzierung
Diese Auswahl stellt lediglich eine persönlich getroffene Auswahl von Beispielen dar.
- Ermöglichen von individuellen – zeitlich unterschiedlichen Lernprozessen und Lern- hilfen durch Variation des Lernangebots Unterricht wird, bevor er stattfindet, geplant und gestaltet. Bei der Planung einer Unter- richtseinheit oder –stunde werden Ziele formuliert, auf die die Lerngruppe hinarbeiten soll. Dabei müssen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen innerhalb der Lerngruppe berücksichtigt werden. Eine verbindliche Zielsetzung im Sinne eines allgemeinen Bil- dungsauftrags ist dann erreicht, wenn alle Schüler den grundlegenden Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus müssen aber zusätzliche Angebote bereitgestellt werden, die aufgrund des unterschiedlichen Arbeitstempos, des Interesses und der Auseinanderset- zung mit einem Thema erforderlich werden.
Die Differenzierung erfolgt in quantitativer (zusätzliche Aufgaben ohne höheren Schwie- rigkeitsgrad), in qualitativer (zusätzliches Angebot mit gesteigertem Schwierigkeitsgrad) und in fakultativer Hinsicht (größere Auswahl an Lernangeboten).18
- Stabilisierung solidarischen Miteinanders gestützt durch heterogene Gruppenbildung
Ein Anliegen der Gruppenbildung generell ist die Förderung des sozialen Verhaltens. Bei der Bildung heterogener Gruppen spielt die soziale Integration ebenso eine Rolle wie die Tatsache, das unterschiedliche Begabungen einen gemeinsamen Lernprozeß sehr sinnvoll vorantreiben können. Der Lehrer kann die Gruppenbildung lediglich registrieren oder sie dahingehend beeinflussen, daß sich innerhalb der Gruppe außer Lernprozessen z.B. auch sozial – integrative Prozesse entwickeln.19
- Ermöglichen wohnlicher und unterrichtsspezifischer Atmosphäre durch eine ange- messene Sitzordnung und offene Raumgestaltung
Da die Anforderungen an differenzierenden Unterricht vielfältig sind, verlangt auch der Ort, in dem der Unterricht abläuft nach Differenzierungsmöglichkeiten. Dabei wird die Raumgestaltung bereits durch die Arbeits- und Kommunikationsformen geprägt, die in der Klasse üblich sind. Für eine Gesprächsrunde sollten Lehrer und Schüler sowie Schü- ler untereinander Blick- und Sprechkontakt haben. Verschiedene Formen der Gruppenar- beit lassen sich nur in dafür vorgesehenen Bereichen des Klassenraumes durchführen, weil z.B. die Arbeit mit Materialien an einen Ort gebunden ist. Selbstverständlich müssen aber beispielsweise auch die Anzahl der Schüler oder die Grundeinrichtung des Klassen- raumes bei der Gestaltung der Lernumgebung berücksichtigt werden. Die Schule soll den Schülern (und Lehrern) mehr als nur eine Unterrichtsstätte sein, sie soll Lebens-, Lern- und Erfahrungsraum sein.20
- Ermöglichen kindgerechten Ausgestaltens von Lern- und Unterrichtssituationen durch Klassenunterricht mit integrierten Differenzierungsphasen In einem didaktisch sinnvollen Wechsel können sich Klassenunterricht und Phasen der Differenzierung mit Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit ergänzen. So bleibt einerseits der gemeinsame Klassenunterricht erhalten und andererseits bietet sich ständig die Mög- lichkeit, das Unterrichtsgeschehen in Gruppen fortzusetzen. Das hat nicht nur den Vorteil abwechslungsreicher Arbeitsformen, sondern ermöglicht das Einbeziehen aller Schüler in den Unterricht, indem z.B. Aufgaben an bestimmte Gruppen oder Personen verteilt wer- den. Die Erarbeitung der Aufgaben sollten dazu beitragen, den Unterrichtsverlauf voran- zutreiben. Für die Lehrkraft besteht in den Differenzierungsphasen die Möglichkeit, bei speziellen Problemen beratend, unterstützend oder fördernd auf die Schüler einzuwirken.
Daß dies bei kleineren Gruppen oder gar einzelnen Schülern intensiver geschehen kann als im Klassenunterricht dürfte einleuchten.21
6. Fördern oder Auslesen
Der Staat ist durch eine demokratische Grundordnung und die Gesellschaft durch das Leistungsprinzip geprägt. Die Schule als Bestandteil dieser Gesellschaft leitet daraus ihre Berechtigung zur Leistungserziehung und das Ermöglichen von Chancengleichheit ab. Während in der Grundschule die Förderung der Lernentwicklung im Hinblick auf die Schaffung möglichst gleicher Voraussetzungen für alle im Vordergrund steht, tritt dieser Aspekt mit zunehmendem Alter der Schüler und der Zuweisung an weiterführende Schu- len zugunsten eines stärker betonten Ausleseprinzips in den Hintergrund. Parallel dazu verläuft die stärkere Gewichtung der Notengebung, die damit ihre eigentliche Funktion der Auslese und der damit verbundenen Zuweisung sozialer Positionen erfüllt (Schulzu- weisungen, Studienplatzvergabe, usw.). Das Prinzip der Förderung verliert jedoch nicht völlig an Bedeutung, sondern bleibt im Sinne des Chancenausgleichs bestehen (Fortbil- dungen, 2.Bildungsweg, usw.).
Fördern und Auslesen schließen sich also keinesfalls gegenseitig aus, sondern bestehen mit zunehmender Bedeutung des einen oder des anderen als Grundprinzipien eines ge- sellschaftlichen Erziehungs- und Bildungsauftrags nebeneinander.
7. Literaturverzeichnis
Bartnitzky, Horst (Hrsg.): Umgang mit Zensuren in allen Fächern. Leistungen und Leis- tungsförderung. Beobachtungen, Tests, Klassenarbeiten, Zeugnisschreiben. Frankfurt am Main. Cornelsen-Scriptor, 1989.
Bolscho, Dietmar ; Schwarzer, Christine (Hrsg.): Beurteilen in der Grundschule. Mün- chen: Urban und Schwarzenberg, 1979.
Feiks, Dietger ; Schmidt, Martin H.: Das Leistungsproblem in Gesellschaft und Schule. Freiburg (Breisgau): Hochschulverlag, 1981.
Hanke, Barbara ; Lohmöller, Jan-Bernd ; Mandl, Heinz: Schülerbeurteilung in der Grundschule: Ergebnisse der Augsburger Längsschnittuntersuchung. München, Wien: Oldenbourg, 1980.
Preuss, Eckhardt: Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschule: Bausteine moderner Grundschularbeit; Anregungen und Hilfen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1994.
[...]
1 Preuß, Eckhardt: Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschu- le, S. 14 f.
2 Feiks, Dietger: Das Leistungsproblem in Gesellschaft und Schule, S. 22 f.
3 Vgl. Ebd., S. 36
4 Vgl. Feiks,Dietger: Das Leistungsproblem in Gesellschaft und Schule, S. 36 f.
5 Ebd., S. 16.
6 Vgl. zu der Gliederung der Kapitel 3 und 4 die sechs Leitfragen zum Umgang mit Zensuren bei Bartnitzky, Horst: Umgang mit Zensuren in allen Fächern, S. 9.
7 Klafki, Wolfgang: Probleme der Leistung in ihrer Bedeutung für die Reform der Grundschule. In: Die Grundschule 10/1975, S. 527-532. Aus: Preuss, Eckhardt: Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschule, S. 39.
8 Klafki, Wolfgang: Probleme der Leistung in ihrer Bedeutung für die Reform der Grundschule. In: Die Grundschule 10/1975, S. 527-532. Aus: Preuss, Eckhardt: Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschule, S. 53.
9 Vgl. Ebd., S. 53 f.
10 Vgl. Preuss, Eckhardt: Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschule, S. 21.
11 Vgl. Bartnitzky, Horst: Umgang mit Zensuren in allen Fächern, S. 12.
12 Vgl. Ebd., S. 12.
13 Lietzmann, Walter: Über die Beurteilung der Leistung in der Schule. Mathematisches -Psychologisches – Pädagogisches. Leipzig-Berlin 1927, S. 46 f. In: Ziegenspeck, Jörg: Zensur und Zeugnis – ein Mängelbe- richt. Aus: Bolscho, Dietmar: Beurteilen in der Grundschule, S. 39.
14 Vgl. Bartnitzky, Horst: Umgang mit Zensuren in allen Fächern, S. 42 f.
15 Vgl. Ebd., S. 45 f.
16 Vgl. Bartnitzky, Horst: Umgang mit Zensuren in allen Fächern, S. 50 f.
17 Hanke, Barbara: Schülerbeurteilung in der Grundschule, S. 29.
18 Vgl. Preuss, Eckhardt: Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschule, S. 131 f.
19 Vgl. Ebd., S. 160.
20 Vgl. Preuss, Eckhardt: Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschule, S. 161 f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Dokument über Leistung, Leistungsbewertung und Leistungserziehung?
Das Dokument bietet eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Leitthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt die Themen Leistung, Leistungsbewertung und Leistungserziehung im Kontext der Grundschule.
Was sind die Hauptthemen, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind?
Die Hauptthemen sind Einleitung, Leistung, Leistungsbewertung (mit Unterpunkten zu Arten von Leistungen, Leistungsvorstellung und Leistungsbeurteilung), Leistungserziehung (mit Unterpunkten zu Leistungsanreizen, Leistungsbedingungen und Zeugniszusammenfassung), Differenzierender Unterricht (mit Beispielen), Fördern oder Auslesen, und ein Literaturverzeichnis.
Wie wird der Begriff "Leistung" im Dokument definiert?
Leistung wird als ein Handeln beschrieben, das sich an bestimmten Gütemaßstäben orientiert. Es wird im Kontext einer Leistungsgesellschaft gesehen, in der beruflicher Aufstieg und soziales Prestige von individueller Leistung abhängen. Auch im pädagogischen Kontext ist Leistung relevant, wo sie die Aufgabe der Schule, eine optimale Leistungsfähigkeit jedes Schülers zu ermöglichen, hervorhebt.
Was wird unter "Leistungsbewertung" verstanden?
Leistungsbewertung bezieht sich auf die Beurteilung der Leistungen von Schülern in der Schule. Dabei werden sowohl Ergebnisse als auch Mühen und Anstrengungen auf dem Weg zu diesen Ergebnissen berücksichtigt. Es werden individuelle und anforderungsbezogene Maßstäbe für die Bewertung genannt.
Welche Aspekte sind bei der "Leistungserziehung" wichtig?
Leistungserziehung umfasst die Anregung zu pädagogisch verwertbaren Leistungen, die Berücksichtigung unterschiedlicher Voraussetzungen der Schüler, die Schaffung differenzierter Lernangebote und die Motivation der Schüler durch Erfolgserlebnisse. Die Leistungen werden von den Vorerfahrungen im Elternhaus, Kindergarten beeinflusst.
Was bedeutet "Differenzierender Unterricht" und welche Möglichkeiten gibt es dafür?
Differenzierender Unterricht berücksichtigt die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler. Beispiele hierfür sind individuelle Lernprozesse, heterogene Gruppenbildung, eine ansprechende Lernumgebung und integrierte Differenzierungsphasen im Klassenunterricht.
Was bedeuten die Begriffe "Fördern" und "Auslesen" im schulischen Kontext?
Fördern bezieht sich auf die Unterstützung der Lernentwicklung, um gleiche Voraussetzungen für alle Schüler zu schaffen, besonders in der Grundschule. Auslesen hingegen tritt mit zunehmendem Alter der Schüler stärker in den Vordergrund und bezieht sich auf die Zuweisung an weiterführende Schulen basierend auf Leistung. Beide Prinzipien bestehen nebeneinander.
Welche Literatur wird im Dokument zitiert?
Das Dokument verweist auf verschiedene Werke, darunter "Umgang mit Zensuren in allen Fächern" von Bartnitzky, "Beurteilen in der Grundschule" von Bolscho und Schwarzer, "Das Leistungsproblem in Gesellschaft und Schule" von Feiks und Schmidt, "Schülerbeurteilung in der Grundschule" von Hanke, Lohmöller und Mandl, und "Leistungserziehung, Leistungsbeurteilung und innere Differenzierung in der Grundschule" von Preuss.
- Quote paper
- Norbert Lindemann (Author), 2000, Leistungsbewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99760