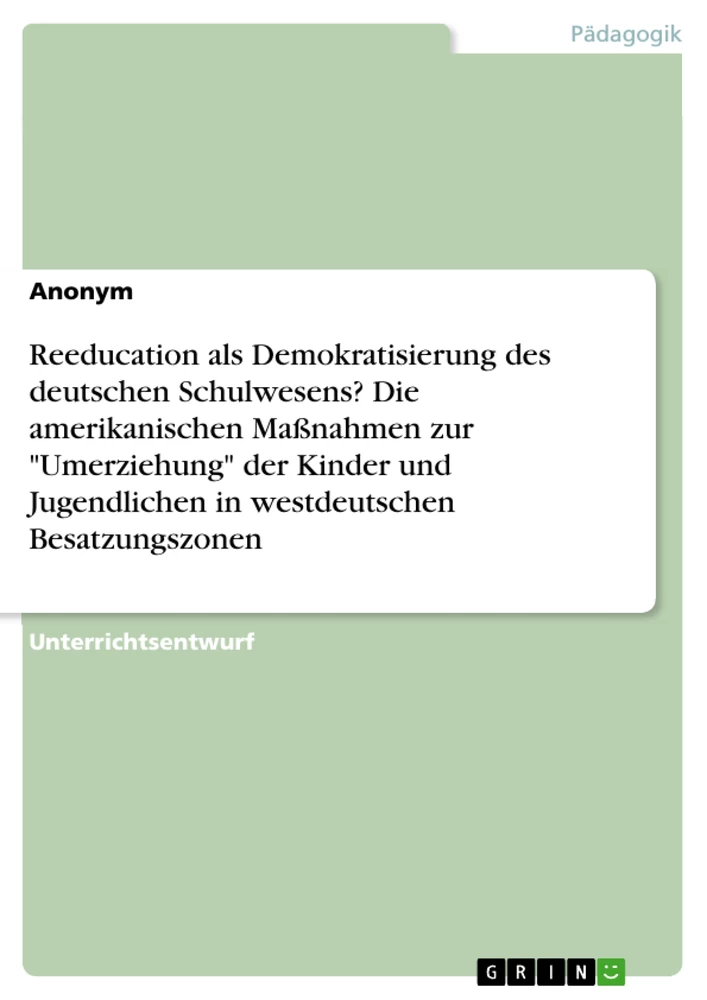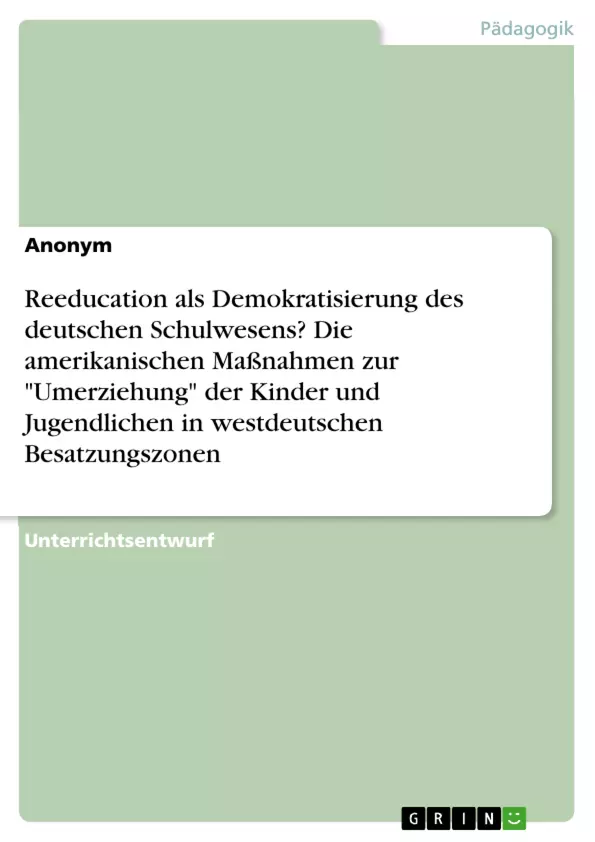Dieser Unterrichtsentwurf für den Geschichtsunterricht einer 10. Klasse beschäftigt sich mit dem Thema: „Reeducation“ – Die Demokratisierung des deutschen Schulwesens?
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen US-amerikanische Maßnahmen zur „Reeducation“ des deutschen Bildungswesens, indem sie sich mit der „Direktive für die Kommandierenden Generale der US-Armee in Deutschland vom 7. Juli 1945“ sowie zwei Zeitzeugenberichten auseinandersetzten und so ihre Sachkompetenz und (Sach-)Urteilskompetenz erweitern.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I - Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Tabellarische Auflistung der Stundenthemen innerhalb der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Teil II - Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
- Ziele und angestrebte Kompetenzen
- Didaktische Schwerpunkte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern ein vertieftes Verständnis für die US-amerikanischen Maßnahmen zur „Reeducation“ des deutschen Bildungswesens nach dem Zweiten Weltkrieg zu vermitteln. Hierzu werden die Schülerinnen und Schüler die „Direktive für die Kommandierenden Generale der US-Armee in Deutschland vom 7. Juli 1945“ sowie zwei Zeitzeugenberichte analysieren.
- Die „Direktive für die Kommandierenden Generale der US-Armee in Deutschland vom 7. Juli 1945“ als zentrales Dokument der US-amerikanischen Bildungspolitik in der Nachkriegszeit
- Die Rolle der „Reeducation“ im Kontext der Demokratisierung des deutschen Schulwesens
- Die Perspektive von Zeitzeugen auf die US-amerikanischen Maßnahmen zur „Umerziehung“
- Die Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung der „Reeducation“
- Die Beurteilung der US-amerikanischen Bildungspolitik im Spiegel der historischen Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I - Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
Dieser Teil des Unterrichtsentwurfs stellt die längerfristigen Unterrichtszusammenhänge dar, in die die vorliegende Unterrichtsstunde eingebettet ist. Die tabellarische Auflistung der Stundenthemen bietet einen Überblick über den Verlauf der Unterrichtsreihe „,,Stunde Null\" - Ende oder Neubeginn? Deutschland unter alliierter Besatzung 1945 - 1949“.
Teil II - Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
Der zweite Teil des Entwurfs befasst sich mit der detaillierten Planung der Unterrichtsstunde, in der die US-amerikanischen Maßnahmen zur „Reeducation“ des deutschen Bildungswesens analysiert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen die „Direktive für die Kommandierenden Generale der US-Armee in Deutschland vom 7. Juli 1945“ und Zeitzeugenberichte verwenden, um die Ziele, Probleme und Herausforderungen der „Umerziehung“ zu beurteilen.
Schlüsselwörter
Der Unterrichtsentwurf befasst sich mit den zentralen Themen der „Reeducation“ und der Demokratisierung des deutschen Schulwesens nach dem Zweiten Weltkrieg. Weitere wichtige Begriffe sind die „Direktive für die Kommandierenden Generale der US-Armee in Deutschland vom 7. Juli 1945“, die „Umerziehung“ der Kinder und Jugendlichen, Zeitzeugenberichte und die Beurteilung der US-amerikanischen Maßnahmen in den westdeutschen Besatzungszonen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Reeducation als Demokratisierung des deutschen Schulwesens? Die amerikanischen Maßnahmen zur "Umerziehung" der Kinder und Jugendlichen in westdeutschen Besatzungszonen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/997588