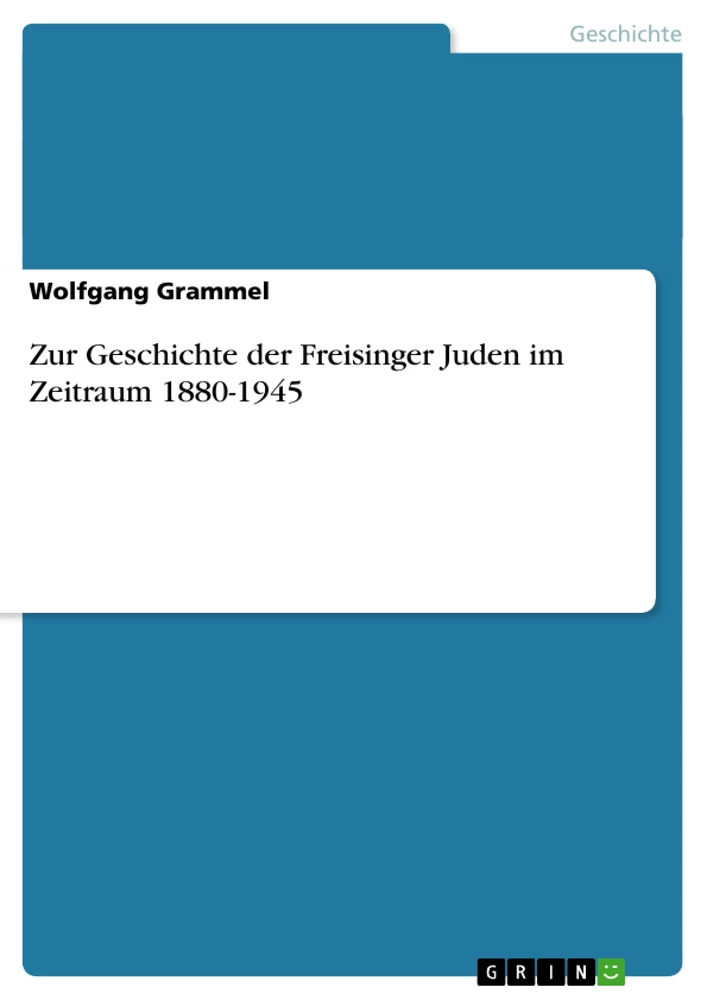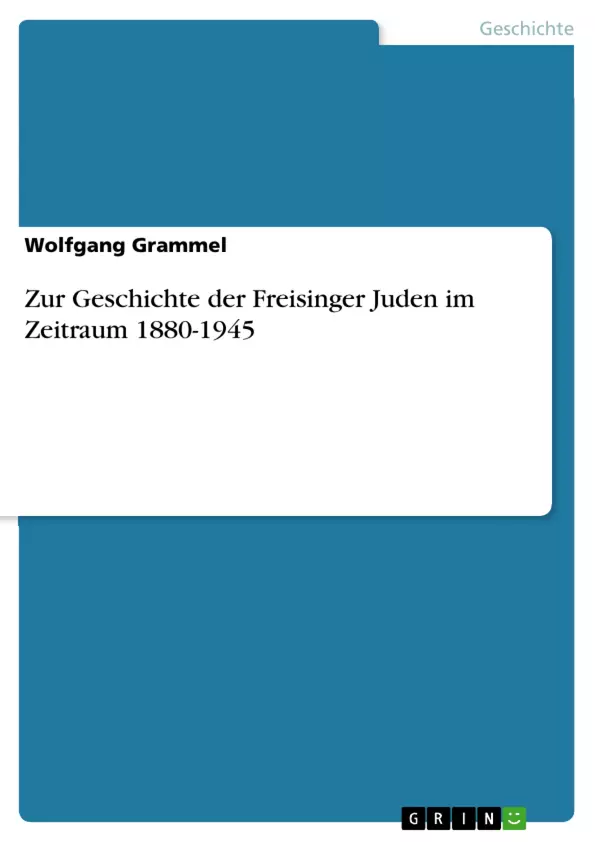Wie lebten Juden in Freising zwischen 1880 und 1945? Eine bisher wenig beachtete Facette der Stadtgeschichte wird hier aufgedeckt, die das Schicksal jüdischer Familien in Freising während der Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet. Anhand von detaillierten Recherchen in Archiven und unter Einbeziehung von Zeitzeugenaussagen wird ein umfassendes Bild der jüdischen Bevölkerung in Freising gezeichnet, von ihren wirtschaftlichen Aktivitäten und ihrem gesellschaftlichen Leben bis hin zur Ausgrenzung, Verfolgung und schließlich zur Vernichtung. Die Geschichte der alteingesessenen Familien Neuburger (Modewarenhandlung), Holzer (Warenhaus) und Lewin (Warenhaus Max Krell Nachfolger) wird ebenso detailliert erzählt wie die des Fabrikanten Max Schülein (Eisengießerei Frimberger, später Schlütergelände), wodurch ein Einblick in die jüdische Unternehmerschaft der Stadt ermöglicht wird. Der Leser erfährt, wie sich das Leben dieser Familien durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten schrittweise veränderte: Boykottmaßnahmen, antijüdische Propaganda, die Nürnberger Gesetze und schließlich die Pogrome vom 9. November 1938. Die Dokumentation der Ereignisse in Freising während der Reichskristallnacht, einschließlich der Demütigungen, Zerstörungen und Verhaftungen, vermittelt ein erschütterndes Bild der damaligen Zustände. Im Fokus steht die Frage, wie die Freisinger Bevölkerung auf die Verfolgung ihrer jüdischen Mitbürger reagierte, welche Formen von Unterstützung es gab und wo die Grenzen der Solidarität verliefen. Abschließend wird das Schicksal der einzelnen Familien nach ihrer Flucht aus Freising verfolgt, von den Sammellagern in München bis zu den Deportationen in Konzentrationslager wie Riga, Kowno, Piaski, Theresienstadt und Auschwitz. Beleuchtet wird auch der Umgang mit Rückerstattung und Entschädigung nach dem Krieg. Eine wichtige Lektüre zur Lokalgeschichte, die dazu anregt, über die Verantwortung des Einzelnen und die Mechanismen von Ausgrenzung und Verfolgung nachzudenken. Dieses Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur und zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Bayern, insbesondere im Raum Freising, und richtet sich an alle, die sich für Geschichte, Judentum und die Bewahrung der Erinnerung interessieren.
Zur Geschichte der Freisinger Juden im Zeitraum 1880-1945
In der Zeit des Nationalsozialismus wurden in einer geplanten Unternehmung 6 Millionen Juden getötet. Andere mussten fliehen, emigrieren. Verschwindend wenige haben auf deutschem Boden den Holocaust überlebt.
Auch wenn in Freising nichts über die Existenz einer jüdischen Gemeinde wie etwa in Regensburg, Landshut oder München bekannt ist, haben seit dem Mittelalter Juden in Freising gelebt. Davon zeugen urkundliche Belege. Auch das Freisinger Rechtsbuch von 1328 geht in einigen Artikeln auf die besonderen Vorschriften bezüglich der Juden ein. Im Jahr 1464 und höchstwahrscheinlich auch 1488 war Freising Versammlungsort einer großen Verhandlung zwischen dem Kaiser und den Juden (Vorladungsschreiben Archiv des Erzbistums München und Freising, Heck 261, abgedruckt in Amperland, 1991 Heft 1,Seite 41).
Erst seit dem 19. Jahrhundert aber gibt es genauere statistische Zahlen. So lebten 1870 vier Juden in Freising, bis zum Jahr 1925 stieg die Zahl auf 26, bevor sie ab diesem Zeitpunkt wieder sank.
Eine der ersten jüdischen Personen, die sich in Freising nachweisbar dauerhaft niederließ, war der Kaufmann Isac Raphael Ignaz Neuburger (geb. 30.4.1853 in Buchau in Württemberg). Sein Geschäft und auch sein Wohnhaus war die Modewarenhandlung Neuburger in der Bahnhofstraße 4, welche er kurz nach seiner Ankunft in Freising im Jahr 1881 gründete. Das Angebot umfasste Manufaktur- sowie Schnittwaren, also Stoffe und Kleidungsstücke. Das Geschäft lief gut, so dass im Jahre 1931 auch das zweite angrenzende Gebäude (Bahnhofstraße 6) erworben werden konnte. Im Betrieb arbeiteten um 1930 neun Angestellte. Mit seiner Frau Lina hatte er 3 Kinder. Alfred (geb. 26.5.1882, Kriegseinsatz 1914-1919, dauernde körperliche Beeinträchtigung), Siegfried (geb. 26.10.1883, Träger des Eisernen Kreuzes, Textilkaufmann), Emma (geb. 27.2.1891,Textilkauffrau). Im Jahr 1893 erhielten die Neuburgers die bayerische Staatsangehörigkeit und auf Antrag wurde Ignaz Neuburger das Bürger- und Heimatrecht der Stadt Freising zugesprochen. Die Familie Neuburger genoss in Freising hohes Ansehen. Dies dokumentiert neben Zeitzeugenaussagen auch das Beileidsschreiben Oberbürgermeister Bierners zum Tod von Ignaz Neuburger 1928. Neuburger wird als "vortrefflicher, ehrenhafter Mann sowie als großer Wohltäter der Gemeinde und ihrer Bevölkerung" bezeichnet.
Das zweite große jüdische Geschäft in Freising war das Warenhaus der Gebrüder Holzer, das sich in der Oberen Hauptstraße 9 befand. 1892 kamen Bernhard (geb. 21.11.1867) und Oskar (geb. 10.3.1869) Holzer aus Stein am Kocher in Baden nach Freising, heirateten hier und hatten je zwei Kinder. Irma besuchte eine höhere Töchterschule und sprach sogar Englisch, was für die damalige Zeit selten war. Siegfried wurde Rechtsanwalt in München, Ilse wurde Musiklehrerin und ging ebenfalls nach München, ihr Bruder Martin wurde Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 1931 gründete er in Freising eine Firma als Bücherrevisor und Steuerberater, die er 1933 auflösen musste. Die Holzers wohnten seit 1896 in dem neu erbauten Wohn- und Geschäftshaus in der Oberen Hauptstraße 9 (bis 1802 Domherrnhof) und besaßen ebenfalls die Bayerische Staatsangehörigkeit und das volle Bürgerrecht. Das Geschäft war etwas kleiner als das der Neuburgers und mehr auf Stadtkundschaft ausgerichtet.
Die Lewins ließen sich erst um die Jahrhundertwende in Freising nieder. Der Kaufmann Marcus Lewin stammte aus Posen und heiratete 1901 in der Domstadt Johanna Krell, die aus Brandenburg kam. Am 25.9.1910 kam Tochter Hildegard zur Welt, die bald im väterlichen Betrieb mitarbeitete. Die Lewins besaßen das Warenhaus Max Krell Nachfolger in der Unteren Hauptstraße 2, das neben Bekleidung auch Teppiche und sonstige Artikel für die Wohnungsausstattung verkaufte und das größte der jüdischen Geschäfte war, was sich auch an den durchschnittlich über 20 Mitarbeitern zeigte. Gewohnt haben die Lewins ebenfalls in ihrem Geschäftshaus; Eigentümer wurde Marcus Lewin erst im Jahr 1930.
Ein weiterer Jude, Max Schülein war in der Öffentlichkeit weniger bekannt, obwohl der gebürtige Ingolstädter um 1900 zusammen mit seinem Verwandten Otto Schülein die Eisengießerei Josef Frimberger (gegründet 1868) an der Münchner Straße erwarb, den Grundstock des späteren Schlütergeländes. Max, der die Firma als Teilhaber führte, wohnte anfangs in einem Gebäude, welches auf dem Werksgelände stand, ab 1917 wechselte er öfters seinen Wohnsitz bis er ab 1925 in der Oberen Domberggasse Nr. 15 wohnte. Die Maschinenfabrik Schülein wurde 1912 von dem Fabrikbesitzer Anton Schlüter eingesteigert.
Max Schülein arbeitete jedoch weiterhin bis 1938 als Betriebsleiter im Werk. Das Freisinger Tagblatt hetzte dann im August 1938, "dass eine große arische Firma immer noch einen jüdischen Provisionsvertreter beschäftigt und sich nicht schämt".
"Wir stehen als Juden vor der Tatsache, dass eine feindliche Macht die Regierungsgewalt in Deutschland übernommen hat". So lautet der Kommentar der Jüdischen Rundschau nach der Machtübernahme und der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30.1.1933. Die Machtübernahme durch das NS-Regime leitete den Prozess der Umwandlung der Weimarer Republik zur Einparteien- und Führerdiktatur ein.
Eine der ersten reichsweiten Maßnahmen gegen jüdische Bürger Deutschlands war der Aufruf zum Boykott der jüdischen Geschäfte am 1. April 1933. Auch in Freising marschierten SA- Angehörige vormittags vor den jüdischen Geschäften auf, brachten dort Plakate an und postierten sich bewaffnet vor den Türen. Neben der Boykottaktion durften ab April 1933 auch keine jüdischen Inserate mehr in der Zeitung gedruckt werden. Auch die Ausübung anderer beruflicher Tätigkeiten wurde weitestgehend untersagt oder erschwert. Die ehemaligen Kunden besuchten die Warenhäuser kaum noch oder ließen sich aus Angst, gesehen zu werden, ihre Waren auf telefonische Bestellung bringen. Damit war der erste Schritt zur gesellschaftlichen Ausgrenzung getan.
Unterstützt und verschärft wurden diese Terrormaßnahmen durch eine antijüdische Propaganda (Stürmer, Presse, Filme wie Jud Süß) und den Erlass einer Flut von antijüdischen Rechtsvorschriften (an die 2000). Schließlich führten die Nürnberger Gesetze vom 15.9.1935 auch in Freising zu weiteren Schikanen der jüdischen Bürger. So musste sich z.B. Siegfried Neuburger einem Verhör unterziehen, weil er bei seinen Kundenfahrten aufs Land weibliche Angestellte mitnahm. Da sein Kaufhaus von der gegenüberliegenden Kreisleitung im alten Magistratsgebäude besonders scharf überwacht wurde und er deshalb fast nur noch mit den umliegenden Bauern Geschäfte machen konnte, unternahm er vermehrt diese Fahrten. Wegen des "Umgangs mit arischen Angestellten in der Öffentlichkeit" wurde er in Schutzhaft genommen. Bei den Neuburgers wurde gegen Ende 1938 - kurz vor ihrem Wegzug - die Post überwacht. Aus diesen Briefen geht hervor, dass "sie sich des Lebens nicht mehr sicher fühlten". Aus einer Pfändungsverfügung vom 29.11.1938, die Siegfried Neuburger in Dachau unterzeichnet hat, geht weiterhin hervor, dass er auch im dortigen KZ gewesen sein muss. Einer der letzten behördlichen Eingriffe, der noch in Freising getätigt worden ist, war die zwangsweise Umänderung der Namen. So mussten die drei Geschwister Neuburger beispielsweise ab Oktober 1938 die Namen Assur, Sally und Tana tragen.
Das Pogrom vom 9.11.1938 war das Signal für den Wendepunkt in der antijüdischen Politik Es war der Übergang von der Entrechtung, Verfolgung und Vertreibung zur Vernichtung. In der sog. Reichskristallnacht wurden im Deutschen Reich 90 Juden ermordet und 6000 sich im jüdischen Besitz befindliche Geschäfte zerstört oder schwer beschädigt. Jüdische Wohnungen wurden gestürmt und über 30.000 Juden festgenommen und ins KZ gebracht. Den Juden im Deutschen Reich wurde der Besuch von Kulturveranstaltungen verboten, der Führerschein abgenommen, der Schulbesuch an deutschen Schulen untersagt und das Ablegen von Prüfungen bei Handwerks- und Industriekammern nicht mehr gestattet. Ärzte und Apotheker verloren ihre Zulassung und alle Juden bekamen ein großes J in ihren Pass gestempelt. Wer sein Vermögen an den Staat verpfändete, durfte beschleunigt ausreisen.
Am 10. November 1938 fand auch in Freising die zweite große, öffentlich organisierte Aktion gegen jüdische Bürger und judenfreundlich gesinnte Mitbürger statt.
Ausgehend von vier großen Veranstaltungen, die die NSDAP-Ortsgruppe im Kolosseum, im Stieglbräu, beim Neuwirt und im Grünen Hof organisiert hatte, wurde die Bevölkerung aufgehetzt. Eine größere Menschenmenge mit Schildern marschierte vor das Haus der Neuburgers und das der Holzers und forderte lautstark, dass alle Juden Freising endlich verlassen sollten. Dabei wurde Irma Holzer auf der Straße von der Menge gedemütigt, die Fensterscheiben des Kaufhauses Neuburger wurden eingeschlagen und die Fassade mit der Aufschrift "Der Jud muss hinaus. Auf nach Palästina", versehen.
Auch der Rechtsanwalt und spätere langjährige Freisinger Bürgermeister (Amtszeit von 1948- 1979) Max Lehner gehörte in dieser Nacht zu den Verfolg-ten. Ihm wurde vorgeworfen, jüdischen Familien Rechtsbeistand geleistet zu haben. Ein Teil der Menge zog zu seinem Haus, forderte den "Judenknecht" zum Herauskommen auf und holte ihn schließlich mit Gewalt. Sie schlug ihn und führte ihn mit einem Schild mit der Aufschrift "Juda verrecke" durch die Stadt, bis die Polizei ihn in Schutzhaft nahm. Später erklärte ihm Kreisleiter Lederer, dass er in Freising keine Möglichkeit mehr habe, seinen Beruf als Rechtsanwalt weiter auszuüben.
Unter dem Eindruck dieser Ereignisse verließen die verbliebenen jüdischen Familien fluchtartig Freising, ihre Häuser wurden arisiert. Die Lewins (Frau Johanna war bereits im Juli 1921 gestorben) hatten schon 1936 Freising verlassen, verkauften erheblich unter dem Erwerbspreis ihr Haus an Friedrich Langbein. Martin Holzer wanderte nach Palästina aus, die übrige Familie zog nach München. Hans Obster übernahm das nun "deutsche Geschäft". Am längsten blieben die Neuburgers in der Stadt. Sie verkauften ihr Geschäftsgebäude erst im Mai 1939. Ihre offizielle Abmeldung nach München erfolgte erst am 27.10.1939.
Erste Fluchtstation der jüdischen Familien war also München. Dort wurden sie aber nach einiger Zeit in Sammellagern zusammengefasst und dann begann mit den Deportationen die systematische Vernichtung der Juden.
Die drei Geschwister Neuburger wurden am 20.11.1941 nach Riga gebracht und starben vier Tage später bei einer Erschießungsaktion in Kowno.
Irma Holzer und Max Schülein wurden zusammen mit 341 jüdischen Personen am 4.April 1942 in ein Durchgangslager nach Piaski in Polen deportiert.
Bernhard und Henriette Holzer wurden ebenso wie die Frau und Tochter von Oskar Holzer (am 25. April 1939 in München gestorben), Hanna und Ilse, im Juli 1942 nach Theresienstadt in Nordböhmen gebracht, wo sie einige Monate später den Tod fanden. Siegfried Holzer war zusammen mit seiner Frau Hedda im September 1938 nach Frankreich emigriert, wurde jedoch von dort nach Auschwitz deportiert.
Marcus Lewin hat sich im Juli 1942 im Sammellager in München in Berg am Laim das Leben genommen.
Überlebt haben den Holocaust nur zwei der Freisinger Juden. Hildegard Lewin und Martin Holzer waren gerade noch rechtzeitig aus Deutschland ausgewandert. Beide kehrten nach dem Krieg nach Oberbayern zurück, jedoch nicht nach Freising.
Infolge der Rückerstattung und der Entschädigung der jüdischen Opfer bekam Hildegard Lewin wieder ihr Haus in der Unteren Hauptstraße zurück. Später übertrug sie es an ihre Freundin Berta Lengger, die es dann an die Stadt Freising weiterverkaufte.
Quellen:
Pfeiffer, Sandra: Spuren jüdischen Lebens in Freising, Facharbeit (Gymnasium) 1996
Goerge, Rudolf: Spuren jüdischer Kultur und jüdischen Lebens im Freisinger Raum. In: Amperland 1991, Heft 1 und 2
Kochendörfer S. und Schmid, T.: Freising unterm Hakenkreuz, 1983
Stadtarchiv Freising: Bestand Altakten III- Sammelakt Juden, Korrespondenz
Bürgermeister, Einwohnermelde- und Familienbögen, Heimat-, Ansässigkeits- und Verehelichungsakten, Nachlass Lehner, Freisinger Tagblatt 1928, 1933, 1938
Stadtarchiv München: Volkskennkarten
Staatsarchiv München: Akten des Landratsamtes und der Polizeidirektion Grundbuchamt Freising
Aktuelle Veröffentlichung und Informationen:
"...verzogen, unbekannt wohin" Stadtarchiv München, Pendo Verlag, November 2000 Internet:
www.hagalli.com/alenu/inhalt/hagalli.htm
Informationüber jüdische Religion und Kultur. Mit allen wichtigen Links. Shoanet.hbi-stuttgart.de
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Zur Geschichte der Freisinger Juden im Zeitraum 1880-1945"?
Der Text befasst sich mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Freising zwischen 1880 und 1945, einschließlich ihrer Verfolgung und Vernichtung während des Nationalsozialismus.
Gab es in Freising eine jüdische Gemeinde?
Obwohl Freising nicht für eine große jüdische Gemeinde wie in anderen Städten bekannt war, lebten seit dem Mittelalter Juden in der Stadt, wie durch historische Dokumente belegt ist.
Welche jüdischen Geschäfte gab es in Freising?
Der Text nennt drei bedeutende jüdische Geschäfte: Die Modewarenhandlung Neuburger (Bahnhofstraße 4), das Warenhaus der Gebrüder Holzer (Obere Hauptstraße 9) und das Warenhaus Max Krell Nachfolger (Untere Hauptstraße 2).
Wer war Ignaz Neuburger?
Ignaz Raphael Ignaz Neuburger war ein Kaufmann aus Buchau in Württemberg, der sich 1881 in Freising niederließ und die Modewarenhandlung Neuburger gründete. Er und seine Familie genossen in Freising hohes Ansehen.
Wer waren die Gebrüder Holzer?
Bernhard und Oskar Holzer kamen 1892 aus Stein am Kocher nach Freising und betrieben das Warenhaus Holzer in der Oberen Hauptstraße. Sie waren ebenfalls in der Stadt integriert.
Wer waren die Lewins?
Die Lewins, bestehend aus Marcus Lewin und seiner Frau Johanna, besaßen das Warenhaus Max Krell Nachfolger in der Unteren Hauptstraße. Es war das größte jüdische Geschäft in Freising.
Wer war Max Schülein?
Max Schülein war Mitinhaber der Eisengießerei Josef Frimberger, die später zum Schlütergelände wurde. Er war weniger bekannt in der Öffentlichkeit, arbeitete aber weiterhin bis 1938 im Werk.
Welche Auswirkungen hatte die Machtübernahme der Nationalsozialisten auf die Juden in Freising?
Nach der Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 begannen Boykottaktionen, antijüdische Propaganda und der Erlass von diskriminierenden Gesetzen, die zur gesellschaftlichen Ausgrenzung und Verfolgung der Juden in Freising führten.
Was geschah in der Reichskristallnacht in Freising?
Am 10. November 1938 wurde in Freising die Bevölkerung gegen jüdische Bürger aufgehetzt. Es kam zu Demonstrationen vor den Häusern der Neuburgers und Holzers, Demütigungen, Zerstörungen und Verhaftungen. Auch Max Lehner, der jüdischen Familien Rechtsbeistand leistete, wurde verfolgt.
Wie endete das Leben der Freisinger Juden?
Die meisten der in Freising lebenden Juden wurden deportiert und in Konzentrationslagern ermordet. Nur Hildegard Lewin und Martin Holzer konnten rechtzeitig emigrieren und den Holocaust überleben.
Was geschah nach dem Krieg mit dem Besitz der jüdischen Familien?
Hildegard Lewin bekam ihr Haus in der Unteren Hauptstraße im Rahmen der Rückerstattung zurück und verkaufte es später an die Stadt Freising.
Woher stammen die Informationen über die Geschichte der Freisinger Juden?
Die Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, darunter Facharbeiten, Artikel, Stadtarchiv-Dokumente, Gerichtsakten und aktuelle Veröffentlichungen.
- Arbeit zitieren
- Wolfgang Grammel (Autor:in), 2000, Zur Geschichte der Freisinger Juden im Zeitraum 1880-1945, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99543