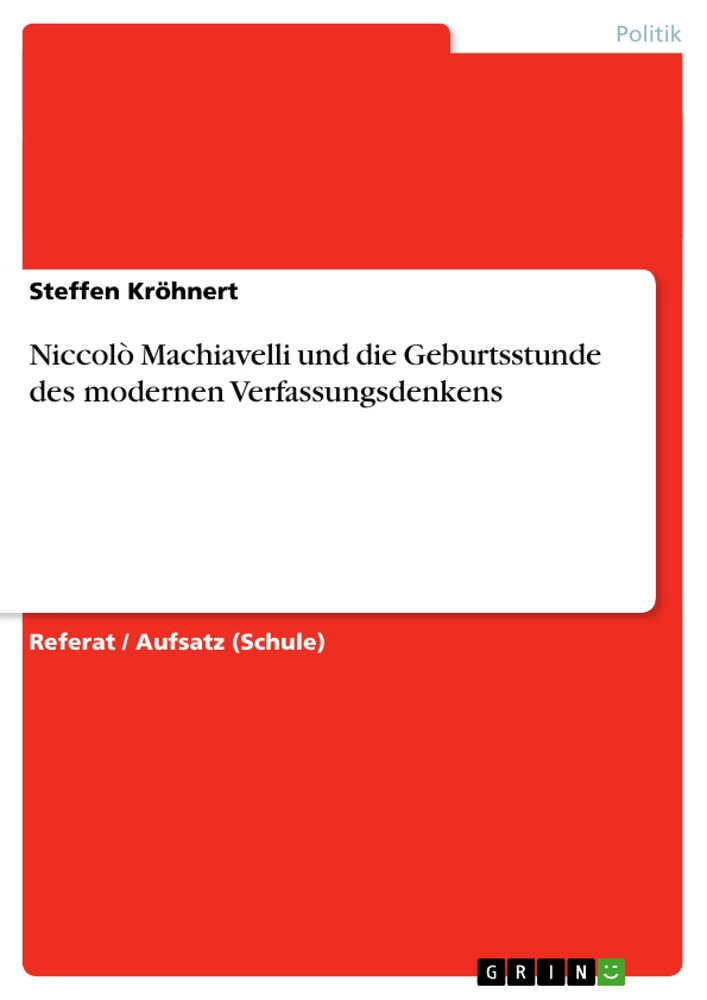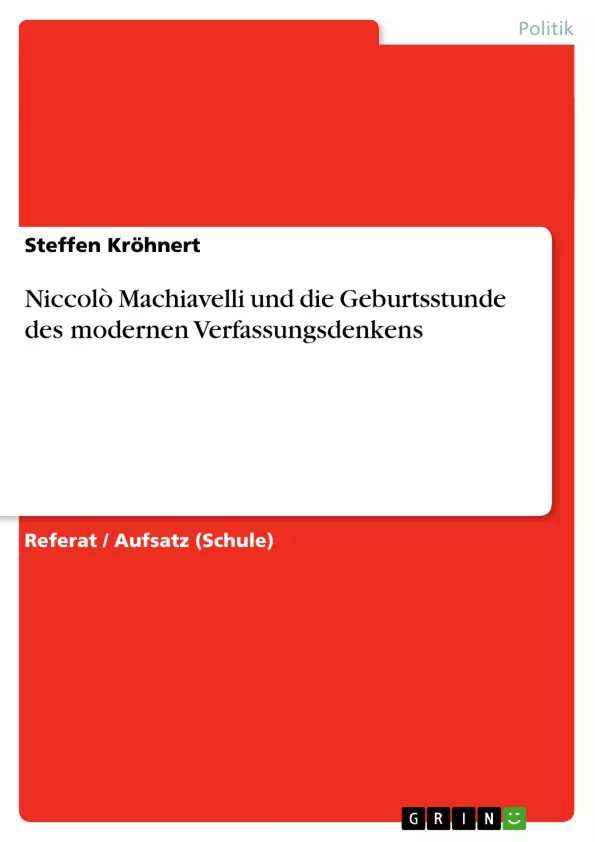Niccolò Machiavelli und die Geburtsstunde des modernen Verfassungsdenkens
Florenz im 13. Jahrhundert. Ein Staat, der mit einiger Berechtigung als erster moderner Staat der Weltgeschichte bezeichnet werden kann. Durch Produktion und Fernhandel mit hochwertigen Wollentuchen war das Bürgertum von Florenz zu enormem Reichtum gelangt. Ein Reichtum der nicht nur ökonomische Macht verlieh, sondern auch die Frage der traditionellen politischen Machtverhältnisse anrührte. Nicht nur waren Adlige, die traditionellen Machthaber, die größten Schuldner der bürgerlichen Bankiers geworden, auch der Wert des adligen Grundbesitzes, jahrhundertelang der einzig ertragbringende Besitz, wird durch die ökonomische Entwicklung relativiert. Das bisher eher zyklische Zeitdenken, bestimmt durch die Wiederkehr von Saat und Ernte, die relative Unzerstörbarkeit und Unvermehrbarkeit von Grund und Boden, bisher alleinige Quelle von Macht und Ansehen, wird zunehmend von der ökonomischen Rationalität des aufgestiegenen Bürgertums bedrängt. Die traditionale Weltsicht des Adels wird zunehmend abgelöst von einer rational kalkulierenden. Die Zunahme der Bedeutung der Geld- gegenüber der Naturalwirtschaft spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die Einführung des Zinses, des Kontokorrents, des Fillialbankensystems und der Versicherung steigerte noch die ohnehin intensivere Nutzbarkeit von Kapital gegenüber Boden, beschleunigte Handel und Produktion, machte die ursprünglich gering geachtete Zeit zur geldwerten Einheit. Der wohlhabende Bürger dieser Zeit glaubt nicht mehr daran, den Mächten des Schicksals oder dem göttlichen Willen chancenlos ausgesetzt zu sein. Anstelle des mittelalterlichen `Ordo' tritt der Gedanke der rationalen Planbarkeit der Welt durch den Menschen.
In dieser Tradition steht auch der 1469 geborene Niccolò Machiavelli. Zwar ist zu seiner Zeit die erste Florentinische Republik von 1293 längst untergegangen, und Florenz ist fernab von geordneten Verhältnissen. Doch gerade die Krise der Republik Florenz treibt ihn zu einer Analyse der Politik in der ein Element neu ist: Die Möglichkeit politischen Eingriffs in den Lauf der Welt, die rationale Gestaltbarkeit politischer Ordnung.
,,Klagt der alten Unordnungen wegen nicht die Natur des Menschen an..."
Es war eine bewegte Zeit in Florenz. Auf die Vertreibung des tyrannisch herrschenden Piero de Medici 1494 und die Errichtung des Gottesstaates von Girolamo Savonarola folgte dessen Hinrichtung, die Rückkehr zur Republik und schließlich der Sturz der republikanischen Regierung und die Wiederkehr der Medici als Herrscherfamilie. Kämpfen zwischen Papst- und Kaisertreuen folgten Händel zwischen den Ständen. Weil Machiavellis Zeit so reich an Konflikten war, trieb ihn zeitlebens um, wie mit diesen offenbar unvermeidlichen Konflikten zu verfahren sei, ohne dass die Gesellschaft in Blut und Chaos versinke.
Die Betrachtung von gesellschaftlichen Konflikten geschah aber zu jener Zeit im wesentlichen auf zwei Arten. In Anlehnung an Dolf Sternberger könnte man sagen: Konflikte wurden entweder dämonologisch, im Sinne der unbedingten Unterwerfung der gegnerischen Partei (so von den Condottieri und Kriegsherren), oder eschatologisch, im Sinne des Suchens nach der guten, gerechten Ordnung die Konflikte aufhebt und ewigen Frieden schafft (so von den Priestern und Philosophen), betrachtet. Abweichend von Sternbergers Einschätzung, der ja die Dämonologie an Machiavelli anschließen lässt, kann man aber an Machiavellis Verfassungsdenken sehen, dass er zu unrecht einer solchen Parteinahme für das Recht des Stärkeren beschuldigt wird. Beleuchtet man Machiavellis politisches Verständnis näher, so wird klar, dass er nicht den auf `Il Principe' verengten Dämonologen darstellt, sondern mit seiner verfassungsmäßigen Behandlung von gesellschaftlichen Konflikten eine für die Neuzeit modernes Verfassungsverständnis entwickelt.
Charakteristisch für die Renaissance, die den Anspruch erhob sich auf die antiken Wurzeln der Kultur zurückzubesinnen, orientiert sich auch Machiavellis politisches Denken an antiken Vorbildern. Hatte bereits Aristoteles eine Theorie der guten Regierungsformen und deren Entartungen aufgestellt, so entwickelt Polybios einen Kreislauf der Verfassungen, der entsprechend der antiken Vorstellung von der Vollkommenheit der Natur im ewigem Umlauf begriffen ist. Diese zyklische Vorstellung von Aszendenz und Dezendenz der politischen Verfasstheit der Gemeinwesen macht sich Machiavelli weitgehend zu eigen. Kommt durch natürliche Vermehrung der Bevölkerung eine bestimmte Zahl an Menschen an einem Orte zusammen, so wählen die bisher `unbeherrschten' ein geachtetes und befähigtes Gemeinschaftsmitglied zu ihrem Anführer, zum Monarchen. Damit ist die Urmonarchie, die erste existierende Verfassungsform nach dem `Naturzustand' entstanden. Da jedoch ,,überall wo die Natur am Wirken ist sich Wachstum, Scheitelpunkt und Niedergang findet" kann diese Regierung des fähigen Monarchen nicht von Dauer sein.
Aristoteles setzte seinen drei `guten' Verfassungsformen, die er jeweils nach der Anzahl der Herrschenden unterschied, Monarchie als Herrschaft des Einen, Aristokratie als Herrschaft der Wenigen und Politie als Herrschaft der Vielen, die aber alle die Herrschaftsgewalt im Interesse des Gemeinwohls ausüben, drei `schlechte' Regierungsformen entgegen.
Vernachlässigt der Monarch das Gemeinwohl und herrscht nur noch im Interesse seiner selbst entartet die Monarchie zur Tyrannis. Üben die Aristokraten die Herrschaftsgewalt nur noch zu ihrem eigenen Vorteil aus verkommt die Aristokratie zur Oligarchie, zur Herrschaft der Reichen. Die Politie, oder Republik ist nach Aristoteles die Staatsform, in der die Vielen (das Volk) den Staat zum gemeinsamen Besten verwalten. Schon Aristoteles machte sich aber keine Illusionen darüber, dass das `gemeinsame Beste' etwa immer das sein, was bei einer beliebigen Volksversammlung mehrheitlich mit gleichen Stimmen beschlossen werde. Politie war für ihn eine Herrschaftsordnung in der den Bürgern Rechte und Pflichten nach ihrer Ehre und ihren Verdiensten, einschließlich ihres Vermögens, zustehen. Niemand war also prinzipiell von der Regierung ausgeschlossen, konnte mehr oder weniger bedeutende Ämter aber nur durch nachgewiesene Eignung über seine Ehre oder sein Vermögen einnehmen. Die unmittelbare Demokratie sah Aristoteles dagegen als schlechte Regierungsform an, ,,wo der Herr fehlt - denn da sind alle gleich -, und wo das Oberhaupt schwach ist und jeder tut was ihm gefällt". Die Gefahr der Direktdemokratie sah er in einer Herrschaft ausschließlich zum `Vorteil der Armen' (was mit dem `Besten' aller nicht zu vereinbaren ist), in der Gefahr der demagogischen Verführung der Massen durch gute Redner und der emotionalen Anheizung des Volkes.
Polybios nun entwickelt aus diesen Staatsformen die Theorie eines ewigen Kreislaufs der Verfassungen, den `politeion anakyklosis'. Polybios versucht damit den Ablauf der Geschichte in einen logischen Zusammenhang zu bringen der den antiken Vorstellungen der Vollkommenheit der Natur entsprach. Er verbindet dazu die Verfassungen mit einer Art Zickzacklinie: Scheidet der weise Monarch eines Tages dahin und seine Nachkommen werden in der Erbfolge mit der Macht betraut, so ist deren Eignung für die Herrschaft zum Gemeinwohl keineswegs mehr sichergestellt. Eines Tages wird einer seiner Nachkommen, von Wohlleben und Eitelkeit, Ruhmsucht oder Habgier besessen, beginnen das Volk zu unterdrücken und es zu seinem eigenen Vorteil auszupressen. Wenn dass Fass bis zum Überlaufen voll ist werden sich die Edlen des Landes verbünden, um den Tyrannen zu töten. Eine Regierung der Ehrenmänner, eine Aristokratie, löst die Tyrannei ab. Doch auch deren Herrschaft ist nicht von Dauer denn ,,Ehrgeiz, Gier und Gelüst nach Weibern," wie Machiavelli sich später ausdrückt und welches die mit Macht versehenen Aristokraten eines Tages unweigerlich befällt, richten den Staat zugrunde und verwandeln ihn in eine Oligarchie. Diese verkommenen Oligarchen werden schließlich vom Volke gestürzt, welches zunächst aus Gewohnheit nach dem Gesetz lebt und geeignete Repräsentanten zur Regierungsausübung wählt. Schließlich jedoch siegt die Tendenz des Volkes zur Zügellosigkeit. Es entsteht eine Gesellschaft des Lasters, der Anarchie und des Chaos. Schließlich, im letzten Zyklus des `politeion akakyklosis' angelangt, wählt das Volk in seiner Not wieder einen Fähigen zum Monarchen, um das Chaos zu beenden. Der Kreis ist geschlossen.
Machiavelli lehnt sich in seinem Politikverständnis deutlich an Polybios an. Allerdings sind seit Polybios 1500 Jahre vergangen, Machiavelli ist Renaissancebürger und lebt im krisengeschüttelten Florenz. Machiavelli zweifelt, dass ein Staat Polybios Kreis mehrmals durchlaufen kann. Zeigt ihm doch der Zustand Italiens seiner Zeit, dass Staaten in Phasen ihrer Schwäche Gefahr laufen zerschlagen, zerstört und von äußeren Feinden geknechtet zu werden. Besessen von der Idee des stabilen Staates, von der Sehnsucht nach tugendhaften, überdauernden Verhältnissen kann er sich Polybios eher resignativer Grundhaltung über die notwendig ewige Abfolge der Dinge nicht anschließen. Er glaubt nicht mehr an einen naturgesetzlichen oder göttliche Kreislauf. Er kommt zu einer eher psychologischen Analyse dieses Kreislaufes, die Abfolge von Tugend, Gier, Ehrgeiz und Verfall. Und er versucht die Zwangsläufigkeit dieser Abfolge zu brechen, er will Fortuna zwingen.
Machiavelli untersucht historische Abläufe und politische Theorie erstmals im Hinblick auf die Chance der menschlichen Beeinflussung. Der Versuch des Umgangs mit der Differenz zwischen Determiniertheit und Determinierbarkeit gesellschaftlicher Zusammenhänge ist es, der Machiavelli zum Begründer des politischen Denkens der Neuzeit macht. Wirklich determiniert (so Karl Mannheim) ist nur derjenige, der die determinierenden Fakten nicht kennt, sondern unmittelbar unter dem Druck der ihm unbekannten Faktoren handelt. Aber auch derjenige ist handlungsunfähig, der von einem von transzendenten oder naturgesetzlichen Kräften bestimmten Ablauf der Dinge ausgeht. Politik ist nur möglich, wo zwischen beidem ein Spielraum besteht. Und dieser Spielraum ist es, dem Machiavelli sein Schaffen widmet.
In den `Discorsi' geht Machiavelli so weit zu sagen, dass jede der bei Polybios genannten Verfassungsformen unheilbringend sei. Die drei guten, weil sie nur kurz andauern können, und die drei schlechten wegen ihrer Verderblichkeit an sich. Machiavelli untersucht die Geschichte nach Staatsformen die keines der beiden Übel, kurze Dauer oder Verderblichkeit, aufgewiesen hatten und kommt zu dem Schluss: ,, Deshalb vermieden weise Gesetzgeber, diese Mängel erkennend, eine jede der drei guten Verfassungsformen in Reinform und erwählten eine aus allen dreien zusammengesetzte. Diese hielten sich dann für die festeste und dauerhafteste, da Monarchie, Aristokratie und Demokratie, in einem und demselben Staate vereinigt, sich gegenseitig überwachen." (Discorsi I 2) Damit hat Machiavelli einen Gedanken, der den Kreislauf des Polybios nicht anhalten will, sondern den Kräften dieses Rades ihre notwendige Entfaltung lässt, sich gleichwohl auf die Nabe des Rades stellt.
Gelänge es, die zentrifugalen Kräfte der Staatsformen so in eine Staatsverfassung einzubinden, dass sie sich gleichsam gegenseitig neutralisieren, dann müsste doch die ersehnte Stabilität erreicht werden! Hier beginnt Machiavellis Idee des geordneten Konfliktes als Garant staatlicher Stabilität. Dabei zeigt sich, dass die Verkürzung Machiavellis' Denken auf reine Machttechnologie ihm nicht gerecht wird. In seiner Denkschrift über die Reform des Staates Florenz schreibt er: ,, Die, welche eine Republik konstituieren, müssen drei verschiedenen Klassen von Menschen, die in allen Städten sind, Raum geben, nämlich den ersten, den mittleren und den letzten." Als Ursache für die Instabilität der Florentiner Staatsverfassungen sieht er eine an, die seiner Meinung nach so wichtig war wie alle übrigen Ursachen zusammen, ,, nämlich dass das Volk nicht seinen Teil an der Regierung hatte." Dabei ist Machiavelli klar, dass es nicht darum gehen kann in idealistischer Weise von dem `guten Willen' der Bürger auf gleichberechtigte und diskursive Partizipation an der Regierung auszugehen. Vielmehr schätzt er ganz klar ein, ,,dass in jeder Republik das Denken und Streben der Großen und des Volkes verschieden sind..."
Machiavelli ist kein Menschenverächter, wie ihm oft vorgeworfen wurde. Er ist jedoch der Überzeugung, dass Menschen nicht von Natur aus irgendwelche positiven Eigenschaften besitzen. Der Mensch ist von Natur aus mit Unruhe beseelt, so dass er mit dem Erreichten nie zufrieden ist und stets mehr begehrt. Deshalb wird der Mensch nur `gut' im Sinne seiner virtu handeln, wenn er von einer `guten' Staatsform dazu angehalten wird.
Für Machiavelli gibt es nur ein Mittel die Konflikte zwischen den naturgemäß verschiedenen Interessen der Stände nicht zu unterdrücken, aber in ihrem zerstörerischen Potential für den Staat zu neutralisieren. Dieses Mittel ist das Gesetz. Das `gute' Gesetz hat bei Machiavelli im wesentlichen drei Funktionen: Erstens soll es dazu führen, dass die Stände ihre Eigeninteressen in geordneter Weise vertreten können. Zweitens soll es die Bürger in ihrem ganzen Handeln zu tugendhaftem Verhalten anleiten und vor Zügellosigkeit abschrecken. Drittens schließlich soll das gute Gesetz Bürgern einen Weg eröffnen, vermeintlich erlittenes Unrecht anzuklagen und sich dadurch Genugtuung zu verschaffen.
Der Staat bzw. seine Verfassung ist somit für ihn nicht reiner Selbstzweck, sondern er ist das Gefäß, das allein die Tugendhaftigkeit seiner Bürger zu sammeln und zu bewahren vermag. Weil dies so ist muss ein Gesetzgeber stets von den üblen Neigungen der Menschen ausgehen und sich bewusst sein, ,,dass die Menschen niemals etwas Gutes tun, wenn sie nicht dazu gezwungen sind, sondern dass alles in Verwirrung und Unordnung gerät, sobald ihnen freie Wahl bleibt und sie sich gehen lassen können." (Disc.I 3.)
Neben dieser Vorstellung der politischen `Erziehung' der Bürger durch das Gesetzt vertritt Machiavelli gleichwohl eine äußerst moderne Vorstellung der Institutionalisierung von Konflikten durch das Gesetz, um so Emotionen zu kanalisieren und den Bürgern ohne zerstörerische Auswirkungen Genugtuung zu verschaffen. In seiner ihm eigenen Art versucht Machiavelli die Richtigkeit seiner Ansichten an historischen Beispielen nachzuweisen: Als das Volk von Rom hörte, dass Coriolan durch Zurückhalten von Getreide, also mit Hilfe des Hungers, die Macht Volkes zugunsten der des Adels beschneiden wollte, geriet es in solche Wut, dass es Coriolan wohl gelyncht hätte, hätten ihn nicht die Tribunen vorgeladen sich vor dem Volke zu verteidigen. Das Tribunal gibt den Beschuldigten Gelegenheit zur Verteidigung und den Gekränkten Genugtuung. Damit vermeidet man, dass sich Bürger aus Furcht oder Hass zusammenrotten oder Parteien (bei Machiavelli stets im Sinne von `Seilschaften' gebraucht) bilden. Als Negativbeispiel führ er die toskanische Stadt Clusium an. Ein Bürger, dem von einem anderen Unrecht geschehen war, suchte, da er keine Möglichkeit sah die Tat des Verbrechers anzuklagen, die Barbaren auf und beredete sie zum Feldzug gegen seine Vaterstadt.
,,Die Feindschaften, welche am Anfang in Rom zwischen Volk und Edlen bestanden wurden durch Worte, die von Florenz durchs Schwert entschieden"
Machiavelli sollte einmal Gelegenheit haben, über die ex post Beurteilung von historischen Staatsformen hinausgehend, einen eigenen Verfassungsentwurf vorzulegen. Auf Anregung von Kardinal Guliano de'Medici und Papst Leo X., als nach dem frühen Tod von Lorenzo de'Medici die politische Zukunft von Florenz scheinbar zur Disposition stand, verfasst er einen solchen Entwurf für den Staat Florenz. In dieser Denkschrift zeigt er wiederum seine, von den politischen, historischen, ökonomischen und sozialstrukturellen Gegebenheiten eines Landes abgeleitete Vorstellung vom `richtigen' Handeln, von der `richtigen' Staatsverfassung. Für Florenz stellt er fest, dass die noch im Gedächtnis der Bürger bewahrte republikanische Vergangenheit von Florenz und das Fehlen eines breiten Adelsstandes die Errichtung einer Republik, außer der er nur die Monarchie für eine stabile Staatsverfassung hält, am besten geeignet ist. (wäre es doch nötig ,,...viele Adlige mit Türmen und Burgen zu schaffen, die im Verein mit dem Fürsten durch die Waffen und ihren Anhang die Stadt und das ganze Land unter Druck hielten") Er sagt aber auch, dass die Zeiten sich geändert haben und dass es nicht möglich sei, einfach zur alten republikanischen Verfassung zurückzukehren. Machiavelli versucht nun den Spagat, eine Verfassung zu erdenken, die den verschiedensten Interessen gerecht wird und sie ausgleichen kann: die monarchischen Interessen Leo X. der zumindest
bis zu seinem Tod weitgehende Machtbefugnisse behalten will und die Interessen der drei Stände, denen Partizipationsrechte eingeräumt werden müssen.
Machiavelli ersinnt ein stark technizistisches Partizipationsmodell, dass seine Grundidee vom `geordneten Konflikt' jedoch gut wiederspiegelt:
Der oberste Stand wählt einen Rat der Fünfundsechzig (die Signoria), die die eigentliche Regierung stellt. Für den mittleren Stand würde ein Rat der Zweihundert (Rat der Erwählten) errichtet (allerdings während dessen Lebzeiten allesamt von Leo ernannt), der Ämter besetzt und Geschäfte ausübt. Schließlich würde für die `Masse der Bürger' der Rat der Sechshundert eingerichtet. Machiavelli will eine Verfassung einrichten, die während der Lebzeiten von Leo X. seine Macht sichert, danach jedoch den Übergang zu einer reinen Republik ermöglicht. Einstweilen erhält dieser deshalb die volle Gesetzgebende und militärische Gewalt. Machiavelli hat sehr weitgehende und aus heutiger Sicht seltsam anmutenden Vorstellungen des Interessenausgleichs durch Ämterrotation bis hin zur Ämterbesetzung durch das Los. Mögen auch die von ihm erdachten kurzen Amtszeiten (die aus der Signoria erwählte Regierung jeweils 3 Monate, die Vorgesetzten der Volkskompagnien für einen Monat in denen dann je eine Vorgesetzter für eine Woche (!) mit den regierenden Signoren den Palast bewohnt) untauglich erscheinen, so gibt es doch ein äußerst modernes Element in seinem Entwurf: Die zwingende Teilnahme von Mitgliedern des einen Gremiums an den Sitzungen und Beschlüssen des anderen, ohne beschließende Stimme zwar, aber mit einem Vetorecht ausgestattet das den Beschluss im Zweifelsfalle an das niedere Gremium verweisen kann.
,,In seiner (des Vertreters der Volkskompagnien S.K.) Abwesenheit könnten die im Palast residierenden Signoren keine Amtshandlung vornehmen. Er selbst hätte keine Stimme zu geben, sondern nur Zeuge ihrer Handlungen zu sein; wohl aber könnte er verhindernd eintreten und verlangen, dass eine Sache an die Zweiunddreißig überwiesen werde. Ebenso könnten die Zweiunddreißig nichts ohne die Gegenwart zweier der besagten Vorgesetzten beschließen, welche keinen andere Gewalt hätten, als eine Beratung abzubrechen und sie an den Rat der Erwählten zu überweisen. Ebenso wenig könnte der Rat der Zweihundert etwas tun, wenn nicht wenigstens sechs von den Sechzehn nebst zwei Vorgesetzten dabei wären, welche ihrerseits nichts anderes tun könnten als eine Sache diesem Rat zu entziehen und an den Großen Rat zu überweisen,..." (Denkschrift über die Reform des Staates Florenz)
Die Idee Machiavellis, die hinter diesen sperrigen Formulierungen hervortritt ist die, Konflikte auszugleichen, legitime Einspruchsmöglichkeiten zu schaffen und Beschlussfähigkeit sicherzustellen. Kein Vertreter kann nämlich die Beschlussfassung eines Gremiums nur blockieren, er kann die Entscheidung lediglich an einen anderen Ort verweisen. Dies kann er auch dann, wenn ein Gremium aus Uneinigkeit oder vielleicht Unwillen keinen Beschluss fassen will. Eine Blockade durch Nichthandeln eines Rates soll so ebenfalls verunmöglicht werden.
Ein anderes wichtiges und ebenfalls modernes Motiv dieser Verfassungskonstruktion ist das der Transparenz. Denn ,,ebenso wenig ist es gut, dass die Bürger niemand haben, der sie beobachtet und der bemerkt, dass sie sich der nicht guten Werke enthalten." Machiavelli versucht im Verfassungsentwurf zu verhindern, dass irgendeine Klasse von Bürgern aus Furcht vor einer anderen oder aus Ehrgeiz eine Umwälzung der Verhältnisse wünschen muss. Deshalb muss sie Sicherheit gegen Beschneidung der eigenen Freiheit gewähren, aber auch entsprechend der Ambition der Stände ehrenvolle Ämter bereithalten, die das Machtbedürfnis befriedigen.
Machiavellis `Discorso sopra il riformare lo Stato di Firenze' von 1520 offenbart die Motive seines politischen Denkens, realistisch war sein Glaube an die Auferstehung der Florentiner Republik dagegen zu jener Zeit nicht. Die Medici gewannen zunehmend Oberhand über die Partei der Optimaten (der `zu den Besten Gehörigen', eine Klasse von Oligarchen), die einzige Kraft in Florenz die den republikanischen Plänen wieder Auftrieb hätte verleihen können. Die Medici hatten deren Gonfaloniere abgesetzt und den Großen Rat aufgelöst. Über ihre Niederlagen zerstritten sich die Optimaten und mussten ohnmächtig dem Verfall ihrer Partei zusehen. Leo X. selbst hatte die Stadt in eine Art und Weise beherrscht, die allen Republikanern jegliche Illusionen hätte rauben müssen. Kurz nach seiner Besteigung des päpstlichen Throns übersandte er Lorenzo eine Denkschrift, in der alle wesentlichen Punkte der von den Medici zu betreibenden Politik zur Eroberung der Stadt eindeutig beschrieben waren. Durch die gesamte Instruktion Leo X. zog sich der Gedanke der absolutistischen Konzentration der Macht in den Händen des Herrschers und auf gründliche Beseitigung jeder anderen politischen Macht. Machiavelli muss wohl die Idee der Republik ungeheuer geliebt haben wenn er, der sonst so unbestechliche Pragmatiker, einen doch utopischen Entwurf liefert. Indem er Ruhm und Ehre desjenigen preist der Republiken und Reiche reformiert, indem er die Errichter einer Republik ,,nächst den zu den Göttern erhobenen" gesellt, versucht er die Medici zu einer politschen Reform zu locken, während sie ihre absolutistische Macht auf der Stadt lasten ließen. Machiavelli, der sich sonst immer darüber im Klaren war, dass politische Reformen ohne eine klar umrissene und starke politische Kraft illusionär bleiben müssen, verkennt wohl hier seine eigenen Möglichkeiten. Woher sollte in der noch kurz vorher tyrannisch regierten Stadt, wo jede politische Opposition liquidiert worden war, eine Unterstützung für ein so kompliziertes Institutionenmodell kommen? Was lässt ihn gar glauben sein Institutionenmodell würde unabhängig von den politischen Kräften der Stadt weiterexistieren können, was in dem Gedanken zum Ausdruck kommt seine Verfassung könne zu Lebzeiten der Medici eine Monarchie, nach deren Tod aber eine Republik begründen? Die Grenze des politischen Entwurfs von Machiavelli liegt wohl darin, dass er die durch und durch revolutionäre Natur seines Inhalts unterschätzt. Seine Umsetzung erfordert die Existenz völlig neuer politischer und gesellschaftlicher Kräfte, keine existierende Macht kann sie leisten. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum die minutiösen Analysen gesellschaftlicher Verhältnisse in den Discorsi und am Beginn der Denkschrift über die Verfassungsreform Machiavelli an die Funktionsfähigkeit seines überkomplexen Verfassungsentwurfs glauben lassen.
,,Wahr ist, dass einige Spaltungen den Republiken schaden, einige nützen..."
An mehreren Stellen seiner Schriften prangert Machiavelli die Faktions- oder Parteienbildung als schädlich oder gar als `Untergang eines jeden Staates' an. Es leuchtet aus der Sicht unseres heutigen, parteiengeprägten Politikverständnisses nicht auf den ersten Blick ein, wie diese Ablehnung mit Machiavellis Verfassungsdenken in Einklang zu bringen ist. Klar wird dies erst, wenn man sich die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit vor Augen führt. Florenz hatte zwar durch seine frühkapitalistische Entwicklung Ansätze gesellschaftlicher Differenzierung, so in Bürgertum und eine Art Protoproletariat, erfahren, blieb aber weitgehend eine nach Familien und Sippen organisierte segmentäre Gesellschaft, die mit ihren Machtkämpfen die Zeit beherrschten. Es ist diese `vertikale' Differenzierung anhand von Blutsbanden, Verpflichtungen und Gunstbeweisen, die den von Machiavelli angedachten geordneten Konflikt zwischen horizontalen Interessengruppen einer republikanischen Verfassung aushebelt. Machiavelli lässt in der `Geschichte von Florenz' einen angesehenen Bürger von Florenz eine Rede vor den Signoren halten, die mit allem Pathos das Elend dieser Parteienbildung schildert. Spaltete zunächst die Anhängerschaft an Ghibellinen und Guelfen die ganze Bürgerschaft der Stadt, so blieb die ersehnte Einigkeit auch nach der Niederlage der Ghibellinen aus, ,,denn die Stadt, welche mehr auf die Parteien als auf die Gesetze vertraut muss sich notwendig in sich selbst spalten, sobald eine Partei ohne Widerpart ist." Immer wieder fand sich Grund für Händel aus Ehrgeiz oder Habgier einzelner Familien - wie die Ricci und Albizzi - und deren Anhängerschaft. Die alten Familien von Florenz besaßen so große Macht, dass sie mit Institutionen und Gesetzen des Staates in ihren Ambitionen nicht zu zügeln waren. Im siebenten Buch der `Geschichte von Florenz' äußert sich Machiavelli dazu, was er unter schädlicher und nützlicher Spaltungen versteht. `Gut' ist eine Anhängerschaft die sich jemand durch Tätigkeit für das Gemeinwohl erwirbt, eine Schlacht gewinnt, die Republik weise berät. Schädlich ist es jedoch, wenn sich jemand eine Anhängerschaft durch `Privatmittel' zu sichern versucht. Damit ist gemeint, seine Anhänger durch persönliche Zuwendungen, Geld, Schutz, Beförderung in Ämter, `Brot und Spiele', gewogen zu machen. Machiavellis Begriff von der `schädlichen Faktionsbildung' meint also eine Art gegenseitiger Verpflichtung aufgrund persönlicher Vorteilsnahme und deckt damit einen Bereich ab, an dessen einem Ende unser moderner Begriff von Korruption steht. Korruption ist auch im heutigen Politikverständnis ein Element der Aushebelung rechtsstaatlicher Entscheidung, der Neutralisierung institutionalisierter Verfahren des Interessenausgleiches. Am anderen Ende dieses Bereiches steht aber auch ein Komplex von `Gunstbeweisen', sozialen Geschenken und geldwerten Belohnungen eines Politikers für seine Gefolg- und Wählerschaft, wie sie heute in Wahlkämpen und Parteikarrieren nach wie vor praktiziert wird. Eine Republik nur darauf gründen zu wollen sich Mehrheiten durch edles Streben nach Gemeinwohl, durch virtu, zu sichern ist wohl ein rein normativer und deshalb unrealistischer Gedanke. Trotzdem gibt seine Kritik der Faktionsbildung auch heute noch, in unserer vermeintlich im einsernen Gehäuse der Bürokratie steckenden Gesellschaft, Anlass zum Nachdenken.
Ein technizistisch ausgeklügeltes System der institutionalisierten Konfliktaustragung, wie von Machiavelli in seiner Denkschrift entworfen, eliminiert offensichtlich nicht völlig den Drang zur Faktionsbildung.
Gerade erst wurde die Republik Deutschland durch Enthüllungen erschüttert, dass der einstige Führer der christdemokratischen Partei Kohl möglicherweise nicht die institutionalisierten Verfahren der Konfliktaustragung genutzt habe. Durch Geldzuwendungen sollen Kreisverbände der Partei dem Parteiführer willfährig gemacht worden sein. Seinerseits soll Kohl durch umfangreiche Geldspenden von Unternehmen bewogen worden sein, den Spendern gefällige Entscheidungen zu treffen, die dann wiederum nicht etwa in den dafür geschaffenen Parteigremien gefällt, sondern durch persönliche Absprachen vorbereitet wurden. Die Form der institutionalisierten Konfliktaustragung blieb gewahrt, allein sie war nur noch Form, die eigentliche Entscheidung erfolgte an anderen Orten. Mitglieder, die in Opposition zum Parteiführer standen, wurden systematisch von Macht- und Enscheidungspositionen verdrängt und marginalisiert. Dem Parteiführer gefällige und verpflichtete Parteigänger dagegen lancierte er in bedeutende Ämter. Möglicherweise hätte Machiavelli gegen solche Art von Faktionsbildung gewettert. Doch er dachte zu idealisiert wenn er meinte, Bürger die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, hätten keine Anhänger, ,,die wegen eigenen Nutzens ihnen Gefolgschaft leisten", und deren Wettbewerb an Orten des verfassungsmäßig geordneten Konfliktes müsste deshalb auf die ,,Erhöhung der Republik" gerichtet sein. Im Florenz seiner Zeit waren es sicher die noch mittelalterlichen Familien- und Religionsstreitigkeiten, die Hauptursache der Faktionskämpfe waren. Jedoch können wir aus Sicht einer 500 Jahre vorangeschrittenen Entwicklung sagen, dass wohl auch ein komplexer Verfassungsentwurf zu Faktionsbildungen verführt. Denn sieht ein Politiker, der heute wie damals machtbewusst sein muss, die Chancen schwinden seine Interessen in komplizierten Verfahren durchzusetzen, so wird er nach informellen Wegen suchen um dies zu tun.
Noch komplizierter wird es, wenn man versucht das Verhalten des anderen großen Parteiführers in Deutschland mit Machiavellis Faktionsgedanken zu analysieren. Gerhard Schröder hat ein anderes Mittel gewählt, den unsicheren Ausgang komplexer instituitonalisierter Verfahren `erwartbar' zu gestalten. Dieses Mittel heißt `Konsensgespräche'. Dieser Begriff, der semantisch das Gegenteil dessen ausdrückt was er eigentlich bezeichnet müsste präziser `Konfliktgespräche' heißen. Denn gäbe es Konsens, wären diese Gespräche überflüssig. `Konsensgespräch' ist eine Formel die ausdrückt, dass (was Machiavelli ein Gräuel gewesen wäre) Vertreter der gegensätzlichsten Interessengruppen miteinander verhandeln und mit Hilfe von Gabe und Gegengabe Ergebnisse aushandeln, die vorher jeder dieser Interessengruppen als Gesamtheit unerträglich erschienen wären. Die Ergebnisse dieses Vorgangs sind bemerkenswert: Die Atomlobby erklärt sich zum Ausstieg bereit während die Grüne Partei ihren aktionistischen Anhängern mitteilt, dass dies erst in 30 Jahren geschieht. Im Bundesrat wird gegen den erklärten Willen der gegnerischen Partei, die in diesem Gremium die Mehrheit hat, ein Steuergesetz verabschiedet. In Gesprächen war mit Vertretern einzelner Bundesländer ein Konsens erzielt worden, der quer zum offiziellen Dissens der großen Volksparteien stand. Selbst die PDS stimmte dem Steuergesetz, das sie ablehnt, zu. Natürlich nicht ohne entsprechende Gegenleistung. Die Macht des Konsenses ist so groß, dass Gregor Gysi nun seinerseits Konsens mit Vertretern gegnerischen Parteien für einen Antrag sucht, der verfassungsrechtliche Einwände gegen die außerparlamentarischen Runden und Absprachen des Kanzlers erheben will. Es ginge darum, dass ,,die klassische Rollen- und Aufgabenverteilung im Parlament nicht präjudiziert werde"(FAZ vom 22. Juli 2000, Seite 1). Doch worin genau liegt nun eigentlich das machiavellische Übel der Faktionsbildung? Liegt sie, wie von Gysi behauptet, in der Aushebelung parlamentarischer Verfahren? Oder ist sie vielmehr ein Instrument gegen den Missbrauch des Parlamentes durch bereits existierende Faktionen? Eine Parteienpolitik nämlich, die sich nicht mehr um definierte Interessen einzelner gesellschaftlicher Gruppen schert, sondern starr der ideologisch motivierten Blockadepolitik der jeweiligen Parteiführung untergeordnet ist. Dient die Faktionsbildung durch Konsensgespräche nun dem Machterhalt und damit dem Eigennutz einer Partei oder dient sie im Gegenteil dem Allgemeinwohl, indem sie die ideologischen Fronten wieder an Sachthemen orientiert und damit aufbricht? Würde Machiavelli es als schädliche oder nützliche Faktionsbildung bezeichnen?
Wie man sieht kann das ausgeklügeltste Verfassungs- und Institutionensystem die Faktionsbildung nicht völlig verhindern. Und manchmal kann das Gemeinwohl sie anscheinend sogar nötig machen. Doch sicherlich kann diese Erkenntnis, die wir mit dem Blick auf jahrzehntelange republikanische Praxis machen, Machiavelli, der zu einer Zeit lebte in der die Erde noch 100 Jahre lang für den Mittelpunkt des Universums gehalten werden sollte, nicht zum Vorwurf gereichen.
Machiavellis Verdienst ist es als einer der ersten Denker seiner Zeit für eine Verfasstheit des Staates eingetreten zu sein, die man Legitimation durch Verfahren nennen könnte. Er lebte zu einer Zeit, da die Legitimität kraft Tradition oder Religion zu bröckeln begann und er entkleidet die spätmittelalterliche Scholastik mit ihren Naturrechtslehren ihrer sakralen Würde.
Machiavelli sucht den Konflikt, den er für unvermeidlich hält, durch Einbindung für die Gesellschaft produktiv zu macht. Damit ist er der Ausgangspunkt der Konflikttheorie. Es fällt auf, dass Machiavelli mit dem ihm eigenen Pragmatismus dem verfassungrechtlich geordneten Konflikt nirgendwo einen immanenten Vorsprung an Wahrheitsfindung zuschreibt. Machiavelli behauptet nicht, dass ein Rat der Tausend klüger sei als ein einzelner Monarch (das sieht man schon daran dass er Monarchie und Republik für die einzig stabilen Regierungsformen hält). Doch er besteht darauf, dass jede gesellschaftliche Klasse `ihren Teil der Regierung' haben müsse, um die staatliche Macht in den Augen der ihr Unterworfenen zu rechtfertigen. Er sieht, dass durch Recht institutionalisierte und durch Verfahren kanalisierte Konflikte die Legitimation des Staates stärken, während Konflikte die mit privaten Mitteln ausgetragen werden Krieg und Verrat bedeuten und den Staat zerstören. Diejenige Herrschaftsform, die Max Weber viel später als `Glaube an die Legalität gesatzter Ordnungen' bezeichnen sollte, taucht hier zum ersten Mal auf. Machiavelli hat uns mit seinem Denken einen Weg bereitet.
Verwendete Literatur
Machiavelli, Niccolò. Politische Schriften. Hg. Herfried Münkler. Frankfurt a. M.: Fischer 1996.
Münkler, Herfried. Machiavelli: Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz. Frankfurt a. M.: Fischer 1984.
Sasso, Gennaro. Niccolò Machiavelli: Geschichte seines politischen Denkens. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 1965
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hintergrund von Niccolò Machiavellis Denken?
Machiavelli lebte im Florenz des 13. Jahrhunderts, einer Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs des Bürgertums und des Wandels traditioneller politischer Machtverhältnisse. Die Krise der Florentiner Republik inspirierte ihn, Politik neu zu analysieren und die Möglichkeit politischen Eingriffs in die Weltordnung zu betrachten.
Wie unterschied sich Machiavellis Konfliktbetrachtung von der seiner Zeitgenossen?
Anders als die dämonologische (Unterwerfung) oder eschatologische (ewiger Frieden) Betrachtung von Konflikten, entwickelte Machiavelli ein modernes Verfassungsverständnis, das Konflikte nicht unterdrückt, sondern in geordnete Bahnen lenkt.
Welche antiken Vorbilder beeinflussten Machiavellis politisches Denken?
Machiavelli orientierte sich an Aristoteles' Theorie der Regierungsformen und Polybios' Kreislauf der Verfassungen (politeion anakyklosis). Er übernahm die zyklische Vorstellung von Aufstieg und Fall politischer Systeme, versuchte aber, die Zwangsläufigkeit dieses Kreislaufs zu durchbrechen.
Wie bewertete Machiavelli die verschiedenen Regierungsformen?
Er betrachtete sowohl die "guten" (Monarchie, Aristokratie, Politie) als auch die "schlechten" (Tyrannis, Oligarchie, Demokratie) Regierungsformen als potenziell unheilbringend, entweder wegen ihrer Kurzlebigkeit oder ihrer Verderblichkeit. Er befürwortete eine gemischte Verfassung, die Elemente aller drei guten Formen vereint.
Was versteht Machiavelli unter dem "geordneten Konflikt"?
Machiavelli glaubte, dass staatliche Stabilität erreicht werden kann, indem die zentrifugalen Kräfte der verschiedenen Staatsformen in einer Verfassung eingebunden werden, die sich gegenseitig neutralisieren. Er sah den geordneten Konflikt als Garant für die Erreichung von staatlicher Stabilität.
Welche Rolle spielt das Gesetz in Machiavellis Staatsverständnis?
Das Gesetz soll die Stände dazu anhalten, ihre Eigeninteressen in geordneter Weise zu vertreten, die Bürger zu tugendhaftem Verhalten anleiten und die Möglichkeit bieten, erlittenes Unrecht anzuklagen. Der Staat ist das Gefäß, das die Tugendhaftigkeit seiner Bürger zu sammeln und zu bewahren vermag.
Wie sah Machiavellis Verfassungsentwurf für Florenz aus?
Machiavelli entwarf ein technizistisches Partizipationsmodell mit drei Räten: einen Rat der Fünfundsechzig (Signoria) für den obersten Stand, einen Rat der Zweihundert (Rat der Erwählten) für den mittleren Stand und einen Rat der Sechshundert für die Masse der Bürger. Wichtig war ihm die Teilnahme von Mitgliedern eines Gremiums an Sitzungen anderer, mit Vetorecht.
Was war die Grundidee seines Verfassungsentwurfs?
Konflikte auszugleichen, legitime Einspruchsmöglichkeiten zu schaffen, Beschlussfähigkeit sicherzustellen und Transparenz zu gewährleisten. Er wollte verhindern, dass Bürger aus Furcht oder Ehrgeiz eine Umwälzung der Verhältnisse wünschen.
Warum kritisierte Machiavelli die Faktionsbildung?
Er sah in der nach Familien und Sippen organisierten segmentären Gesellschaft eine Gefahr für den geordneten Konflikt zwischen horizontalen Interessengruppen. Er verurteilte die Anhängerschaft, die durch persönliche Zuwendungen und nicht durch Tätigkeit für das Gemeinwohl erworben wurde.
Was bedeutet Machiavellis Ansatz für das moderne Verfassungsdenken?
Machiavelli trug wesentlich dazu bei, eine Verfasstheit des Staates zu fördern, die durch Verfahren legitimiert wird. Er suchte den Konflikt, den er für unvermeidlich hielt, durch Einbindung für die Gesellschaft produktiv zu machen. Damit ist er der Ausgangspunkt der Konflikttheorie.
- Quote paper
- Steffen Kröhnert (Author), 2000, Niccolò Machiavelli und die Geburtsstunde des modernen Verfassungsdenkens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99376