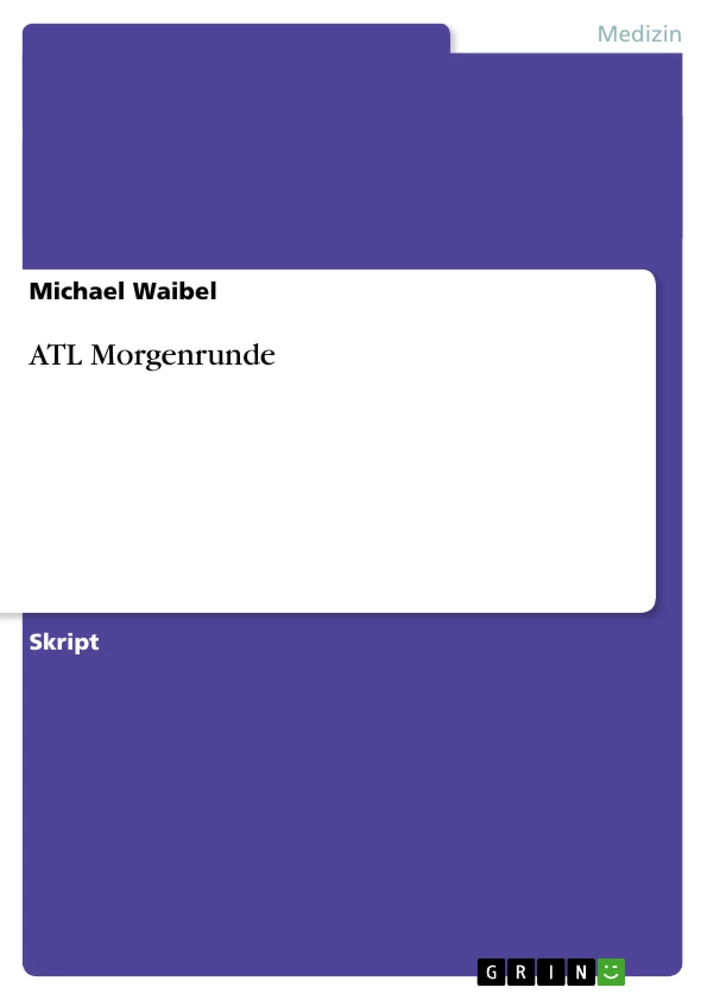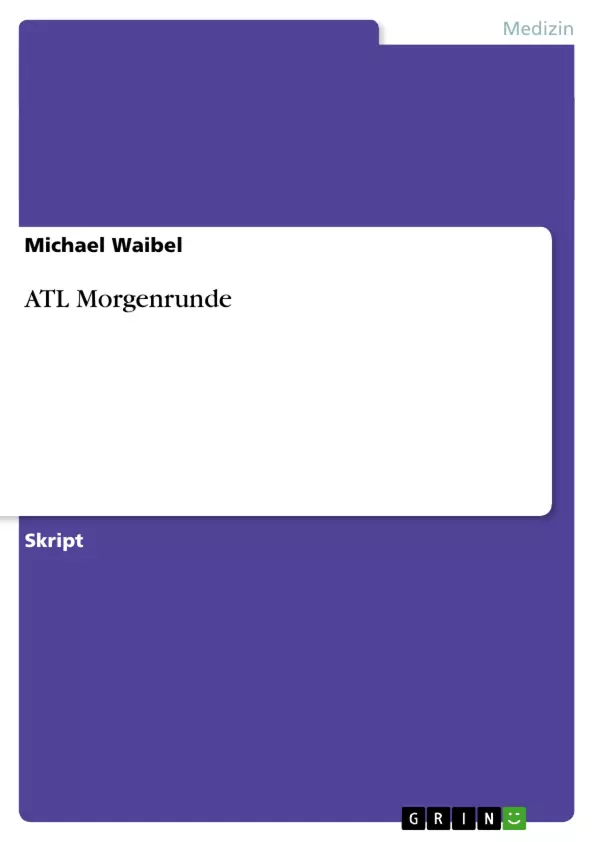1.Einführung:
Anlas für den Bericht ist das lebenspraktische Training (LPT) Morgenrunde.
Pat. F. ist seit 8 Tagen stationär in Behandlung, und wird seit dem Aufnahmetag von mir in der Bezugspflege betreut.
Herr F. war bei Aufnahme nicht intoxikiert, aber deutlich prae-delirant. Er war orientiert zur Person, aber nicht zum Ort und zur Zeit. Anlas seiner Aufnahme war, dass seine Mutter den Hausarzt kommen ließ, weil Pat. Fieber hatte. Dem Hausarzt berichtete Pat. von akustischen Halluzinationen ( Kreissägen im Haus), und von optischen Halluzinationen(Männer im Schlafzimmer). Der Pat. war unruhig, getrieben und schweißig. Seine RR und Puls waren deutlich erhöht, er hatte bei Aufnahme 39 Grad Fieber.
Der Pat. war freundlich und eher läppisch gestimmt, verstand den Grund seiner Aufnahme nicht.
Der Pat. wurde in den ersten 2 Tagen des stationären Aufenthaltes am Monitor überwacht, er bekam anfangs 2-stündlich Distraneurin und i.v.-Antibiose, weil radiologisch eine Pneumonie nachgewiesen wurde. Unter der Medikation erholte sich der Pat. rasch, so dass das Distraneurin ausgeschlichen wurde.
Der Pat. verhält sich auf Station sehr gewissenhaft, nimmt pünktlich an den Therapien teil, hat jedoch Schwierigkeiten mit anderen Pat. in Kontakt zu kommen. Der Pat. verhält sich im Kontakt zu anderen Menschen sehr unsicher.
Der Pat. benennt seine Unsicherheit mit anderen Menschen als sein Hauptproblem, dadurch würde er sozial isoliert leben ( der Pat. lebt bei seiner Mutter). Er möchte jedoch an dieser Unsicherheit arbeiten, und war einverstanden, mit meiner Unterstützung die Morgenrunde zu moderieren. Als seine Bezugsperson habe ich zu dem Pat. einen guten Kontakt bekommen. Es war interessant für mich zu sehen, wie der Pat. mit der Situation der Moderation der Morgenrunde umgehen wird, welche Ressourcen er hat und welche Defizite. Mit der schriftlichen Reflexion des LPT möchte ich die Wirksamkeit meines Trainings überprüfen, Ressourcen des Pat. stärken und Defizite ausgleichen.
2.Pflegeerhebung anhand der psychiatrischen ATL´s Atmung:
P1: Noch nicht ausgeheilte Pneumonie
R1: Pat. kann mobilisiert werden, ist den ganzen Tag auf Station unterwegs
Regulation der Körpertemperatur:
P1: Pat. hatte hohes Fieber
R1: Pat. mittlerweile fieberfrei
R2: Pat. meldet sich bei Temperaturanstieg P2: Pat. schwitzt sehr stark
R2: Pat. trinkt ausreichend
Ernährung:
R1: Pat. gibt an, einfache Gerichte selbst zubereiten zu können R2: Pat. isst unter der Woche in der Kantine
P1: Mutter des Pat. übernimmt die Essenszubereitung komplett
Ausscheidung:
R1: keine Probleme
P1: Pat. hatte letztes Jahr OP wegen einer Phimose
Ruhen und Schlafen:
R1: guter Schlaf
Sicherheit:
P1: Pat. unsicher und nervös
P2: Pat. sieht keinen Zusammenhang zwischen Nervosität und seinem Alkoholkonsum R1: Pat. möchte sich sicherer fühlen
Körperpflege:
R1: Pat. pflegt sich adäquat R2: adäquat gekleidet
Mobilität:
R1: Pat. benutztöffentliche Verkehrsmittel, kennt sich damit aus
P1: Pat. sieht sehr schlecht, kann trotz Brille keinen Führerschein machen
Informieren und Orientierung:
R1: Pat. hat sich schnell auf Station zurechtgefunden P1: Pat. war bei Aufnahme nicht orientiert
Kommunikation:
R1: Pat freundlich im Kontakt
R2: Pat. hat guten Kontakt zur Mutter und Schwester R3: Pat. hat 1 guten Freund
P1: Pat. lebt zurückgezogen, hat Schwierigkeiten mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, ist sehr unsicher
Stimmungen wahrnehmen und leben:
P1:Pat. hatte akustische und optische Halluzinationen R1: Pat. hat selbst bemerkt, dass diese nicht real sind
Verantwortungsfähigkeit:
R1: Pat. will wieder mehr Verantwortung übernehmen P1: Pat. verharmlost seinen Alkoholkonsum R2: Pat. fühlt sich für seine Mutter verantwortlich
Sinn finden:
R1: Pat. freut sich auf seine Pensionierung
Sinnvolle Zeitgestaltung:
R1: Hobbys: Basteln, Wandern, Karten spielen, Fahrrad fahren P2: Pat. verbindet alle seine Hobbys mit Konsum von Alkohol
Arbeit:
R1: Pat. arbeite als Industriekaufmann im Export
P1: Pat. ist am Arbeitsplatz wegen seines Alkoholkonsums bereits aufgefallen
Persönlichen Besitz verwalten und finanzielle Sicherheit:
R1: Keine finanziellen Probleme
Wohnen:
R1: Pat. lebt mit seiner Mutter in eigener Wohnung
Sich als Mann/Frau/Kind/Jugendlicher fühlen und verhalten:
R1: Pat. ist ledig
P1: Pat. deutet an, Probleme zu haben, auf Frauen zuzugehen
Rechte wahrnehmen und Pflichten erfüllen:
R1: Pat. zuverlässig auf Station
Sterben:
R1: Pat. nicht suizidal
3. Pflegediagnose
Pat. berichtet hauptsächlich, Probleme im Umgang mit anderen Menschen zu haben. Er sei sehr unsicher, traue sich nicht in Gruppen zu reden.
Als Ressource benennt Pat., dass er dies ändern und hier im stationären Aufenthalt trainieren möchte.
Vorbereitung und Planung einer soziotherapeutischen Einzel-oder Gruppenaktivität:
,,Morgenrunde"
1. Ziel
1.1. Begründung für die Maßnahme lt. Stationsziel/Handbuch
1.2. Was soll den PatientInnen vermittelt werden
Pat. hat Probleme im Umgang mit anderen Menschen, er ist unsicher, bekommt schlecht Kontakt. Das Reden in Gruppen fällt ihm schwer.
Pat. soll durch meine Unterstützung die Angst verlieren, vor Gruppen zu reden. Er soll sein Selbstbewusstsein durch positive Erlebnisse stärken. Pat. soll auch vermittelt werden, mit negativen Äußerungen umgehen zu können, und diese zu reflektieren.
1.3 . Die PatientInnen sollen:
1.3.1. kognitiv
soll kognitiv in der Lage sein, die vorgegebenen Informationen den anderen Pat. zu vermitteln
1.3.2. affektiv
mit der Belastung vor einer Gruppe reden zu können, umzugehen lernen
1.3.3. sozial-kommunikativ
die Informationen verständlich vermitteln, und Überforderung zu äußern. Er soll die Schwierigkeiten vor einer Gruppe reden zu müssen, auch artikulieren können.
1.3.4. psychomotorisch
die Belastung nach Möglichkeit durchhalten
2.Zielgruppe
2.1. Wer soll angesprochen werden
Alle Patienten auf Station, sowie die diensthabenden Pflegekräfte
2.2. Teilnahmekriterien
Die Teilnahme an der Morgenrunde ist für alle mobilen Patienten Pflicht.
2.3. Teilnahmeausschluss
Die Morgenrunde ist eine tägliche Veranstaltung auf Station. Lediglich Pat. die noch im Entzug sind, müssen nicht teilnehmen
2.4. Gruppengröße
8 Patienten, 2 Pflegekräfte
3. Planung
3.1. Zeitpunkt
Sonntag,
3.2. Dauer
ca. 10 Minuten
3.3. Ort
Speisesaal der Station 43
3.4. Personalbedarf
mind. 1 Pflegekraft, in der Regel alle Pflegekräfte, die im Dienst sind
3.5. Material
Pat. bekommt das ,,Morgenrunden-Buch" mit allen relevanten Informationen
3.6. Finanzierung
3.7. Vorgehen/Methode
Es handelt sich um eine aktivierend-fördernde Gruppenaktivität, die Teilnahme ist Pflicht. Der Moderator für den folgenden Tag (manchmal auch für eine ganze Woche), wird am Vortag bestimmt. Die Moderation ist freiwillig.
4.Programmablauf / Maßnahmen fiktiver Ablauf
- Der Moderator wurde am Tag vorher bestimmt, da der Wochenmoderator im Wochenend - Urlaub ist
- 10 Minuten vor Moderation: Besprechung mit Patienten über das Vorgehen: _ Begrüßung
-Kurze Befindlichkeitsrunde, jeder Pat. und Mitarbeiter soll etwas sagen
-Begrüßung neuer Patienten mit kurzer Erklärung über Inhalt, Sinn, Zweck und Dauer der Morgenrunde
-Vorstellung der diensthabenden Pflegemitarbeiter
-Tagesspezifische Informationen: Was können wir heute Vormittag machen (z.B Schwimmen, Spazieren gehen, Tischtennis-Spielen). Was können wir heute Mittag machen(z.B. Spazieren gehen, Kaffee-Trinken).
-Wer geht heute in Tagesurlaub?
-Anliegen der Patienten
-Anliegen bzw. Informationen der Pflegemitarbeiter _ Schließen der Runde
5. Mögliche Probleme & Alternativen
5.1 mögliche Probleme
Patient ist zu nervös oder unruhig, um die Gruppe zu leiten. Pat. vergisst Punkte im Morgenrundenbuch.
Störungen von anderen Pat.
Pat. versteht Äußerungen von Mitpatienten falsch, oder bezieht sie auf sich.
5.2. Alternativen
Pat. beruhigen, Verständnis zeigen, wie schwierig es ist, vor einer Gruppe zu reden. Eigene Erfahrungen ausdrücken.
Pat. beim Ablauf der Moderation helfen, aber nicht bevormunden. Mitpatienten bei Störungen um Verständnis bitten. Reflektion der Äußerungen von Mitpatienten .
6. Auswertung
6.1. in der Gruppe · Blitzlicht
- Feed-back
Die Unsicherheit des Pat. F. fiel den anderen Mitpatienten auf. Sie bestärkten ihn jedoch gleich zu Beginn, dass sie es ,,mutig" von ihm finden, dass er heute die Morgenrunde moderiert.
Da niemand von den Mitpatienten einen Vorschlag zur Gestaltung des Vormittags machen wollte, schlug Pat. F. vor, ins Schwimmbad zu gehen. Dieser Vorschlag wurde von zwei anderen Patienten aufgenommen, und Pat. F. freute sich sichtlich darüber. Dem Pat. wurde zum Ende der Runde von mir vermittelt, dass er die Moderation sehr gut gemacht habe. Dem stimmten die anderen Pat. zu.
6.2. Reflexion mit Kolleginnen (Co-)
6.3. Bericht im Team
Pat. hat heute zum ersten Mal die Morgenrunde moderiert. Da es Sonntag ist, hielt ich den heutigen Tag für günstig, da wenige Pat. auf Station sind, und der Umfang der Moderation wesentlich geringer ist, als am Wochentag.
Pat. hat seine Moderation gut gemacht. Er war zu Beginn sehr nervös und unsicher. Durch positive Reaktion der anderen Pat. und der Pflegemitarbeiter, konnte er etwas ruhiger werden, war aber während der ganzen Moderation sehr angespannt, und schwitzte sehr.
Er nahm die Sache aber ernst, und bearbeitete jeden Punkt im Buch.
In der Nachbesprechung äußerte der Patient, dass ihm aber die Moderation am Wochentag wohl noch zuviel sei, er wolle zuerst noch andere Patienten beobachten, wie sie die Moderation machen. Dem Pat. wurde vermittelt, dass er es sehr gut gemacht habe, und dass für ihn keine Verpflichtung besteht, am Montag die Moderation zu wiederholen. Er fand aber den Vorschlag gut, am nächsten Wochenende Samstag und Sonntag zu moderieren. Darauf will er sich vorbereiten.
Der Pat. äußerte in der Nachbesprechung, dass er sich jetzt richtig wohl fühlt, und sich aufs Schwimmen freut.
6.4. Dokumentation (analog1.3.)
kognitiv: Der Pat. konnte die vorgegebenen Informationen den anderen Pat. vermitteln, und eigene Vorschläge machen. affektiv: Es war für den Patienten eine große Belastung vor der Gruppe zu sprechen, er fühlte sich während der Gruppe nicht wohl.
sozial-kommunikativ: Pat. konnte sich verständlich ausdrücken.
psychomotorisch: Es war für den Pat. schwer auszuhalten, er war sehr nervös, rutschte auf seinem Stuhl hin und her, und war von den Bewegungen her etwas fahrig.
7. Evaluation
Es war eine große Leistung des Pat., sich für die Moderation bereit zu erklären. Da ich ihn seit Aufnahme auf Station kenne und in der Bezugspflege mit ihm arbeite, hat Pat. Vertrauen zu mir entwickelt. Er äußerte auch, dass es für ihn eine Beruhigung war, dass ich neben ihm saß. Er war sich sicher, dass ich ihn nicht im Stich lasse.
Der Zeitpunkt für die Moderation an einem Sonntag war sicherlich günstig, aber für den Pat. noch zu früh. Wichtig ist dennoch, den Pat. durch positive Reflektion zur weiteren Moderation, vorerst am Wochenende, zu motivieren. Von einer Teilnahme am Selbstsicherheitstraining auf Station kann Pat. sicherlich profitieren. Dem Pat. muss reflektiert werden, dass er ruhig stolz auf sich sein kann, diese schwierige Situation gemeistert zu haben.
8.Zusammenfassung/Resümee
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Anlass für diesen Bericht?
Der Bericht wurde aufgrund des lebenspraktischen Trainings (LPT) "Morgenrunde" erstellt.
Wer ist Patient F. und wie lange ist er schon in Behandlung?
Patient F. ist seit 8 Tagen stationär in Behandlung und wird seit dem Aufnahmetag von der Bezugspflege betreut.
Warum wurde Patient F. aufgenommen?
Patient F. wurde aufgenommen, weil seine Mutter den Hausarzt rief, da er Fieber hatte. Er berichtete dem Arzt von akustischen und optischen Halluzinationen, war unruhig, getrieben und schweißig, und hatte erhöhten Blutdruck, Puls und Fieber.
Wie war der Zustand von Patient F. bei der Aufnahme?
Patient F. war bei der Aufnahme nicht intoxikiert, aber deutlich prae-delirant. Er war orientiert zur Person, aber nicht zum Ort und zur Zeit.
Wie wurde Patient F. in den ersten Tagen behandelt?
In den ersten zwei Tagen wurde Patient F. am Monitor überwacht und erhielt anfangs 2-stündlich Distraneurin und i.v.-Antibiose, da eine Pneumonie diagnostiziert wurde. Die Medikation wurde nach Besserung ausgeschlichen.
Wie verhält sich Patient F. auf der Station?
Patient F. verhält sich gewissenhaft, nimmt pünktlich an den Therapien teil, hat aber Schwierigkeiten, mit anderen Patienten in Kontakt zu treten. Er ist im Kontakt zu anderen Menschen sehr unsicher.
Welches Problem benennt Patient F. als sein Hauptproblem?
Patient F. benennt seine Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen als sein Hauptproblem, was zu sozialer Isolation führt. Er möchte jedoch daran arbeiten.
Was ist das Ziel des lebenspraktischen Trainings (LPT) "Morgenrunde" in Bezug auf Patient F.?
Das Ziel ist, Patient F. durch Unterstützung die Angst vor dem Reden vor Gruppen zu nehmen, sein Selbstbewusstsein zu stärken und ihm beizubringen, mit negativen Äußerungen umzugehen und diese zu reflektieren.
Wie sind die psychiatrischen ATL's (Aktivitäten des täglichen Lebens) von Patient F. zusammengefasst?
Die ATL's umfassen Aspekte wie Atmung (Pneumonie), Körpertemperaturregulation (Fieber, Schwitzen), Ernährung, Ausscheidung, Ruhen und Schlafen, Sicherheit (Unsicherheit, Alkoholkonsum), Körperpflege, Mobilität, Information und Orientierung, Kommunikation (soziale Schwierigkeiten), Stimmungen wahrnehmen (Halluzinationen), Verantwortungsfähigkeit (Alkohol, Mutter), Sinnfindung, Zeitgestaltung (Hobbys mit Alkoholkonsum), Arbeit (Probleme am Arbeitsplatz), Besitz, Wohnen und Verhalten als Mann.
Welche Pflegediagnose wird für Patient F. gestellt?
Die Hauptpflegediagnose bezieht sich auf die Probleme des Patienten im Umgang mit anderen Menschen, seine Unsicherheit und die Schwierigkeit, in Gruppen zu sprechen. Seine Ressource ist der Wunsch, dies zu ändern und im stationären Aufenthalt zu trainieren.
Welche Ziele werden mit der "Morgenrunde" verfolgt?
Die PatientInnen sollen kognitiv Informationen vermitteln können, affektiv mit der Belastung des Redens vor einer Gruppe umgehen lernen, sozial-kommunikativ Informationen verständlich vermitteln und Überforderung äußern können, und psychomotorisch die Belastung möglichst aushalten.
Wer ist die Zielgruppe der "Morgenrunde"?
Alle Patienten auf Station sowie die diensthabenden Pflegekräfte.
Welche Teilnahmeausschlüsse gibt es für die "Morgenrunde"?
Nur Patienten im Entzug müssen nicht teilnehmen.
Wie ist der Ablauf der "Morgenrunde" geplant?
Die Morgenrunde beinhaltet Begrüßung, Befindlichkeitsrunde, Begrüßung neuer Patienten, Vorstellung der Mitarbeiter, tagesspezifische Informationen und Anliegen der Patienten und Mitarbeiter.
Welche möglichen Probleme können bei der Moderation der "Morgenrunde" auftreten und welche Alternativen gibt es?
Mögliche Probleme sind Nervosität, Vergessen von Punkten, Störungen durch andere Patienten und Missverständnisse. Alternativen sind Beruhigung, Hilfe beim Ablauf, Reflektion von Äußerungen und Verständnis von Mitpatienten.
Wie wurde die Moderation von Patient F. ausgewertet?
Die anderen Patienten empfanden es als mutig, dass er die Morgenrunde moderiert. Er schlug vor, ins Schwimmbad zu gehen, was positiv aufgenommen wurde. Ihm wurde am Ende der Runde bestätigt, dass er die Moderation gut gemacht habe.
Wie wurde Patient F.s Verhalten in der Dokumentation festgehalten?
Kognitiv konnte er Informationen vermitteln und Vorschläge machen. Affektiv war es eine Belastung für ihn. Sozial-kommunikativ konnte er sich verständlich ausdrücken. Psychomotorisch war er sehr nervös und unruhig.
Welche Evaluation wird bezüglich Patient F. vorgenommen?
Es wird als große Leistung angesehen, dass er sich zur Moderation bereit erklärte. Der Zeitpunkt war möglicherweise noch zu früh. Es ist wichtig, ihn durch positive Reflektion zu weiteren Moderationen, vorerst am Wochenende, zu motivieren.
Welches Resümee wird gezogen?
Es ist wichtig für den Patienten, eine Bezugsperson auf Station zu haben, zu der er Vertrauen hat. Die Bezugspflege kann ihn motivieren, weitere Schritte zu mehr Selbstbewusstsein zu wagen. Dies ist möglicherweise in der Kürze des Aufenthaltes nicht zu bewältigen, aber es kann ein Anstoß sein, sich mehr zuzutrauen.
- Arbeit zitieren
- Michael Waibel (Autor:in), 2000, ATL Morgenrunde, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99260