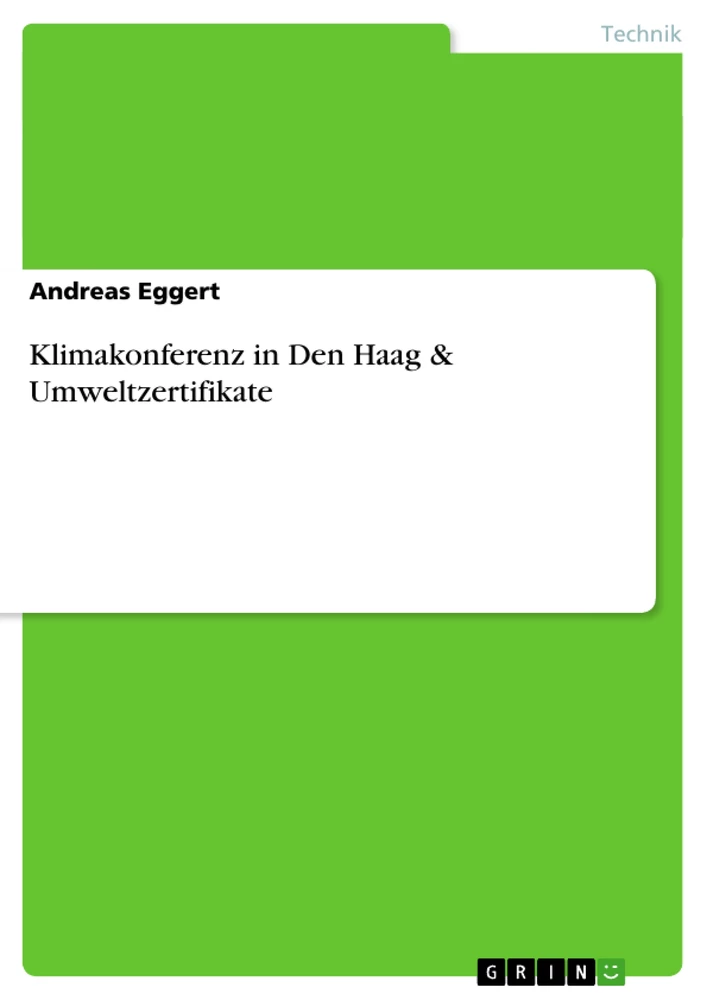Klimakonferenz in Den Haag & Umweltzertifikate Andreas Eggert
Weidengang 2, 39576 Stendal karnataka@t-online.de
November, 2000
Ich denke an dieser Stelle muß nicht mehr an die Dringlichkeit einer Einigung appeliert werden - die menschlichen Einflüsse auf unser Erdsystem haben eine Quantität und Qualität erreicht, welche Wirkungen zeigen werden. Es sei aber auch bemerkt, dass derzeit die Schwerpunkte in der Umweltforschung darin liegen, zu unterscheiden was menschlich und was natürliche Veränderungen des Erdsystems sind[1].
Die seit Kyoto heiß diskutierten Umweltzertifikate sind vielleicht die letzte Hoffnung, wenn nicht die größte Hürde bei der Verminderung der Treibhausgase. Was ist ein Umweltzertifikat? Nehmen wir an die Länder einigen sich auf eine bestimmte Gesamtmenge, welche emmitiert werden soll (z.B. 1000 t CO²/a ) und stückeln diese in beliebig kleine Partien (z.B. 100 mal 10 t CO² /a )[2]. Für jede Partie wird ein Zertifikat ausgestellt, welche das Land berechtig die ausgewiesene Schadstoffmenge zu emittieren. Diese sogenannten „Verschmutzungsrechte“ können nun unter den Ländern gehandelt werden. Nimmt ein Land die Verschmutzungsrechte nicht im vollem Umfang war, so kann es die ungenutzten verkaufen. Auf diese Weise entsteht ein Markt für Umweltzertifikate mit bekannter Angebot und Nachfrage. Auch ohne hinreichendökonomische Kenntnisse, kann man sich rein intuitiv vorstellen, dass sich schließlich ein gleichgewichtiger Preis einstellen wird. Sind bei einem Land die Kosten zur Vermeidung von Schadstoffen niedriger als der am Markt zu erzielende Preis, so wird es Aktivitäten zur Vermeidung von Emmissionen betreiben und überschüssige Zertifikate verkaufen. Langfristig wird bei Vermeidung von Schadstoffen das Angebot an Zertifikaten steigen und der Preis solange fallen, bis sich die Mehrkosten für Vermeidungsaktivitäten dem Zertifikat-Preis gleichen. Übertragen heiß das, es kommt tatsächlich zu einer Reduktion von Schadstoffen. Das dies funktionieren kann, beweisen uns seit einigen Jahren die USA. Zwar handelt es sich dort nur um eine sehr abgeschwächte Form des Zertifikathandels, denn die Emmissionsgutschriften können nur unter bestimmten Auflagen übertragen werden. Dennoch zeigt der Erfolg in der Senkung von SO² Emmissionen die Vorteilhaftigkeit dieses Systems.
Aber die Uneinigkeit der Staaten bezieht sich nicht auf das Ziel: Verminderung der Treibhausgase, denn da sind sich alle einig - vielmehr sind Fragen hinsichtlich der Erstvergabe der Zertifikate zu klären. Welches Land bekommt wieviel, was kostet ein Zertifikat oder sind sie gar kostenlos ?
Insbesondere Russland, bedingt durch die z.T. brachliegende Industrie, erhofft sich einen großen Kuchen abschneiden zu können um gleichzeitig die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen.
Nach meiner Meinung zu recht, kritisieren die ärmeren Länder die hohen Umweltauflagen und Barrieren seitens der Industrieländer. Waren es nicht sie, welche fleißig risikoreiche Chemieanlagen in Entwicklungsländer verlagert hatten[3]. Insbesondere in Lateinamerika und Afrika waren die uns bekannten Katastrophen zu beobachten.
Bei einer gerechten Vergabe der Emmissionsgutscheine und das weiter hohe Engagement der Subpolitik (Grean Peace etc.), sehe ich auf lange Sicht ein Licht am Horizont, welches wir unserer Zukunft schuldig sind.
Literatur
Beck, Ulrich (1996): Weltrisikogesellschaft, Weltöffentlichkeit und globale Subpolitik, Wien, S. 39- 44.
Beck, Ulrich (1998): Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung, Frankfurt a. M., S. 73-80.
Schellnhuber, H.-J., (1998): Earth System Analysis: The Scope of the Challenge, in: Schellnhuber, H.-J., Wenzel, V. (eds.), Earth System Analysis, Berlin, S. 3-195.
Weimann, Joachim (1995): Umweltökonomik - Eine theorieorientierte Einführung, Magdeburg, S. 157-181.
[...]
[1] Vgl. dazu Schellnhuber, H.-J., Earth System Analysis: The Scope of the Challenge, S. 3-195 ff., Berlin 1998.
[2] Vgl. dazu Weimann, J., Umweltökonomik - Eine theorieorientierte Einführung, S. 157 ff., Magdeburg 1995.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Klimakonferenz in Den Haag & Umweltzertifikate"?
Der Text von Andreas Eggert behandelt die Klimakonferenz in Den Haag und die Rolle von Umweltzertifikaten bei der Reduzierung von Treibhausgasen. Er diskutiert die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Funktionsweise von Umweltzertifikaten als Verschmutzungsrechte und die Uneinigkeit der Staaten hinsichtlich der Erstvergabe dieser Zertifikate. Der Text beleuchtet auch die Kritik ärmerer Länder an den Umweltauflagen der Industrieländer.
Was sind Umweltzertifikate (Verschmutzungsrechte) laut dem Text?
Umweltzertifikate sind Lizenzen, die es einem Land oder Unternehmen erlauben, eine bestimmte Menge an Schadstoffen, beispielsweise CO², auszustoßen. Die Gesamtmenge der emittierbaren Schadstoffe wird von den Ländern festgelegt und in kleinere Partien aufgeteilt, für die jeweils ein Zertifikat ausgestellt wird. Diese Zertifikate können dann unter den Ländern gehandelt werden.
Wie funktioniert der Handel mit Umweltzertifikaten laut dem Text?
Länder, die ihre Verschmutzungsrechte nicht vollständig ausschöpfen, können die ungenutzten Zertifikate an andere Länder verkaufen. Dadurch entsteht ein Markt mit Angebot und Nachfrage, der letztendlich zu einem Gleichgewichtspreis führt. Länder mit niedrigeren Kosten zur Schadstoffvermeidung werden Aktivitäten zur Emissionsreduktion betreiben und überschüssige Zertifikate verkaufen.
Warum herrscht Uneinigkeit bezüglich der Umweltzertifikate laut dem Text?
Die Uneinigkeit besteht hauptsächlich in der Frage der Erstvergabe der Zertifikate: Welches Land erhält wie viele Zertifikate, was kostet ein Zertifikat, oder werden sie kostenlos vergeben? Russland erhofft sich aufgrund seiner teils brachliegenden Industrie einen Vorteil bei der Vergabe der Zertifikate.
Welche Kritik äußern ärmere Länder an den Umweltauflagen der Industrieländer laut dem Text?
Ärmere Länder kritisieren die hohen Umweltauflagen der Industrieländer, da diese in der Vergangenheit risikoreiche Chemieanlagen in Entwicklungsländer verlagert haben, was zu Umweltkatastrophen geführt hat.
Welche Literatur wird im Text erwähnt?
Der Text verweist auf Werke von Ulrich Beck (Weltrisikogesellschaft, Was ist Globalisierung?), Hans-Joachim Schellnhuber (Earth System Analysis) und Joachim Weimann (Umweltökonomik).
- Arbeit zitieren
- Andreas Eggert (Autor:in), 2000, Klimakonferenz in Den Haag & Umweltzertifikate, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98896