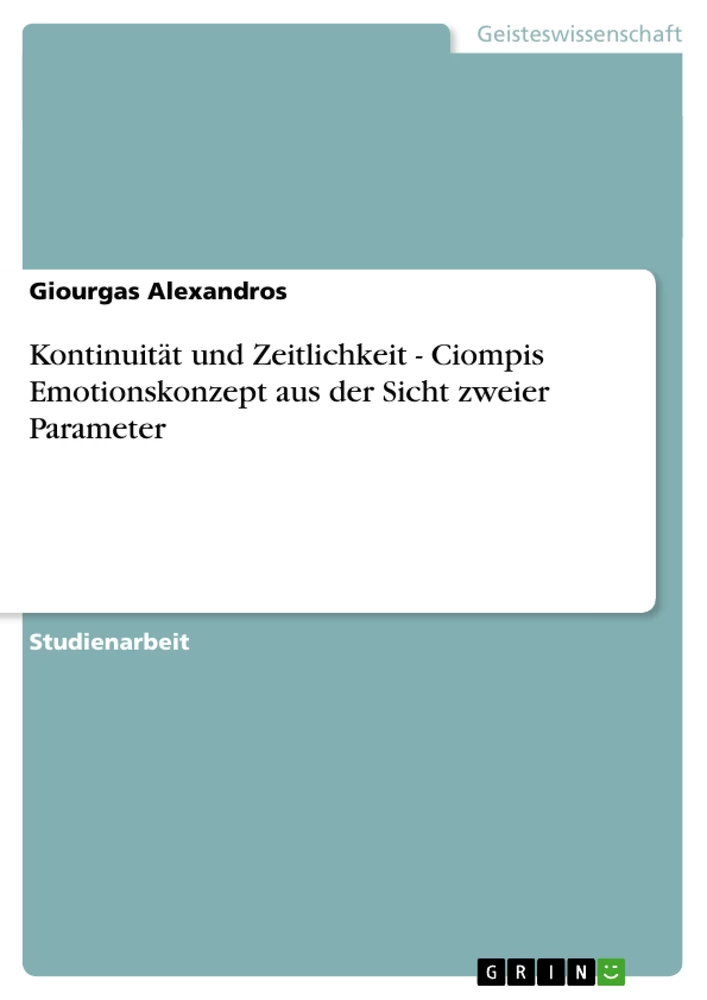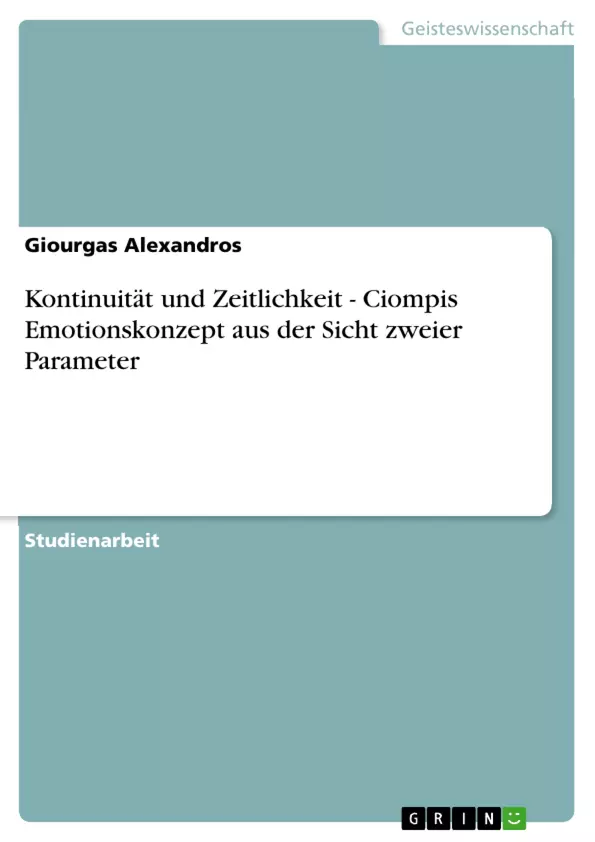Was, wenn unsere tiefsten Emotionen nicht nur Gefühle sind, sondern die verborgenen Architekten unserer Gedanken und Handlungen? Tauchen Sie ein in eine bahnbrechende Reise durch die fraktale Affektlogik, ein Konzept, das die traditionellen Grenzen zwischen Fühlen und Denken sprengt. Dieses Buch enthüllt, wie Affekte, weit mehr als bloße Reaktionen, die treibende Kraft hinter unserer Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und sogar unserer psychischen Gesundheit sind. Entdecken Sie, wie Emotionen als komplexe, sich selbstorganisierende Systeme fungieren, die unser Verhalten auf subtile und doch tiefgreifende Weise beeinflussen. Anhand von Luc Ciompis revolutionären Ideen erkunden wir die chaostheoretischen Grundlagen der Psyche, die fraktalen Muster, die unsere inneren Landschaften prägen, und die dynamische Wechselwirkung zwischen Affekt und Kognition. Wir beleuchten, wie traumatische Erfahrungen affektlogische Schemata stören und zu psychischen Störungen führen können, und bieten neue Perspektiven für Therapie und Heilung. Verknüpft mit den revolutionären Ansätzen von Simonov und Jantzen, die die Rolle von Bedürfnissen, Information und Zeitlichkeit in der Entstehung von Emotionalität hervorheben, wird ein umfassendes Verständnis der menschlichen Psyche entwickelt. Dieses Buch ist eine fundamentale Lektüre für Psychologen, Therapeuten, Neurowissenschaftler und alle, die sich für die verborgenen Kräfte interessieren, die uns zu dem machen, was wir sind. Es fordert uns heraus, neu zu denken, wie wir Emotionen verstehen und wie sie unser Leben beeinflussen, und eröffnet faszinierende Einblicke in die Tiefen der menschlichen Erfahrung, die von den kleinsten zellulären Prozessen bis hin zu den komplexesten sozialen Interaktionen reichen. Die Affektlogik wird nicht nur als theoretisches Konstrukt präsentiert, sondern auch in ihrer Anwendbarkeit auf alltägliche und pathologische Phänomene untersucht, was dieses Werk zu einem unverzichtbaren Leitfaden für jeden macht, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Fühlen, Denken und Handeln entschlüsseln möchte.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erster Teil
Die Grundaussagen der Affektlogik
Exkurs: Chaostheoretische Grundbegriffe Die Theorie der fraktalen Affektlogik
Unter der Lupe: Ausgewählte Begriffe der Affektlogik
Zweiter Teil
Simonov und die Informationstheorie der Emotionen
Das Kontinuitätsproblem: Das Phänomen der Emotionalität im Fluss der Zeit Moderne Selbstorganisationstheorie und das Emotionsproblem Abschließende Bemerkungen
Literatur
Vorwort
Der Philosoph und Gründer des amerikanischen Pragmatismus, Charles Sanders Peirce, formulierte im Rahmen seiner Metaphysik drei Theorien, welche auf das kosmologische Prinzip der Evolution bezogen werden sollten. Die allgemeine Aussage dieser Theorien kann meines Erachtens für jegliche historische und systematische Betrachtung von Wissenschaft aller Art in ihrem Wert nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie kondensiert insbesondere in den Kategorien des Tychismus und des Synechismus, denen zu folge in der Evolution des Universums stets ein Element objektiven Zufalls wirksam sei und zudem alle Phänomene in kontinuierlichen Relationen zueinander stünden, welche zu finden seien. Diese Aussagen bettete Peirce in eine dualistische Zeittheorie, wonach es im Grunde nur Vergangenheit und Zukunft gebe und die Gegenwart die (fließende) Grenze dazwischen darstelle. Während die Gegenwart fixiert sei, stelle sich dem Betrachter die Zukunft als in nächster Nähe vorhersagbare, insgesamt jedoch offene (von stochastischen Gesetzen abhängige) gegenüber, in der sich künftige Gesetzte entwickelten, welche allerdings sich erst realisieren könnten, wenn sie zum gegenwärtigen Augenblick möglich seien. Genauer betrachtet offenbart sich, dass Peirce im ausgehenden 19. Jahrhundert mit seinen Aussagen nichts anderes als ein chaostheoretisches Modell mitsamt seinen Bifurkationen entworfen hatte. Dazu noch antizipierte er auf philosophischer Ebene Prigogines Theorie der nicht- Gleichgewichtsthermodynamik, welches diesen dazu bewegte, das Vorwort zu einer Werksausgabe von Peirce zu verfassen.1
Der hier formulierte Idealismus des künftig Möglichen stellt für mich die Latte dar, an der sich jede theoretische Auseinandersetzung über beliebige Gegenstände messen müsste, da er ihre Einordnung in die Kontinuität der Ereignisse während der Entstehung des (uns bekannten) Universums fordert. Dies gilt auch für die in den theoretischen Systemen verwendeten Begriffe, welche Gemeinsamkeiten zur Terminologie anderer Disziplinen aufweisen sollten.
Wenden wir die obigen Grundsätze auf die Psychologie an, dann wird es erforderlich, das Psychische in seiner Entstehung unter Berücksichtigung der eben genannten Zusammenhänge zu rekonstruieren, folglich seine Genese - bei einer materialistischen Psychologie - streng in die Kontinuität materieller Prozesse einzugliedern, zu denen der Lebensprozess allgemein gehört.2 Somit kann das Psychische zwar als eine neue Qualität bezeichnet werden, welche jedoch nicht mit einem beherzten Schritt aus dem Nichts emergierte, sondern ihrer Möglichkeit nach bereits in ihr vorausgehenden Prozessen existierte. Von den theoretischen Modellen, die dieser Absicht nachgehen, möchte ich anhand dieser
Arbeit zwei herausgreifen und in ihrer Stichhaltigkeit bezüglich der obigen Prämissen vergleichend untersuchen. Zum einen ist dies das Konzept der fraktalen Affektlogik des Psychiaters Luc Ciompi, zum anderen die Fortsetzung der Tätigkeitstheorie der Kulturhistorischen Schule, wie sie vor allem vom Psychologen und Pädagogen Wolfgang Jantzen bekannt ist. Wie es der Titel der Arbeit verrät, möchte ich mich insbesondere auf die Gedanken der Kontinuität und Zeitlichkeit konzentrieren, welche noch genauer vorgestellt werden sollen. Dabei werde ich das Hauptaugenmerk auf Ciompis Konzeption legen und prüfen, inwiefern tätigkeitstheoretisch Ergänzungen vorgenommen werden könnten bzw. sollten. Es wird unumgänglich sein, die Arbeit mit der Darbietung wesentlicher Aussagen Ciompis zu beginnen, um eine gemeinsame Basis herzustellen und Missverständnissen vorzubeugen. Diese wird allerdings so knapp wie nur möglich ausfallen und sich hauptsächlich auf die Publikation ,,Die emotionalen Grundlagen des Denkens" beziehen. Es sollte auch beachtet werden, dass ein direkter, detaillierter Vergleich der beiden erwähnten Theorien nicht stattfinden soll, welcher meines Erachtens ohnehin aufgrund ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen verfehlt wäre. Es liegt ja in Ciompis Absicht, ein Konstrukt zu bieten, welchesökonomisch gehalten werden und Komplexität reduzieren soll3, wobei viele Verweise auf andere Wissenschaftler angeführt werden. Jantzen arbeitet hingegen in feinster Ausdifferenzierung, und es ist bedauerlich, dass Ciompi selbst - womöglich aus Unkenntnis - nicht auf ihn verweist, da sich beide auf ähnliche Untersuchungen berufen. Kurz, es kann sich hier nicht um die Suche nach der vermeintlich überlegenen Theorie drehen.
Erster Teil
Die Grundaussagen der Affektlogik
Ciompi versucht mit seiner Konzeption, die theoretischen Überlegungen von Jean Piaget, der Psychoanalyse und der Systemtheorie zu synthetisieren, wobei er letztere durch die Chaostheorie ersetzt.
Mit Piaget geht er davon aus, dass mentale Strukturen in einem Interaktionszusammenhang entstehen, welche nach und nach hierarchisiert und verdichtet werden. Doch im Gegensatz zu Piaget, welcher die Bedeutung der Affektivität dabei nicht deutlich herausgestellt habe, weist Ciompi darauf hin, dass sich der Mensch nicht von einem affektiven zu einem kognitiven Wesen entwickele, sondern zu einem affektiv-kognitiven. Affekte spielen also ebenso wie Kognitionen eine Rolle bei der Handlungsstruktur und Realitätskonstruktion des Organismus.
Die entstandenen mentalen affektlogischen Schemata bilden die Bausteine der Psyche,4das
Psychische stellt sich folglich dar als ein Komplex hierarchisierter, auf Erfahrungsbasis erworbener Schemata mit je einem affektiven und einem kognitiven Pol. Fühlen, Denken und Verhalten stehen in engstem Zusammenhang zueinander.
Die zentralen Begriffe des affektlogischen Modells von Ciompi sind bewusst sehr allgemein gehalten. Nach meinem Verständnis ist unter einem Affekt vorwiegend an körpergebundene Prozesse zu denken, während Kognitionen nicht fühlbare, abstrakte Kategorien darstellen, welche der Informationskonstruktion - der Herausstellung von Unterschieden - dienen. Affekt und Kognition haben einen gemeinsamen Ursprung, entwickeln sich jedoch in verschiedene Richtungen und interagieren miteinander. Hierbei verbinden sich Kognitionen durch Auszug von Invarianz zu größeren Konglomeraten, welche eine Logik entstehen lassen. Wie sich kognitive Elemente jedoch miteinander in Beziehung setzen, hängt maßgeblich von affektiven (und situativen) Faktoren ab, wodurch sich der Begriff der Affektlogik begründet. Affekte können auf Denkprozesse organisatorisch einwirken und dadurch eine spezifisch emotional gefärbte Logik unterschiedlicher Dauer entstehen lassen, genauer gesagt: Affekte und Affektbesetzungen (Motivationen) sind das bindende, lenkende und mobilisierende Element kognitiver Programme, sie hierarchisieren diese und ermöglichen ihnen die Informationskonstruktion. Die Wichtigkeit der Affekte für die gesamte Verhaltensorganisation macht Ciompi deutlich durch den Satz: ,,Ohne emotionalen Anstoß gibt es keine Aktion."5
Der psychoanalytischen Denkweise nähert sich Ciompi anhand der Übernahme des (Un- )Lust-prinzips in sein Homöostasemodell. Dem zu folge strebt der Organismus danach, innere Spannungen zu lösen und somit Lusterlebnisse zu generieren bzw. umgekehrt. Gelingende rationale Lösungen und Abstraktionsprozesse würden als lustvoll erlebt. Hingegen erweisen sich nach Ciompi unlustbegleitete Krisensituationen als der eigentliche Motor von Entwicklungsprozessen, welche gar aus gelegentlicher Langeweile selbst initiiert werden können. Aus philosophisch-anthropologischer Warte ähnelt dieses Prinzip der Belief-Doubt- Theorie - in einer Form auch von den amerikanischen Pragmatisten oder Karl R. Popper vertreten - wonach der Mensch ungelöste Probleme (Zweifel), die sich ihm in den Weg stellen, nicht ertragen kann und nach deren Lösung strebt, fortwährend auf der Suche nach einer neuen Überzeugung.
Lust- wie unlustvolle Erlebnisse werden im Gedächtnis festgehalten. Die lustvollen Anteile der Erinnerungen werden jedoch selektiert und zu einem invarianten positiven Gesamtaffekt zusammengeballt, welcher als Attraktor die Aufmerksamkeit auf sich lenkt - sei es bewusst oder unbewusst. Basierend auf das Phänomen der neuronalen Plastizität6bilden sich (relativ) stabile neuronale Assoziationswege, anhand derer Lernvorgänge ermöglicht werden und bestimmte Fühl-, Denk- und Verhaltensweisen subjektive Vorlieben für sich gewinnen. Letzteres bedeutet, dass spezifische neuronal-kognitive Assoziationsbahnen durch einen biochemischen ,,affektiven Inprint"7abgerufen würden.
Dies sind Thesen Ciompis, von denen ich meine, er habe sie in vielen Publikationen seiner Affektlogik vertreten. Präzisiert wird diese nun durch den Gedanken der diesen Prozessen innewohnenden Fraktalität. Auf diesen Begriff und den ihm nahe stehenden Begriff des Chaos soll im folgenden eingegangen werden.
Exkurs: Chaostheoretische Grundbegriffe In einer allgemeinen Definition könnte ein Fraktal bezeichnet werden als ,,eine geometrische Figur, in der sich das gleiche Motiv in stets kleinerem Maßstab wiederholt."8Beispiele dafür lassen sich mittlerweile in der Literatur zur Genüge finden, zu den bekanntesten zählen die von-Kochsche Kurve und die Mandelbrot-Menge. Wie jede geometrische Figur besteht ein Beschreibungsmerkmal von Fraktalen in ihrer Dimensionalität, welche gebrochen sein kann (so hat eine Strecke eine einzige, ein Würfel drei Dimensionen, die Koch-Kurve hingegen eine von 1,26...).
Zur Beschreibung dynamischer Systeme, also von Vorgängen in der Zeit, werden noch weitere Termini benötigt. Ein Attraktor - welcher selbst ein Fraktal sein kann - ist eine Art Anziehungspunkt, welcher einer Dimension des Phasenraums zugeordnet werden kann. Sie sind nur in dissipativen Wirkzusammenhängen beschreibbar, also solchen, die Energie verbrauchen und als Wärme abgeben. Komplexere (chaotische) Attraktoren können nicht als Punkte, sondern nur als Bahnen im Phasenraum darstellt werden. Der Phasenraum wird durch doppelt so viele Dimensionen definiert wie das zu beschreibende Objekt Freiheitsgrade hat. Beispielsweise sind einem Uhrenpendel eine, einer Schnecke auf einem Tisch zwei Raumrichtungen zugänglich und somit auch entsprechend viele Freiheitsgrade. Da beim Anlegen des Phasenraums die Vektoren der Geschwindigkeiten mit einbezogen werden, hätte der Phasenraum bei einer Mücke, die sich im Raum orientiert, sechs Dimensionen. Dynamische Systeme mit vielen Freiheitsgraden stellen den Untersuchungsgegenstand eines Gebiets der Physik dar, welches sich Thermodynamik nennt. Solche Systeme befinden sich in einem Fließgleichgewicht fern des Gleichgewichtszustandes, welches ihren durch Entropie bedingten Tod bedeuten würde. Dissipierende Strukturen können unter bestimmten energetischen Verhältnissen Phasenübergänge erleiden, wodurch sie - mitunter schlagartig - zu einem neuen Ordnungszustand gelangen.
Nun verhält es sich so, dass Fraktale wie die von-Kochsche Kurve streng mathematische Gebilde sind, welche durch ihre vollkommene Selbstähnlichkeit bestechen. Naturgetreuere Fraktale können hingegen konstruiert werden, wenn ihre Selbstähnlichkeit nicht exakt, sondern stochastisch interpretiert wird. Interessant dabei ist, dass die dadurch entstehenden Strukturen nicht genau vorhersagbar sind und doch streng gesetzmäßigen Verläufen folgen. Sie werden nicht durch vollkommenen Zufall beherrscht, sondern durch Prozesse des deterministischen Chaos. Viele Forscher gehen davon aus, dass beobachtbare Vorgänge in der Natur durch chaotische Gesetze formiert werden, sei es die Ausbreitung von Zigarettenqualm, sei es die Regulation von Tierpopulationen, sei es das Wachstum von Pflanzen oder menschlichen Organen, deren Strukturen sich somit optimal in einem begrenzten Raum verteilen können. Selbst gesellschaftliche Phänomene wie Revolutionen könnten ihre Erklärung in chaotischen Gesetzmäßigkeiten finden. Ciompi versucht, eine solche Übertragung insbesondere auf die psychische Ebene des Menschen vorzunehmen und behauptet, ,,dass im Bereich der Psyche Nichtlinearität und Unvorhersagbarkeit noch viel häufiger auftreten als in jedem anderen Gebiet der Natur."9Der nächste Abschnitt soll seine These näher vorstellen.
Die Theorie der fraktalen Affektlogik Nach unseren Vorüberlegungen dürfte es nicht schwer fallen, in aller Kürze die
Besonderheiten einer fraktalen Affektlogik herauszuarbeiten. Hiernach erweisen sich affektive Stimmungen sowie die genannten logischen Strukturen als chaotische Attraktoren, welche ,,alles Wahrnehmen und Denken in ihren Bann ziehen."10 Dies geschieht - gemäß ihrer Selbstähnlichkeit - im Kleinen wie im Grossen, d.h. jeder einzelne Gedanke im Rahmen einer logischen Struktur wirkt unter bestimmten Kontextbedingungen und affektiven Voraussetzungen wie ein Magnet auf die allgemeinen Verhaltensweisen des Subjekts. Diese Attraktoren können nur chaotisch sein, da sie als einzige der Variabilität menschlichen Erlebens und Verhaltens gerecht werden. Sie befinden sich im psychischen Phasenraum, welcher als eine (durch die fünf Grundaffekte definierte) Landschaft mit vielen Erhebungen und Tälern vorstellbar ist, über welche die selbstorganisierten psychischen Zustände wie eine Kugel auf und ab rollen. Dabei folgen diese Zustände - oder: die Aufmerksamkeit des Subjekts - bevorzugt den energetisch am meistenökonomischen Wegen. Sie versuchen, in einer Senke aber auf einer Erhebung zu verharren, auf einem möglichst wenig energiekonsumierenden Areal, dem Attraktor. Selbstredend kann die Bewusstseinskugel zwischen mehreren parallel existierenden Attraktoren auf mehr oder weniger eingerollten
Wegen wandern und somit Phasensprünge vollziehen, welche wiederum die logischen Muster verändern, ,,versklaven", wie Ciompi mehrfach mit Haken sagt. Die Bahnen der Aufmerksamkeit können zwar über eine gewisse Struktur aufweisen, sind jedoch in ihrem Verlauf gemäß chaostheoretischer Überlegungen - zu denken ist hier vor allem an den Schmetterlingseffekt - nicht determiniert und stark von ihren Anfangsparametern abhängig. Ein solcher Parameter könnte ein spezifisches Erlebnis sein, welches je nach momentaner Verfassung und Kontext des Subjekts möglicherweise verschiedenste Auswirkungen nach sich zieht.
Grundlegend für diese Sichtweise auf das Psychische ist die Annahme einer Energie, welche Ciompi mit seiner Konzeption, wie schon erwähnt, in den Affekten gefunden sieht. Affekte bieten die Kräfte auf, dem Lustprinzip folge leisten und auch Phasensprünge initiieren zu können. Bei solchen Phasensprüngen würden dann die affektiven Energien auf andere Kognitionen mit anderen Mustern verteilt werden. Nach Ciompi lässt sich die Natur vieler psychopathologischer Phänomene durch die Struktur des Phasenraums und der in ihm stattfindenden Phasensprünge erklären. Auf diese Thesen soll jedoch hier nicht eingegangen werden. Vielmehr soll jetzt eine etwas genauere Betrachtung der Aussagen Ciompis erfolgen, insbesondere in Hinblick auf die zwei Parameter, welche im Thema dieser Arbeit zu finden sind: Des Kontinuitätsgedankens und der Zeitlichkeit. Ab dieser Stelle werden auch allmählich tätigkeitstheoretische Überlegungen mit in die Passagen einfließen.
Unter der Lupe: Ausgewählte Begriffe der Affektlogik
Jetzt, da die Grundzüge der fraktalen Affektlogik bekannt sind, sollen einige ausgewählte Begriffe etwas präziser hinsichtlich ihrer Stringenz untersucht werden, insbesondere hinsichtlich ihres Bezugs zur Geschichte der Naturprozesse. Eine getrennte Untersuchung der von ihm verwendeten Termini nimmt Ciompi lediglich zu analytischen Zwecken vor, also zu Zwecken des besseren Verständnisses, und es sollte stets das theoretische Gebäude in seiner Gesamtheit nicht vergessen werden. Die Frage stellt sich nur, inwiefern diese Begriffe sich auf theoretischer Ebene zu einem Modell für die Erklärung des Psychischen verknüpfen lassen.
Beginnen möchte ich mit dem Begriff des Affekts, welcher von Ciompi als eine ,,psycho- physische Gestimmtheit"11definiert wird, welche von unterschiedlicher Qualität, Dauer und Bewusstseinsnähe sein könne. Ein Affekt solle als Oberbegriff für die schärfer gefassteren Begriffe des Gefühls, der Emotion und der Stimmung dienen. Gefühl sei der bewusst körperlich spürbare Affekt, Emotion der Übergang von einem Affektzustand zum nächsten und Stimmung eine langandauernde Befindlichkeit.
Ich möchte gleich zu Beginn meine wichtigsten Kritikpunkte an Ciompis Affektbegriff verdeutlichen. Der Affektbegriff Ciompis ist meines Erachtens enttäuschend, zum einen da ein Begriff (tautologisch) durch einen anderen ungeklärten Begriff und keinen Inhalt expliziert wird. Selbst wenn es sich für ihn um ein körperliches Phänomen handelt, es wird auf begrifflicher Ebene in aller Konsequenz mitnichten an den Körper gebunden. Zum anderen erachte ich die nach Ciompi vermeintliche Stärke dieses Begriffs, nämlich dass es ich hier um ,,einen handlichen und klaren Oberbegriff ohne jegliche kognitive Einsprengsel"12 handele, gerade als seine Schwäche, wenn es um die Einhaltung des synechistischen Gedankens geht. Durch diese (analytische) Trennung kann er seiner Aussage über den gemeinsamen Ursprung von Kognition und Emotion zumindest auf begrifflicher Ebene nicht genügen, verstößt somit gegen den Kontinuitätsgrundsatz. Emotion - oder Kognition - wäre damit aus dem Nichts und nicht aus der Aktion entstanden, an welche sie Ciompi eigentlich auch binden möchte. Oder sie würde von Anfang an existieren, dann aber unabhängig von der Kognition. (Begründend führt Ciompi beispielsweise Untersuchungen wie diese Joseph LeDoux´ auf, welche hirnphysiologisch Areale emotionaler Gedächtnisinhalte vermuten). Ähnliches wie zur Emotion möchte ich auch bei der Behandlung der Kognition einwenden, welche bei Ciompi als ,,die Wahrnehmung und neuronale Verarbeitung von sensorischen Unterschieden"13bezeichnet wird. Auch hier insistiert Ciompi - in Abgrenzung zu Kernberg - auf die scharfe Trennung zweier wesensmäßig eindeutig unterschiedlicher Funktionssysteme. Zwar stehen nach Ciompi ,,beide komplementären Vorgänge [...] eminent im Dienst des Überlebens und gehören auch insofern untrennbar zusammen."14Doch koppelt ihre begriffliche Trennung kognitive Prozesse von der Emotionalität ab. Sollen Emotion und Kognition einen ursprünglichen Pol haben, so müssen sie als ein einziger Vorgang betrachtet werden. Wie sonst sollen auf diese Weise Prozesse der Abstraktion, welche nach Ciompi als lustvoll erlebt werden, (lustvoller) emotionaler Bewertung unterliegen? Sie müssen durch einen Vorgang, womöglich durch ein drittes System, zu einem Fühl-, Denk- und letztlich Verhaltensprogramm miteinander verbunden werden. Dieses System ist laut meinem Verständnis die Motivation,15welche wiederum selbst Teil dieser Programme ist. Die Stellung des motivationalen Systems verschwimmt jedoch mit den Affekten, welche selbst als ,,Motor" und ,,Leim" kognitiver Elemente gelten.
Als ähnlich empfinde ich die Problematik, wenn es bei Ciompi um den Begriff des Willens geht. Er orientiert sich an Piaget und sieht im Willen einen Affekt, der in seiner Stärke andere Affekte dominiert und zudem an Kognitionen und Verhaltensprogramme ,,heftet". Über die
Entstehung dieser psychischen Funktion und ihren Bezug zu anderen Kategorien äußert er sich nicht.
Mit diesen Einwänden bezweifle ich also den Vorteil der Begrifflichkeiten, wie sie Ciompi verwendet, da sie ihren Zusammenhang in der Erscheinungsform des Psychischen verlieren. Doch eben die Veranschaulichung dieser Zusammenhänge, genau genommen ihrer Einheitlichkeit, sollte meines Erachtens die Terminologie einer psychologischen Theorie der Entstehung der Emotionalität, des Psychischen überhaupt gewährleisten. Um nicht missverstanden zu werden: Es soll damit nicht behauptet werden, die affektlogischen Begriffe Ciompis seien falsch. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass es ihm nicht in ausreichendem Maße gelingt, das Phänomen der Emotionalität bzw. Kognition in Naturzusammenhängen zu betrachten, obschon er dies zweifelsohne versucht.16Ciompi verbleibt trotz seiner Bemühungen bei einem phänomenologischen top-down-Ansatz, welcher der Beschreibung höherer Formen des Lebens genügen mag, niedrige jedoch nicht ausreichend berücksichtigt. Dies kann nur durch einen bottom-up-Ansatz gewährleistet werden.
Im folgenden möchte ich nun mit der tätigkeitstheoretischen Konzeption einen solchen bottom-up-Ansatz vorstellen. Dabei wird sich herausstellen, wie viele Gemeinsamkeiten doch beide Theorien aufweisen, wie jedoch die tätigkeitstheoretischen Kategorien aus meiner Sicht wesentlich schärfer gefasst und in den Lebensprozessen eingeordnet sind. Man mag mir nachsehen, wenn ich aufgrund des gegebenen Rahmens komplexe Sachverhalte in wenigen Worten ausdrücke.
Zweiter Teil
Simonov und die Informationstheorie der Emotionen
Es mag irritierend wirken, wenn Pavel Vassilevic Simonov die Dynamik der Emotionalität von Lebewesen durch eine mathematische Formel ausdrücken wollte, welche gleichzeitig die Grundaussage seiner Theorie darstellen soll und schlicht und ergreifend lautet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gelesen werden könnte diese Formel in etwa folgendermaßen: Eine Emotion (E) ist eine Funktion (f) der Stärke der Bedürfnisse (B) und der Informationsdifferenz (_I). Die Informationsdifferenz ergibt sich aus der notwenigen Information (IN) abzüglich der vorhandenen Information (IV). Zu beachten ist, dass diese Formel lediglich Verhältnisse ausdrücken soll, welche nicht durch konkrete Zahlenwerte fassbar sind.
Was zunächst in vielleicht kryptischer Manier daherkommt, soll ein wichtiges Prinzip verdeutlichen: Der Grad der emotionalen Anspannung eines Lebewesens hängt sowohl von der Stärke eines herrschenden Bedürfnisses ab, als auch von der Wahrscheinlichkeit seiner Befriedigung in einem bestimmten Augenblick.17Dabei verfügt das Subjekt über einen bestimmten Grad an Information (IV) und vergleicht diese mit der Information, welche voraussichtlich für die Befriedigung seines Bedürfnisses benötigt wird (IN). Bei einem Überschuss pragmatischer Information (IN>IV) entsteht in aller Regel eine negative Emotion, welche das Subjekt zu minimieren versucht. Das Gegenteil führt zur Entstehung positiver emotionaler Zustände. Ich gehe nun in aller Kürze etwas genauer auf die einzelnen hier verwendeten Begriffe ein.
Jeder lebendige Organismus steht in einer aktiven Stoffwechselbeziehung mit seiner Umwelt, welche von Vorgängen der Assimilation und Dissimilation gekennzeichnet ist.18Die Notwendigkeit, Stoffquanten aufnehmen zu müssen, drückt sich durch Bedarfszustände des Organismus aus, welche sich auf psychischer Ebene als Bedürfnisse widerspiegeln. Im Laufe der Ontogenese prägt sich eine Fülle von Bedürfnissen aus, die mit bestimmten Bedarfszuständen assoziiert wird. Dabei stellen diese Bedürfnisse die Beweggründe eines Organismus dar. Durch sie erhalten die Ereignisse in der Umwelt ihre pragmatische Bedeutung. Das nach Simonov wichtigste Bedürfnis ist der Drang eines Organismus, Information aufzunehmen, welcher von ihm noch keine pragmatische Bedeutung verliehen wurde, also der Drang nach Neuheit. Simonov erkannte also, dass das Ziel eines Organismus primär nicht die Homöostase und das Streben nach Nützlichem sein kann, sondern die Zunahme an Komplexität. Dieses Bedürfnis wird einerseits durch Exploration gestillt, andererseits - bis zu einem gewissen Grad - durch die Rekombination bereits vorhandener Erfahrungen. Soviel zum ersten Teil der Gleichung.
Der zweite Teil der Gleichung, die Informationsdifferenz, kann gut anhand des Orientierungsreflexes verdeutlicht werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Lebewesen durch die Wechselbeziehung zu seiner Umwelt inmitten einer Reizsituation befindet. Steht es einem semantisch (relativ) unbekannten oder unerwarteten Reiz gegenüber, so begegnen wir in seiner Reaktion der zwei gegensätzlichen Tendenzen der Abwehr oder der Exploration. Welche der beiden Reaktionen auf das Ereignis erfolgt hängt unter anderem von seinem Unterschied zum im Organismus formierten nervalen Modell. Dabei wird die Verarbeitung (der Vergleich) des Eindrucks nicht zur Orientierungsreaktion gezählt, vielmehr tritt diese erst auf, wenn der Reiz als neu oder der Situation nicht angemessen beurteilt wurde.
Während des Orientierungsreflexes löst das Nervensystem zweierlei Aufgaben: Es präzisiert die Semantik des Eindrucks (,,Was ist das?") und entwirft eine mögliche Antwortreaktion (,,Was tun?").
Nach Simonov sind folglich emotionale Zustände vorstellbar als eine Art Scharnier zwischen inneren Prozessen und Vorgängen in der Außenwelt. (Ein Lebewesen bedarf einer subjektiven Instanz, anhand derer es erkennen kann, ob es mit den von ihm ausgeführten Aktivitäten fortfahren kann, oder ob ihm dabei gegebenenfalls Schaden zugefügt wird). Dabei legt Simonov Wert darauf, Emotionen von Bedürfnissen und den zu ihrer Befriedigung notwendigen Handlungen zu unterscheiden. Sie sind ebenso nicht mit Motiven gleich zu setzen, gleichwohl sie eine bedeutende Rolle bei der Vermittlung konkurrierender Motive spielen.
Bevor wir mit Jantzens Erweiterung dieses Modells fortfahren, soll ein vorläufiger Abgleich zwischen Ciompis Ausführungen und Simonovs Informationstheorie stattfinden. Grundsätzlich lassen sich die von Simonov erarbeiteten Elemente in ähnlicher Form auch bei Ciompi vorfinden. Die Bedürfnisse berücksichtigt Ciompi unter anderem, indem er nach Gordon Globus ,,alle psychischen Abläufe als ,bedürfnisgerechte Trajektorien' (need satisfying trajectories)"19bezeichnet und diese in Interdependenz mit der Stimmungslage des Subjekts setzt. Ferner geht er in diese Richtung mit der Übernahme des psychoanalytischen Triebbegriffs. Wenn auch nicht so detailliert, berücksichtigt auch Ciompi den Orientierungsreflex,20oder spricht vom ,,Arousal", also einem subjektiv annehmbaren Grad gelingender Informationsverarbeitung zwischen den Polen der Über- und Unterforderung.21 Den Drang eines Organismus, immer komplexer zu werden, berücksichtigt Ciompi ebenfalls - wenn auch halbherzig. Zwar impliziert das Statut, stimmige Denkwege und Abstraktionsvorgänge bereiteten Lust, genau dieses Element; an anderer Stelle wird aber behauptet, solange alles in Ordnung sei, bestehe keinerlei Grund für den Organismus, homöostatisch irgend etwas zu verändern.22Auch mit anderen Problembereichen, wie diesen des Willens - für Simonov ein ,,Antibedürfnis" - oder der Grundemotionen und ihrer Differenzierung, befassen sich beide Autoren, auf die ich lediglich verweisen möchte. Alles in allem könnte aus meiner Darstellung heraus behauptet werden, Ciompi biete das in seiner Gesamtheit facettenreichere Modell als Simonov. Dem möchte ich nicht nachgehen, sondern die Aufmerksamkeit auf die in diesem Modell verwendeten Begriffe. Hier erweist uns die noch so ungewöhnliche Gleichung Simonovs einen Dienst, indem sie Zusammenhänge plastisch darstellt, wie sie durch Worte kaum besser erläutert werden könnten. Eine Emotion ,,ist gleich" der Funktion von einem Bedürfnis und der
Informationsdifferenz. Sie ist ein einziger Prozess, welcher beide Elemente in sich vereint:
Die Innenwelt durch Bedarfszustände, welche bewertet und zu Bedürfnissen überführt werden, und die Außenwelt durch die Informationsdifferenz. Dabei wird bei der
Wahrnehmung von Ereignissen in der Außenwelt die Veränderung im eigenen Körperbild stets mit einbezogen.
Simonov macht folglich mit seinem Emotionsbegriff - von dem ich annehme, er sei in seinem beabsichtigten Stellenwert dem Affektbegriff Ciompis gleich zu setzen - keinen Unterschied zu kognitiven Elementen. Er impliziert diese bereits. Meines Erachtens ließe sich allenfalls eine Entsprechung zwischen dem Bedürfnisbegriff Simonovs und dem Affektbegriff Ciompis finden, weil diesen Kategorien ähnliche Funktionen zugeschrieben werden. So wird in beiden die Triebkraft jeglicher Aktivität gesehen wird und beide organisieren die
Aufmerksamkeit(en) des Subjekts, bei Simonov in Form des dominierenden unter vielen Bedürfnissen, bei Ciompi durch die affektive Schleusen- und Färbwirkung auf Kognitionen. Wenn aber Ciompi mit seinem Affektbegriff die Bedürfnisse meint und mit seinem Kognitionsbegriff (vermutlich) die Informationsdifferenz, dann, so könnte man meinen, bliebe bei ihm die Gleichung unvollständig! Was wäre dann für Ciompi die simonovsche Emotion? Möglicherweise der Gesamtkomplex der Affektiv-Kognitiven Schemata, der Fühl-, Denk- und Verhaltensprogramme.
An dieser Stelle tritt ein ernstes epistemologisches Problem auf, auf welches ich bereits hingewiesen habe: ,,Wann immer die Beziehung zweier Theorieansätze diskutiert wird, besteht die Gefahr, die eigenen, theoriespezifischen Prämissen zur Grundlage der Kritik der jeweils anderen Theorie zu machen und so - tautologisch - die eigenen Vorannahmen zu bestätigen."23Ohne dieses Problem außer Acht zu lassen kann behauptet werden, dass sich zwischen den beiden hier vorgestellten Konzepten durchaus Analogien aufstellen lassen. Weshalb genügt das Begriffsinventar von Simonov also - wie es meine Ausführungen suggerieren - den Vorsätzen der Kontinuität in stärkerem Maße als dieses von Ciompi? Die Antwort lautet: Es genügt diesen Vorsätzen noch nicht. Auch Simonov denkt nicht synechistisch, da er mit seinem Modell auf der Ebene gegenwärtigen Wahrnehmens und Erlebens verharrt. Simonovs Formel bezieht sich auf einen Augenblick, berücksichtigt nicht aus gemachten Erfahrungen resultierende kognitive Prozesse, welche die Informationsdifferenz beeinflussen können. Gewiss, er berücksichtigt sie in gewisser Hinsicht, jedoch - und hier ähnelt er Ciompi - nicht auf begrifflicher Ebene, sondern nur, indem er sich deskriptiv darüber äußert.24Aber Simonov legt mit seiner Gleichung den
Grundstein, mit dem das Problem der Kontinuität gelöst werden könnte. Dies versucht Wolfgang Jantzen mit seinem auf Simonov basierenden, präziser gefassten Formelwerk.
Das Kontinuitätsproblem: Das Phänomen der Emotionalität im Fluss der Zeit Ein Begriff der Emotionalität, welcher dem Grundsatz der Kontinuität gerecht werden möchte, sollte Emotionen als ein in der Naturgeschichte entstandenes Phänomen betrachten und insofern den Zeitfaktor in sich tragen.
Nun wäre es völlig verfehlt zu behaupten, Ciompi würde in seinen Überlegungen das Phänomen der Zeit nicht berücksichtigen. Gegenteiliges ist der Fall, dieses Phänomen nimmt einen wichtigen Platz in seinen Argumentationen ein, insbesondere in seiner Publikation ,,Innenwelt und Außenwelt". Er bezieht rhythmische Prozesse mit ein, wenn es um die Entwicklung des Bewusstseins in der menschlichen Soziogenese geht. Die hierarchische Entwicklung der Psyche vollzieht sich für ihn maßgeblich durch die Verdichtung von Information, wobei synchrone Invarianz aus diachroner Varianz extrahiert, in ,,condensed experiences" verdichtet wird. Die an sich irreversible Zeit werde durch geistige Prozesse reversibel, wobei es im Mikrokosmos eine unendliche Anzahl von Eigenzeiten gebe. Fühlprozesse seien im Grunde langsam (synchron), verglichen mit varianten Denkprozessen. Schließlich möchte auch Ciompi durch seinen absichtlich weit gefassten, von der Kognition befreiten Affektbegriff, der Kontinuität zwischen Phylo- und Ontogenese, der evolutionären Perspektive ,,bis tief hinab ins Tierreich"25gerecht werden.
Die Schwäche seines Ansatzes besteht meiner Ansicht nach darin, dass er all´ diese Prozesse mit seinen Begriffen nicht konsequent an den Organismus und seine Aktion bindet, sondern lediglich deskriptiv vorgeht. Die folgenden Abschnitte sollen dies auf der Folie des Entwurfs Jantzens verdeutlichen.
Emotionen finden naturgemäß in der (fließenden) Gegenwart statt. Beziehen wir uns auf die Formel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
so kann mit Jantzen festgestellt werden, dass durch diese Formel die Informationsdifferenz
nicht zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft differenziert. Hypothesenbildung und ihr Einfluss auf die Informationsdifferenz, wie sie in Subjekten bei der Lösung eines Problems stattfindet, wäre hier nicht denkbar, da erst nach vollendeter Aktion auf die notwendige Information zurückgegriffen werden kann. Jegliche Prozesse wären ohne diese vorgreifende Widerspiegelung von blinder Selektion oder absoluter Passivität gekennzeichnet.
Wichtig ist, dass sich eine vorgreifende Widerspiegelung der Veränderung der
Informationsdifferenz selbst in jedem Augenblick der Gegenwart realisiert, das Subjekt also ein bestimmtes Verhältnis beider Werte erwartet (Modell des Künftigen) und dies mit dem realisierten Verhältnis vergleicht. In diesem Modell des Künftigen existiert die antizipierte (positive) Emotion als nützlicher Endeffekt26für den Organismus. Da sich Simonov auf die momentane Wahrnehmung konzentriert, modifiziert Jantzen seine Formel zu
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
wobei _IW die augenblicklich wahrgenommene Informationsdifferenz darstellen soll. In einem nächsten Schritt wird der Gegenstand eines Bedürfnisses fixiert, also der Gegenstand, durch den der nützliche Endeffekt möglicherweise realisiert werden könnte. Es entsteht ein zum latenten (subdominanten) Motiv transformiertes Bedürfnis, dargestellt durch die Gleichung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
wobei Msd das subdominante Motiv ist und _IT die Informationsdifferenz auf der
Tätigkeitsebene [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Dies bedeutet nichts anderes als dass ein Handlungsplan entworfen wurde und hinsichtlich seiner Realisierbarkeit überprüft wird. Durch den Rückgriff auf die eigene Vergangenheit entstehen Alternativen, also viele subdominante Motive. Der Akt der Entscheidung für eine dieser Alternativen, folglich der Übergang mehrerer subdominanter Motive zu einem dominierenden Motiv wird wiederum dargestellt durch die Gleichung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
anders ausgedrückt: ,,Das dominante Motiv entsteht [...] aus jenem subdominanten Motiv, das die positivste bzw. die am wenigsten negativste emotionale Bewertung erfährt."27 Ein zunächst unspezifiziertes Bedürfnis wurde nun spezifiziert und somit nach Leontjev zum Motiv umgewandelt. ,,Der Gegenstand als Aufhebung der Unbestimmtheit des Bedürfnisses ist das eigentliche Motiv der Tätigkeit. Die Entstehung des Motivs geht einher mit einer veränderten Informationsdifferenz, die [...] jetzt nicht mehr auf die Wahrnehmungsebene bezogen ist, sondern auf Tätigkeitsebene, nämlich auf den Entwurf der möglichen Tätigkeit."28
Analog bezeichnet Ciompi den hier beschriebenen Prozess der dominanten Motivbildung als Willensbildung, bei der ein besonders starker Affekt andere Affekte dominiere. Anders
Simonov und die Tätigkeitstheorie, für die der Wille ein auf den Freiheitsreflex basierendes
Bedürfnis ist, eine Hindernisse überwindende Aktivität. Diese ergänze ein die Handlung initiierendes Motiv, sei aber unabhängig von diesem. Anders als gewöhnliche Bedürfnisse nehme der Wille bei ansteigender Informationsdifferenz in seiner Stärke zu und nicht ab,29so dass er dem Organismus auch die Orientierung auf schwer erreichbare Gegenstände ermögliche und nicht nur auf den ,,Spatzen in der Hand".
Die letzte - und schwierigste - Gleichung, durch welche das Modell des Künftigen beschrieben wird, möchte ich hier nicht aufführen, sondern nur sinngemäß umschreiben.
Danach überwindet der Organismus sukzessive die pragmatische Ungewissheit durch seine Tätigkeit, wobei er gleichzeitig die emotionale Befriedigung am Ziele seiner Bewegungen antizipiert. Bestenfalls reduziert sich die Informationsdifferenz auf Null, das Bedürfnis wäre im Produkt erloschen und die emotionale Erregung wäre abgeklungen. Wichtig ist, _IT nicht nur auf die bedürfnisrelevante Seite der Aktivität (der Tätigkeit) zu beziehen, sondern auch auf Handlungs- und (automatisierter) Operationsebene, ganz gemäß der Makrostruktur der Tätigkeit durch Leontjev. Gerade dadurch wird der Zusammenhang zwischen Mentalisierungsprozessen, ihrer Hierarchisierung unter einem dominierenden Motiv und der darin implizierten Emotionalität deutlich, und zwar eines in der Dimension Zeit aktiven Individuums. Somit lassen sich Lernprozesse erfassen als Vorgänge, bei denen die Modelle möglicher Zukunft durch Handlungen und Operationen in der Gegenwart bekräftigt und im Gedächtnis als Vergangenheit gespeichert werden.
Über Sinn und Unsinn dieser für Psychologen ungewöhnlich anmutenden Gleichungen ließe sich lange streiten. Ich sehe in ihnen mittlerweile wichtige Begrifflichkeiten, die in ihrem Gesamtzusammenhang dem Kontinuitätsgedanken bei der Behandlung psychischer Prozesse entsprechen können. Dies möchte ich im folgenden Kapitel noch etwas präziser fassen.
Moderne Selbstorganisationstheorie und das Emotionsproblem Ciompi bezieht beim Entwurf seines relativen Konstruktivismus kritisch Stellung gegenüber radikalen Konstruktivisten.30Nichtsdestotrotz konnte ich keine kritischen Anmerkungen hinsichtlich der biologischen Väter dieses Paradigmas, Humberto Maturana und Francisco Varela, erkennen. Ciompi scheint die Grundannahmen ihrer Selbstorganisationstheorie zu übernehmen und folgt Begriffen, wie dem der reziproken strukturellen Koppelung zwischen verschiedenen Phänomenbereichen. Diese wären jedoch überdenkenswert. Als besonders interessant - und für Ciompis top-down-Ansatz bezeichnend - empfinde ich den Tatbestand, dass er auf grundlegende Erkenntnisse des Chemie-Nobelpreisträgers Ilya
Prigogine erst auf Seite 288 kurz Bezug herstellt, gegen Ende seines Buchs. Prigogine beschäftigt sich mit chemischen Uhren, welche sich für das Problem der Entstehung des Psychischen und emotionaler Empfindungen als bedeutsam herausstellen lassen. Anders als Ciompi verfährt Jantzen, welcher detailliert solche Phänomenbereiche untersucht und so dem Problem der Kontinuität nachspürt. Seine Thesen möchte ich stark vereinfacht im folgenden vorstellen.
Es gilt als gesichert, dass Lebewesen auf allen Ebenen ihrer Organisation über
Schrittmacherstrukturen verfügen, mittels derer ihre Existenzweise als ein chronobiologischer Prozess organisiert wird. Dieser Prozess ist auf einer zeitlichen Dimension gerichtet und vermittelt Gegenwart und Zukunft in einem Subjekt, indem sogenannte Makrozeiteinheiten der Außenwelt in Mikrozeiteinheiten seiner Innenwelt übersetzt werden. Die Sackgasse eines epistemologischen Solipsismus, wie z.B. beim radikalen Konstruktivismus im Sinne Roths, kann überwunden werden, wenn man das autopoietische System zwar als operational geschlossen, jedoch (informationell) offen gegenüber zeitlicher Musterung annimmt. Insofern würde es die Welt rekonstruieren, indem es sie (strukturdeterminiert) in einem Raum-Zeit- Kontinuum konstruiert. Hier findet sich die Dialektik zwischen dem Körperselbstbild und dem Bild der Außenwelt wieder.
Das System verfügt folglich über eine intrinsische Systemzeit, einer eigenen Pulsfrequenz, welche jedoch zur extrinsischen Eigenzeit durch Einflüsse der Umwelt wird, die das System an seinem Rand erfährt.31Ihre Anfänge in der Naturgeschichte findet die Systemzeit in periodisch oszillierenden chemischen Uhren, welche als Strukturen in einem Zustand fern des Gleichgewichts zu existieren vermögen. In ihrer Labilität garantiert ihnen die Pulsfrequenz eine gewisse Stabilität, aus welcher die Zeit als irreversibel betrachtet werden könnte. Zufällige Zustandsveränderungen aufgrund einer Störung (Symmetriebrüche) stellen Bifurkationen in der Systemgeschichte dar. Durch die Koordination von Systemzeit (Sinnstukturen) und Eigenzeit (Bedeutungskonstruktion) lernt das System und reagiert in Abhängigkeit von seiner Vorgeschichte. Es kann also davon ausgegangen werden, dass bereits dissipative Strukturen über eine Art Urgedächtnis und damit über Identität verfügen, wobei sich ihre Einzelteile kohärent verhalten, d.h. stets vom Zustand des Gesamtsystems informiert sind32bzw. sich so verhalten als seien sie dies. Autopoietische Systeme (z.B. Amöben) können sich in einem nächsten Schritt - anders als dissipative - selbstherstellend auf Attraktoren der Außenwelt beziehen, z.B. auf die Konzentration eines bestimmen Nährstoffes. Nach diesen Überlegungen könnte die strukturelle Koppelung eines Systems im Sinne Maturanas als eine zeitliche Koppelung verstanden werden, in der das System zwischen seiner
Systemzeit und der Eigenzeit zu vermitteln versucht. Dies geschieht durch zwei
Phaseneinstellungen. Ändern sich die Schwingungen der Umwelt, so treten bei den
Schwingungen des Subjekts Interferenzen in Form einer geraden Einstellung auf. Das bedeutet, dass seine Schwingung (und damit seine Orientierungsaktivität) abrupt unterbrochen und von neuem angefangen wird, indem auf die eigene Systemzeit zurückgegriffen wird. Die neue Schwingung stellt für das Subjekt zunächst eine unbekannte Situation dar, welche durch Aktivität bewältigt werden muss. Die neue Bedingung wird assimiliert, und sollte künftig eine ähnliche Situation auftreten, so könnte es durch Rückgriff auf bereits hergestellte Strukturen die folgenden Umweltveränderungen antizipieren und sogleich seine Frequenz adaptieren, ohne dass es erneut mit einer geraden Phaseneinstellung reagieren müsste. Die Einwirkung wird nicht länger als völlig neu eingeschätzt, so dass die Antizipation der Fortsetzung der Aktivität gegeben ist - eine ungerade Phaseneinstellung in der eigenzeitlichen Organisation des Subjekts tritt ein.33Natürlich können Affekte sowie Emotionen auch im positiven Sinne eintreten als Begleitung von Sprüngen zwischen verschiedenen Motiven der Tätigkeit, wobei diese nicht zusammenbricht, sondern sich auf ein höheres Niveau stabilisiert. Das höhere Tätigkeitsniveau ist seinerseits im dominierenden Motiv (im Modell des Künftigen) verankert, womit der Bezug zu den Gleichungen hergestellt wäre.
Tätigkeitstheoretisch werden dementsprechend die subjektiven Reaktionen, welche beide Phaseneinstellungen begleiten, voneinander unterschieden. Die subjektive Regung, welche mit einer (für den äußeren Beobachter wahrnehmbaren) geraden Phaseneinstellung einhergeht, wird Affekt genannt. Die ungerade Phasenseinstellung, welche durch Aktivität den Grad der Trivialität verändert, findet sich subjektiv in einer Emotion wieder. ,,Wir können [...] die Emotionen [...] als Begleitung der Orientierungstätigkeit begreifen, so dass die Färbung der Emotionen bzw. deren Veränderung im Prozess den Tätigkeitsprozess verlängern oder verkürzen kann, d.h. Appetenz- oder Vermeidungsverhalten zu generieren vermag."34 An dieser Stelle kann der Bezug zum Arousal hergestellt werden, zum individuellen Bedürfnis jedes Organismus, innere und äußere Prozesse miteinander zu harmonisieren. Dieses Gleichgewicht zwischen den Schwellen noch annehmbaren Maßes zwischen Neuheit und Vertrautheit wird mitunter durch den Mechanismus der geraden und ungeraden Phaseneinstellung gewährleistet. Ist die Fortsetzung (der Antizipation) des Nachvollzugs äußerer Einwirkungen nicht garantiert, so schießt der Affekt ein. Bleibt ein Mindestmaß an Nachvollziehbarkeit erhalten, so wird die Informationsverarbeitung durch Emotionen begleitet. Geschieht dieser Nachvollzug besonders langsam, spricht die Tätigkeitstheorie - in diesem Fall in Korrespondenz mit Ciompi - von Stimmungen.
Soweit zu den Ausführungen Jantzens. Ein Vergleich mit der Terminologie der Affektlogik macht deutlich, dass die tätigkeitstheoretischen Begriffe (Emotion, Affekt, Stimmung, Wille, Bedürfnis, Motiv) wesentlich stärker voneinander abgegrenzt und an Inhalte (!) gebunden sind, welche ihrerseits von der Naturgeschichte ableitbar sind. (Natürlich sind diese Inhalte nicht als Entitäten zu verstehen, sondern auch hier als Konstrukte, welche sich im wissenschaftlichen Prozess als plausibel herausgestellt haben). Nach der hier gewährleisteten Begriffsanalyse möchte ich im nächsten und abschließenden Abschnitt auf die gesamttheoretische Ebene zurückkehren und zu den Grundgedanken der fraktalen Affektlogik nochmals zusammenfassend Stellung beziehen.
Abschließende Bemerkungen
Die Art und Weise, mit der die fraktale Affektlogik psycho-sozio-biologische Prozesse zu erklären versucht, ist zutiefst anschaulich und bestechend plausibel. Sie bietet auf den ersten Blick ein überschaubares Werkzeug, anhand dessen das Konstrukt ,,Psyche" in seinen Gesetzmäßigkeiten untersucht werden könnte. Plausibilität ist Ciompis Modell zuzuschreiben, da es dank der chaostheoretischen Implikationen prinzipiell der Entwicklung nahezu alle Chancen lässt - etwas ist in einem bestimmten Augenblick möglich, oder auch nicht - und da es Alltagsphänomene in einleuchtender Weise zu beschreiben vermag. Die Konstruktion des psychischen Phasenraums kann eine gewisse Faszination ausüben und bildet meines Erachtens die (mögliche) Reichhaltigkeit einer Persönlichkeitsstruktur überzeugend ab. Das Moment der Fraktalität kann die Hierarchisierung der Bausteine der Psyche erklären und Verhaltensweisen auf der zeitlichen Ebene beschreiben. (Im übrigen könnte Carl Pribrams Konzept des holographischen Gedächtnisses als eine fraktale Struktur interpretiert werden, anhand der eine Erklärung für das Ausbleiben von erwarteten Gedächtnisverlusten nach lokalen Hirnläsionen geboten wird). Auch psychopathologische Phänomene, wie z.B. Persönlichkeitsstörungen, können mit Leichtigkeit skizziert werden. Schließlich verhelfen die therapeutischen Konsequenzen der Affektlogik zur Überwindung eines methodologischen Reduktionismus.
Trotz dieser Vorzüge verspüre ich bei der Beschäftigung mit dem affektlogischen Modell eine gewisse Skepsis, welche sich insbesondere aus seinen theoretischen Aussagen herleitet. Diese Skepsis war oftmals mit der Frage nach dem ,,Wie?" verbunden, aber auch mit Fragen, die Ciompi selbst als ,,Methodologische Knacknüsse" bezeichnete. Beispielsweise reicht es für mein Empfinden nicht aus zu betonen - im Grunde genommen eine Banalität -, Denken und Fühlen stünden in Wechselbeziehung und beeinflussten einander, ohne diese Beziehunginhaltlich zu definieren. Dass die Begriffe der Affektlogik letztendlich dazu nicht in der Lage sind, hoffe ich überzeugend dargestellt zu haben.
Mein Zweifel ist auch mit dem Eindruck verbunden, Ciompi stülpe der Psyche das chaostheoretische Modell über. Ein Konstrukt, welches ursprünglich für die Erklärung anderer Sachverhalte errichtet worden ist, wird nun eins zu eins auf das Innenleben des
Menschen übertragen. Dass diese Schablone erst angepasst werden muss offenbart sich mit den Fragen, die Ciompi stellt. Paradigmatisch ist seine Suche nach dem Abstraktum der ,,psychischen Energie", welches für den chaostheoretischen Zugang zur Psyche als dissipatives Energieverteilungsmuster unabdingbar ist und welches er schließlich in den Affekten gefunden zu haben meint.35Diese Energien - und hier ist Ciompi von Freud beeinflusst36- können auf kognitive Elemente umverteilt werden, Attraktoren bilden und Spannungen erzeugen, welche das dissipative System der Psyche beispielsweise zum Überschnappen und damit zum Wahnsinn, zum psychotischen Verrücktsein treiben können.37 Mag auch dieses Energiereservoir lediglich metaphorisch eingesetzt sein, so sollte sie trotzdem nicht mit dem Erklärungsprinzip verwechselt werden. Ohnehin ist aus der Sicht moderner neurophysiologischer Erkenntnisse die Annahme einer solchen psychischen Energie sehr fragwürdig, welche sich an physikalische Gesetze lehnt.38Hier habe ich den Eindruck als würde von Ciompi ein Abstraktum zum Konkretum gemacht. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff des Attraktors, von dem Ciompi meint, er habe ihn in den EEG-Mustern schizophrener Patienten verorten können.39
Meiner Meinung nach sollte die Energie der Affekte als Organisator psychischer Vorgänge durch die oszillatorisch-zeitlichen Prozesse ersetzt werden. In der Zeit, nicht in einer Energie, findet sich der Protoorganisator, wie Jantzen in seiner These zum Ausdruck bringt.40Durch zeitliche Prozesse könnte auch dem Unbewussten nachgegangen werden, was Ciompi in Nebenattraktoren sucht, welche das psychische Feld samt der Bewusstseinskugel zu versklaven verstehen. Alternativ könnten solche Prozesse als oszillatorisches Verhalten von Subsystemen gefasst werden, welche sich zu einer Systemzeit der Gesamtstruktur integrieren. Die Substrukturen ordnen sich somit im Sinne der Kohärenz dem Gesamtsystem kooperativ unter, versklaven sich nicht. Das Gesamtsystem hat nun den Vorzug, über die einzelnen Oszillatoren der Substrukturen zu verfügen und dadurch in seinem Verhalten variabler zu sein. Selbstredend ist die zeitliche Abstimmung aller ,,Mitspieler" entscheidend, die Entkoppelung einzelner Systeme könnte zu pathologischen Erscheinungen führen, auf somatischer Ebene beispielsweise zu krebsartigen Wucherungen.
Sind die hier genannten und ähnliche Inhalte auf theoretischer Ebene nicht geklärt, so lassen sich auch die Folgerungen der Affektlogik für die Praxis streng genommen schwerlich legitimieren, wenn sie auch in Ciompis Fall in die richtige Richtung weisen. Zu teilen ist das psychosomatische Element, welches gefordert wird, die erwähnte Vermeidung reduktionistischer Therapieformen, oder auch die Tatsache, dass Lernprozesse nur unter bestimmten affektiven Voraussetzungen stattfinden können. Doch die Frage nach den praktischen Folgen der fraktalen Affektlogik verbindet sich auch mit weiteren Aussagen: Hilft es dem Verständnis der Erkrankung des einzelnen, wenn ich ein Diagramm habe, welches zeigt, wann er einen schizophrenen Ausbruch gehabt hat? Was nützt es, wenn ich weiß, diese Ausbrüche folgen chaotischen Mustern? Ist es bahnbrechend zu behaupten, schizophrene Patienten hätten aufgrund ihrer verstärkten Dünnhäutigkeit Angst im sozialen Verkehr? Und dass Ziel jeder Therapie das ,,Zurückschnappen" in (wie auch immer definierte) gesündere Fühl-, Denk- und Verhaltensweisen sein sollte, versteht sich ebenfalls von selbst. Dennoch bleibt als Fazit festzuhalten, dass Ciompi mit seiner fraktalen Affektlogik eine Theorie entworfen hat, welche die Ganzheitlichkeit der Lebensprozesse zu erfassen versucht, ohne ihre Komplexität aus den Augen zu verlieren. Die beiden Grundsätze der Zeitlichkeit und Kontinuität werden auf gedanklicher Ebene mit einbezogen, ohne leider ihren Niederschlag in der Terminologie zu finden, welche inhaltlich erweitert bzw. präzisiert werden sollte. Bleibt zu hoffen, dass die interessanten Sichtweisen dieses umfassenden und doch übersichtlichen Modells durch seinen wissenschaftlichen und praktischen Gebrauch nicht in Vergessenheit geraten.
Literatur
Brenneis, Brooks C. (1998), ,,Gedächtnissysteme und der psychoanalytische Abruf von Trauma-Erinnerungen", in: Psyche, Nr. 9/10 (S. 801 - 823)
Ciompi, Luc (1988),Außenwelt - Innenwelt - Die Entstehung von Zeit, Raum und psychischen Strukturen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Ciompi, Luc (1993), ,,Die Hypothese der Affektlogik", in:Spektrum der Wissenschaft, Februarausgabe (S. 76 - 87)
Ciompi, Luc (1999[2]),Die emotionalen Grundlagen des Denkens - Entwurf einer fraktalen Affektlogik, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Damasio, Antonio R. (1998[3]),Descartes´Irrtum - Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, München: dtv
Deneke, Friedrich-Wilhelm (1999),Psychische Struktur und Gehirn - Die Gestaltung subjektiver Wirklichkeiten, Stuttgart: Schattauer
De Sousa, Ronald (1997),Die Rationalität des Gefühls, Frankfurt am Main: Suhrkamp
GEO Wissen (11/1993[2]),Chaos und Kreativität, Hamburg: Gruner+Jahr
Jantzen, Wolfgang (1990),Allgemeine Behindertenpädagogik, Bd. 2: Neurowissenschaftliche Grundlagen, Diagnostik, Pädagogik und Therapie, Weinheim und Basel: Beltz Jantzen, Wolfgang (1992[2]),Allgemeine Behindertenpädagogik, Bd. 1: Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen, Weinheim und Basel: Beltz
Jantzen, Wolfgang (1994),Am Anfang war der Sinn: Zur Naturgeschichte, Psychologie und Philosophie von Tätigkeit, Sinn und Dialog, Marburg: BdWi-Verlag (Forum Wissenschaft: Studien; Bd. 23)
Laplanche, J. und Pontalis, J.-B. (1999[15]),Das Vokabular der Psychoanalyse, Frankfurt am Main: Suhrkamp
Lauwerier, Hans (1992[2]a),Fraktale - Verstehen und selbst programmieren Bd. 1, Hückelhoven: Wittig-Fachbuchverlag
Lauwerier, Hans (1992b),Fraktale - Verstehen und selbst programmieren Bd. 2, Hückelhoven: Wittig-Fachbuchverlag
LeDoux, Joseph E. (1999), ,,Das Gedächtnis für Angst", in: Spektrum der Wissenschaft Dossier, Heft 3/1999 (S. 16 - 23)
Leontjev, Alexejev N. (1980[3]),Probleme der Entwicklung des Psychischen, Frankfurt: Athenäum Fischer
Maturana, Humberto R. und Varela, Francisco J. (1987),Der Baum der Erkenntnis - Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens, Bern/München: Scherz-Verlag
Peirce, Charles S. (1968),Über die Klarheit unserer Gedanken - How to make our ideas clear, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Peirce, Charles S. (1976[2]),Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus I und II, Frankfurt am Main: Suhrkamp (Hg. Karl-Otto Apel)
Peirce, Charles S. (1991a),Naturordnung und Zeichenprozess - Schriftenüber Semiotik und Naturphilosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp (Hg. Helmut Pape)
Peirce, Charles S. (1991b),Vorlesungenüber Pragmatismus, Hamburg: Felix Meiner Verlag (1973[1])
Peitgen, Heinz-Otto u.a. (1992a),Bausteine des Chaos - Fraktale, Stuttgart: KlettCotta/Springer-Verlag
Peitgen, Heinz-Otto u.a. (1992b),Fractals for the Classroom - Part Two: Complex Systems and Mandelbrot Set, New York: Springer-Verlag
Simon, Fritz B. (1994), ,,Die Form der Psyche. Psychoanalyse und neuere Systemtheorie" in:Psyche, Nr. 1 (S. 50 - 79)
Simon, Fritz B. (1995[2]em>Unterschiede, die Unterschiede machen - Klinische Epistemologie: Grundlagen einer systemischen Psychiatrie und Psychosomatik, Frankfurt am Main: Suhrkamp
Simonov, Pavel V. (1982),Höhere Nerventätigkeit des Menschen: Motivationelle und emotionale Aspekte, Berlin: VEB Verlag Volk und Gesundheit
Solms, Mark (1996), ,,Was sind Affekte?", in:Psyche, Nr. 6 (S. 485 - 522)
Solms, Mark (1998), ,,Psychoanalytische Beobachtungen an vier Patienten mit ventromesialen Frontalhirnläsionen", in:Psyche, Nr. 9/10 (S. 919 - 962)
Ulich, Dieter (1999), ,,Emotion", in: Asanger, Roland und Wenninger, Gerd (Hg.),Handwörterbuch Psychologie, Weinheim: Psychologie Verlags Union (S. 127 - 132) Zimbardo, Phillip G. (1995[6]),Psychologie, Berlin: Springer
[...]
1 Vgl. Peirce 1991a.
2 Vgl. Leontjev 1980, S. 21.
3 Vgl. Ciompi 1999, S. 289.
4 Vgl. Ciompi 1999, S.48.
5 Ciompi 1999, S. 47; vgl. S. 95.
6 Vgl. den Begriff der ,,Bahnung" von Freud.
7 Ciompi 1999, S. 126.
8 Lauwerier 1992, S. 9.
9 Ciompi 1999, S. 133.
10 Ciompi 1999, S. 153.
11 Ciompi 1999, S. 67.
12 Ebd., S. 67.
13 Ebd., S. 274.
14 Ciompi 1999, S. 75.
15 Vgl. ebd., S. 86.
16 Vgl. z.B. ebd., S. 73f., S. 288.
17 Vgl. Simonov 1982, S. 89.
18 Vgl. z.B. Leontjev 1973, S. 23ff.
19 Ciompi 1999, S. 161.
20 Vgl. Ciompi 1999, S. 100.
21 Vgl. ebd., S. 112.
22 Vgl. ebd., S. 113.
23 Simon 1994, S. 51.
24 Vgl. Simonov 1982, S. 79.
25 Ciompi 1999, S. 67.
26 Vgl. Jantzen 1994, S. 118.
27 Jantzen 1994, S. 117.
28 Ebd., S. 128.
29 Vgl. Simonov 1982, S. 144.
30 Vgl. Ciompi 1999, S. 90.
31 Vgl. Jantzen 1994, S. 93, S. 102.
32 Vgl. Simon 1995, S. 214.
33 Zu einer detaillierten Darstellung mit Abbildungen vgl. z.B. Jantzen 1994, S. 131f.; Jantzen 1990, S. 30.
34 Jantzen 1994 S. 130f., vgl. Leontjev 1978, S.121f.
35 Vgl. Ciompi 1999, S. 158.
36 Vgl. ebd., S. 273.
37 Vgl. ebd., S. 226.
38 Hierzu verweise ich z.B. auf Deneke 1999, S. 26ff.
39 Vgl. Ciompi 1999, S. 225.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptaussagen der Affektlogik nach Ciompi?
Ciompi versucht, die theoretischen Überlegungen von Jean Piaget, der Psychoanalyse und der Systemtheorie zu synthetisieren, wobei er letztere durch die Chaostheorie ersetzt. Mentale Strukturen entstehen in einem Interaktionszusammenhang und werden hierarchisiert. Affekte und Kognitionen spielen eine Rolle bei der Handlungsstruktur und Realitätskonstruktion. Affektlogische Schemata, bestehend aus affektiven und kognitiven Polen, sind die Bausteine der Psyche. Fühlen, Denken und Verhalten stehen in engstem Zusammenhang zueinander.
Was versteht man unter fraktaler Affektlogik?
Affektive Stimmungen sowie logische Strukturen erweisen sich als chaotische Attraktoren. Dies geschieht im Kleinen wie im Großen, d.h. jeder einzelne Gedanke im Rahmen einer logischen Struktur wirkt unter bestimmten Kontextbedingungen und affektiven Voraussetzungen wie ein Magnet auf die allgemeinen Verhaltensweisen des Subjekts. Die psychischen Zustände rollen wie eine Kugel auf und ab, den energetisch am meistenökonomischen Wegen folgend.
Was kritisiert der Text an Ciompis Affektbegriff?
Der Affektbegriff Ciompis wird als enttäuschend bezeichnet, da er durch einen anderen ungeklärten Begriff expliziert wird und nicht konsequent an den Körper gebunden ist. Die analytische Trennung von Affekt und Kognition genügt nicht dem synechistischen Gedanken.
Was ist Simonovs Informationstheorie der Emotionen?
Simonov drückt die Dynamik der Emotionalität durch eine mathematische Formel aus: E = f(B, _I). Der Grad der emotionalen Anspannung eines Lebewesens hängt sowohl von der Stärke eines herrschenden Bedürfnisses ab, als auch von der Wahrscheinlichkeit seiner Befriedigung. Die Informationsdifferenz (_I) ergibt sich aus der notwenigen Information (IN) abzüglich der vorhandenen Information (IV).
Inwiefern ergänzt Jantzen Simonovs Theorie?
Jantzen kritisiert, dass Simonovs Formel die Informationsdifferenz nicht zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft differenziert. Jantzen modifiziert Simonovs Formel und fixiert den Gegenstand eines Bedürfnisses, wodurch ein latentes Motiv entsteht. Durch den Rückgriff auf die eigene Vergangenheit entstehen Alternativen und ein dominierendes Motiv.
Welche Rolle spielen Schrittmacherstrukturen in Bezug auf Emotionen?
Lebewesen verfügen über Schrittmacherstrukturen, mittels derer ihre Existenzweise als ein chronobiologischer Prozess organisiert wird. Dieser Prozess ist auf einer zeitlichen Dimension gerichtet und vermittelt Gegenwart und Zukunft in einem Subjekt, indem Makrozeiteinheiten der Außenwelt in Mikrozeiteinheiten seiner Innenwelt übersetzt werden.
Wie wird der Unterschied zwischen Affekt und Emotion in der Tätigkeitstheorie erklärt?
Die subjektive Regung, welche mit einer geraden Phaseneinstellung einhergeht, wird Affekt genannt. Die ungerade Phaseneinstellung, welche durch Aktivität den Grad der Trivialität verändert, findet sich subjektiv in einer Emotion wieder. Emotionen werden als Begleitung der Orientierungstätigkeit begriffen, welche den Tätigkeitsprozess verlängern oder verkürzen kann.
Was sind die abschließenden Bemerkungen zur fraktalen Affektlogik?
Die fraktale Affektlogik ist anschaulich und plausibel, bietet ein überschaubares Werkzeug zur Untersuchung der Psyche. Jedoch gibt es Skepsis aufgrund der theoretischen Aussagen und der Frage nach dem "Wie?". Es wird kritisiert, dass das chaostheoretische Modell der Psyche übergestülpt wird. Die Energie der Affekte als Organisator psychischer Vorgänge sollte durch die oszillatorisch-zeitlichen Prozesse ersetzt werden.
- Quote paper
- Giourgas Alexandros (Author), 2001, Kontinuität und Zeitlichkeit - Ciompis Emotionskonzept aus der Sicht zweier Parameter, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98880