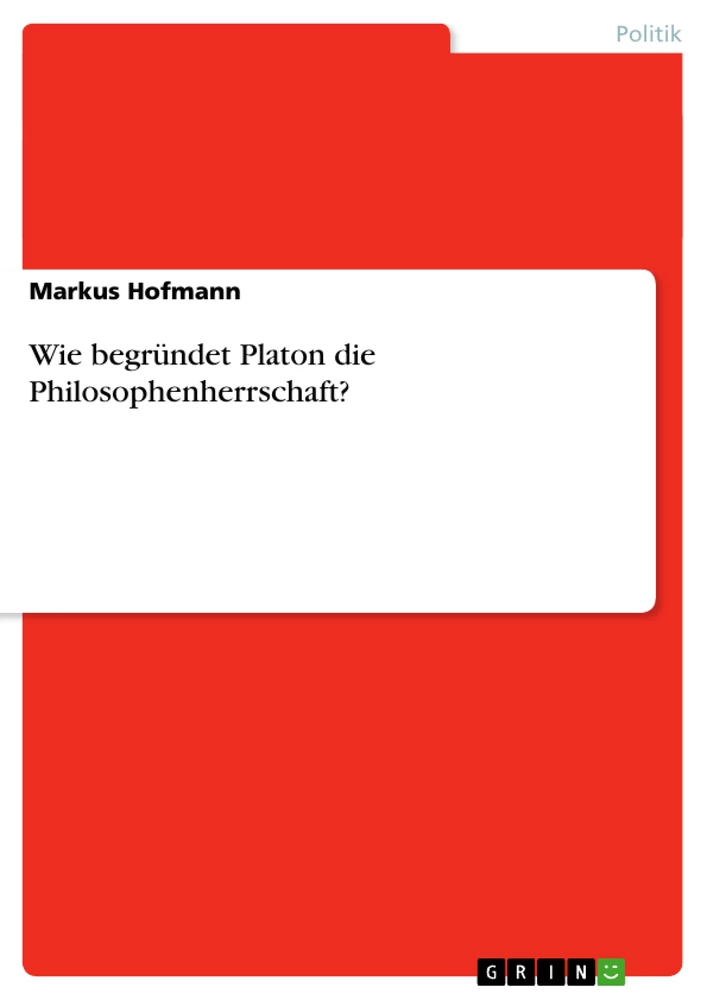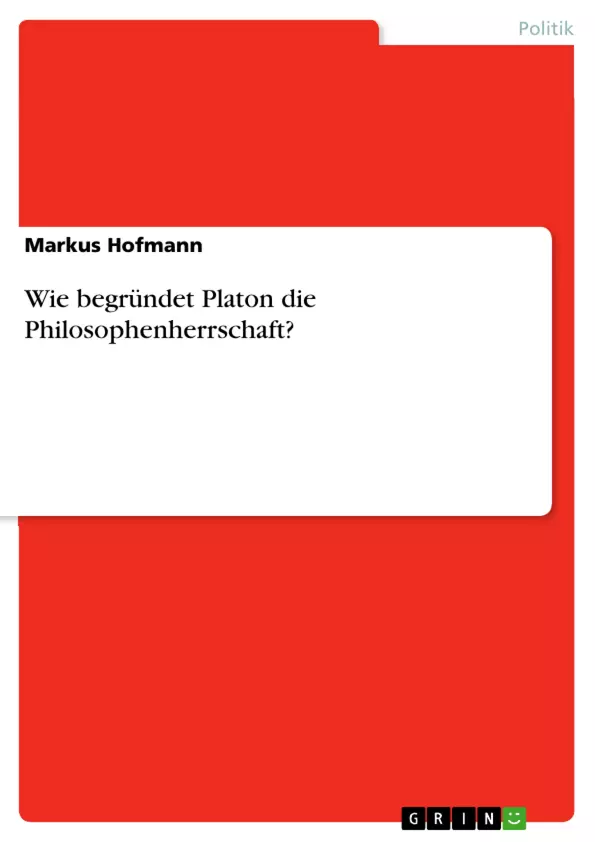In einer Welt, die von Korruption und Skandalen erschüttert wird, erhebt sich die zeitlose Frage: Wer ist geeignet, einen Staat zu führen? Platons "Politeia", ein Eckpfeiler der politischen Philosophie, wagt eine revolutionäre Antwort: die Herrschaft der Philosophen. Doch was macht einen Philosophen zum idealen Staatsmann? Entdecken Sie Platons tiefgründige Analyse der philosophischen Seele, ihre unstillbare Sehnsucht nach Wahrheit und Erkenntnis, und ihre Fähigkeit, jenseits des trügerischen Scheins das wahre Sein zu erkennen. Tauchen Sie ein in das berühmte Höhlengleichnis und das Sonnengleichnis, die Platons Unterscheidung zwischen Meinen und Wissen aufzeigen und die Essenz der Idee des Guten enthüllen. Erfahren Sie, wie Platon die wahren Philosophen von den Sophisten abgrenzt, jenen Blendern, die lediglich nach Macht und Anerkennung streben. Ergründen Sie die Eigenschaften, die einen Philosophen auszeichnen: unerschütterliche Überzeugung, unbändige Gedächtniskraft, natürliche Maßhaltung und eine tiefe Liebe zur Gerechtigkeit. Ist der Philosoph tatsächlich der gerechte Mensch, der fähig ist, eine Polis zum Heil zu führen? Platons Vision einer Philosophenherrschaft ist nicht ohne Kritik, denn die Idee des Guten selbst erscheint schwer fassbar. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch Platons "Politeia", auf der wir die ewige Frage nach der idealen Staatsführung neu beleuchten und die Herausforderungen und Chancen einer Herrschaft der Weisheit erkunden. Dieses Buch ist eine Einladung an alle, die sich nach einer gerechten und weisen Welt sehnen, und bietet Denkanstöße für aktuelle politische Debatten über Führung, Bildung und die Rolle der Philosophie in der Gesellschaft. Lassen Sie sich von Platons Ideen inspirieren und diskutieren Sie mit, ob seine Vision einer Philosophenherrschaft auch heute noch relevant ist. Ist es möglich, einen Staat auf der Grundlage von Vernunft und Weisheit zu führen, oder sind wir dazu verdammt, immer wieder den Fehlern der Vergangenheit zu erliegen? Die "Politeia" fordert uns heraus, über die Grundlagen unserer politischen Ordnung nachzudenken und nach Wegen zu suchen, wie wir eine bessere Zukunft gestalten können. Erforschen Sie mit uns die Tiefen der platonischen Philosophie und entdecken Sie die zeitlose Relevanz seiner Gedanken für unsere heutige Welt. Finden Sie heraus, ob Platons Philosophenkönige die Antwort auf die drängenden Probleme unserer Zeit sind.
1. Einleitung
Tag für Tag berichten Zeitungen von weiteren Korruptionsfällen, Sexskandalen und weiteren Vorkommnissen, in denen bis dahin ehrenwerte Staatsmänner verwickelt sind. Sind es denn Fehlentscheidungen, Mißtrauen und Habgier, die über das Schicksal eines Staates entscheiden? In solchen Tagen drängt sich immer häufiger die Frage auf, ob und welche Ausbildung ein Staatsmann besitzen soll, ja sogar welche Eigenschaften er für die „Kunst“ der Staatsführung mitzubringen hat. Sollte es eine bestimmte Gruppe von Menschen sein, die zuvor schon einen anderen Beruf ausgeübt hatten? Lehrer beispielsweise, sind Lehrer dazu geeignet, einen Staat zu lenken? Wenn nicht, wer dann? Warum muß es immer eine klassische Ausbildung sein wie Jura? Vielleicht sind sogar Sportler die eigentlichen Staatsmänner?!
Diese Fragen sind eigentlich nicht erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aktuell geworden. Ein Mann, der sich bereits vor Christi Geburt mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, ist Platon. Er fordert in seinem Werk „Politeia“ die Herrschaft der Philosophen über die Polis. In einer Zeit, in der die Philosophen noch als „Sternegucker“ bezeichnet wurden, war dieser Schritt sehr mutig aber auch erklärungsbedürftig. Wie Platon seine Forderung erklärt, sei nun im Folgenden dargestellt.
2. Die Bestimmung der Philosophen
Was sind also die Anlagen eines Philosophen? Platon beginnt seine Ausführungen mit einer allgemeinen Feststellung, daß ein Mensch, der nach etwas verlange, auch „alles was dazu gehört“ (Pol. 475b Meiner 1989) verlangen wird. Diese Feststellung dient ihm später, die Philosophen als Weisheitsliebende zu bezeichnen. Weisheitsliebend, da sie gierig nach der Wahrheit trachten und dabei von jeder Wissenschaft kosten. Die Philosophen streben demnach nach Wissen, nach Wahrheit und schließlich nach der Erkenntnis.
Hierbei unterscheidet Platon zwischen der Erkenntnis und dem Meinen. Die Erkenntnis ist die Erkenntnis vom Seienden. Sie beinhaltet die Wahrheit und läßt sich nicht vom Schein trügen. Hinter dem Vielen gibt es für Platon das Seiende selbst, daß Urbild, die Wahrheit.
Diese Ansicht Platons kommt besonders in den verschiedenen Gleichnissen zum tragen. Im Höhlengleichnis, in dem es dem Weisheitsliebenden gelingt, aus der Höhle, in der die Menschen gefangen sind, herauszusteigen und die Idee an sich zu schauen. Während der Erkennende das Seiende selbst sieht, sehen die Höhlenbewohner lediglich ein Abbild, eine Täuschung.
Doch auch im Sonnengleichnis und im Liniengleichnis ist die Kernaussage die Idee des Guten. Und somit macht Platon eine eindeutige Abgrenzung zwischen Meinen und Wissen. Während das Meinen in den Bereich der Abbildungen fällt und vergänglich ist, gehört das Wissen zu dem Bereich des Seienden und ist ewig. Einer der meint, bezieht sich lediglich auf Nachahmungen. Nur der Erkennende, der, der die Wahrheit bzw. die Idee geschaut hat, kann etwas wirklich wissen (Pol. 511bc).
Platon scheut auch keine Mühen, seine Ausführungen zu wiederholen und macht immer wieder deutlich, wer diejenigen sind, die das Höchste, die Wahrheit oder die Idee schauen können. Es sind natürlich die Philosophen. Diejenigen, die er vorher als weisheitsliebend betrachtet hatte.
Jedoch gibt es nicht nur den Bereich der Meinung und den Bereich der Erkenntnis, sondern auch den Bereich der Nichterkenntnis. Der Bereich der Erkenntnis steht hierbei dem Bereich der Nichterkenntnis gegenüber, während der Bereich der Meinung genau zwischen den beiden anderen liegt. Der Meinende scheint zwar mehr zu sehen als der Nichterkennende, aber immer noch weniger als der Erkennende. Der Nichterkennende ist somit dem Sein, wie dem Schein nach blind, während der Meinende lediglich dem Sein nach blind ist. Die Wahrheit liegt aber im Sein und nur derjenige, der das Sein erkennt, ist auch eine „wache“ Person (Pol. 476d).
Eine weitere wichtige Unterscheidung macht Platon zwischen dem wahren Philosophen und denen, die es gerne sein möchten. Damit holt er zu einem Rundumschlag gegen die Sophisten aus. Der wahre Philosoph muß abgegrenzt werden und muß sich von dem Rest unterscheiden. Er beginnt seine Erklärung, in dem er klar macht, daß die Erkenntnis nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden kann (Pol. 475 d). Der Schaulustige und der Hörbegierige sind also nicht in der Lage, die Idee zu schauen. Die Sophisten und Nichtphilosophen grenzt er auch durch ein Gleichnis aus (Schiffsgleichnis).
Auf dem dargestellten Schiff schaffen es lediglich die Stärksten oder Wortgewandtesten, die Führung des Schiffes zu übernehmen. Der wahre Gelehrte wird als Sternegucker bezeichnet und der Schiffsherr, der nicht die Fähigkeit besitzt, ein Schiff zu lenken, führt das Schiff direkt ins Unglück. Damit hat Platon auch gleich eine Analogie zu der Tragödie der Staatsführung gezogen. Der wahre
Philosoph, der als einzig fähiger, von der Gesellschaft verspotteter nicht seiner Bestimmung folgen kann, da immer die falschen und unfähigen an die Herrschaft gelangen, ist somit die tragische und verkannte Figur in einer Polis. Dies sei der Grund, warum die gerechte Polis bisher nicht umgesetzt wurde. Da die dem wahren Philosophen nachstrebende Seele immer wieder den Ruf der Philosophen schadet (Pol. 491ff), ist es dem wahren Philosophen auch nicht möglich, seiner Bestimmung nachzueifern.
Doch nicht nur die Fähigkeit, die Idee des Guten schauen zu können, muß der wahre Philosoph besitzen, sondern weitere Anlagen wie die eigene Überzeugung ihrer Tätigkeit. Mit ganzem Herzen muß ein Philosoph seinem Tun hinterherstreben und er sollte nicht eher ruhen, als bis er das Verlangte erreicht hat (Pol. 485b). Und diese Herzensüberzeugung benötigt der Philosoph, damit er in seinem Streben nach dem Sein keinen Irrungen nachgeht, sondern genau und überzeugt seinen Weg zur Erkenntnis verfolgt (Pol. 485c). Er muß also beständig in seinen Ausführungen sein und dabei die Augen für die Wahrheit offen halten, während er die Unwahrheit erkennen und mißachten soll. So führt Platon auch den Beweis, daß Philosophen nicht Geldgierig sind (Pol. 485e). Der Philosoph ist nämlich auf die Wahrheit konzentriert und hat somit nicht den Eifer, einer Gewinnsucht nachzugehen.
Eine weitere Eigenschaft des Philosophen ist die Gedächtniskraft. Vergeßliche Menschen sind nicht zum philosophieren geeignet. Der Philosoph muß zielstrebig einen langen Weg zur Wahrheit bestreiten und Vergeßlichkeit wären auf diesem beschwerlichen Weg ein Hindernis (Pol. 486d). Hier hält es Platon wie mit der Leichtigkeit des Lernens. Jemand, dem es sehr viel Mühe bereitet, etwas zu lernen, hat nach Platon nicht die Fähigkeit, die Idee zu schauen. Somit muß der Philosoph auch keine Mühen haben, etwas zu lernen und sich etwas zu merken.
Platon versucht mit diesen Eigenschaften systematisch einen Kreis um die wahren Philosophen zu ziehen. Indem er versucht, die Masse aus diesen Kreis auszuschließen kommt er immer näher an die wahre Bestimmung des Philosophen. Immer mehr Ausführungen über bestimmte Eigenschaften der Philosophen führt Platon an, so wie er von den Philosophen eine „von Natur maßvolle und Wohlgefallen erweckende Sinnesart“ fordert (Pol. 486d). All diese Ausführungen sollen dem Philosophen eine gerechte Veranlagung geben (Pol. 487a). Natürlich auch die weiteren Veranlagungen, wie die Tapferkeit etc. sind dem Philosophen eigen. Aber Platon´s Ziel ist es ja, die Philosophenherrschaft zu erklären. Wenn Sokrates nun in den ersten fünf Büchern eine gerechte Polis hat entstehen lassen und der zweite Teil der „Politeia“ sich zunächst mit der Philosophenherrschaft beschäftigt, liegt es auch dem Gedankengang nahe, zu einer gerechten Polis einen geeigneten Führer zu finden. Diese Vorstellung scheint nun Platon die Motivation zu geben, den wahren Philosophen als den gerechten Menschen darzustellen.
3. Forderung nach der Philosophenherrschaft
Platon erreicht nun das Stadium, in der er die Zusammenkunft zwischen den Bestimmungen der Philosophen und der Führung einer Polis zu machen hat. Wie bereits gesagt, hat Platon den wahren Philosophen als einen gerechten Menschen definiert. Die Forderung nach einer Philosophenherrschaft (Pol. 473d) bezieht sich jetzt aus der Bestimmung des Philosophen. Platon vergleicht die Nichtphilosophen mit Blinden und erklärt somit ihre Unfähigkeit bei der Führung der Polis, während der Philosoph die Wahrheit erkennt und somit das Schöne an sich, das Gerechte und das Gute erkennt und danach handeln kann (Pol. 484d). Der Philosoph ist somit dem Göttlichen näher und kann nach diesem göttlichen Vorbild handeln (Pol. 500e). Mit dem Schauen der Idee des Guten erhält der Philosoph einen Maßstab, mit dem das Wissen und das Handeln erst einen Sinn machen.
Platon erklärt die unzureichende Erfüllung seiner geforderten Polis und führt aus, daß erst durch die Philosophenherrschaft eine Polis heilen und zur Glückseligkeit gelangen kann (Pol.505a). Diejenigen, die er in seiner Philosophenbestimmung als die „Wachen“ erkannt hat, die scharfsinnig nach der Wahrheit und nach der Gerechtigkeit streben, von ihnen verlangt er nun die Herrschaft über die Polis (Pol. 484cd).
Erst durch die Bestimmung der Philosophen wurde klar, warum die Philosophen die Herrschaft übernehmen sollen. Platon war dabei bedacht, die Einheit zwischen der gerechten Polis und des gerechten Philosophen deutlich hervorzuheben. Der normale Mensch ist nahezu unfähig, mit all dem Vielen, wenn er nicht die Idee des Guten geschaut hat oder jemand da ist, der die Erkenntnis hat und ihn leitet (Pol. 505a). Dabei wurde auch auf ein gewisses Talent, das manche von Natur her besitzen hingewiesen. Es gibt solche, die von Natur begabt sind, sich mit Philosophie zu beschäftigen und in der Polis die führende Stellung einnehmen und solche, die dem Führenden folgen sollten. Diese Unterscheidung birgt eben auch die Begabung, welche die Philosophen von Natur aus besitzen und die sie dazu befähigt, die Wahrheit zu sehen und somit die Polis zu leiten.
4. Schlußgedanke
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung des Textes?
Die Einleitung befasst sich mit der Frage, welche Eigenschaften und welche Ausbildung ein Staatsmann besitzen sollte. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Fehlentscheidungen, Misstrauen und Habgier das Schicksal eines Staates bestimmen, und ob bestimmte Berufsgruppen, wie z.B. Lehrer, geeignet sind, einen Staat zu lenken. Die Einleitung verweist auf Platon und sein Werk "Politeia", in dem er die Herrschaft der Philosophen über die Polis fordert.
Wie bestimmt Platon die Philosophen?
Platon beschreibt die Philosophen als Weisheitsliebende, die gierig nach Wahrheit trachten und von jeder Wissenschaft kosten. Sie streben nach Wissen, Wahrheit und Erkenntnis. Platon unterscheidet zwischen Erkenntnis und Meinen, wobei die Erkenntnis die Erkenntnis vom Seienden ist, die Wahrheit beinhaltet, während das Meinen vergänglich ist und sich auf Abbildungen bezieht. Die Ideen des Guten sind entscheidend.
Was ist das Höhlengleichnis und wie passt es in Platons Philosophie?
Im Höhlengleichnis gelingt es dem Weisheitsliebenden, aus der Höhle, in der die Menschen gefangen sind, herauszusteigen und die Idee an sich zu schauen. Während der Erkennende das Seiende selbst sieht, sehen die Höhlenbewohner lediglich ein Abbild, eine Täuschung. Dies verdeutlicht Platons Unterscheidung zwischen Meinen und Wissen.
Wie unterscheidet Platon zwischen wahren Philosophen und solchen, die es gerne sein möchten?
Platon grenzt den wahren Philosophen von den Sophisten ab und betont, dass Erkenntnis nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden kann. Der wahre Gelehrte wird als "Sternegucker" bezeichnet, während unfähige Schiffsherren das Schiff ins Unglück führen. Der wahre Philosoph ist die tragische und verkannte Figur in einer Polis, da immer die Falschen an die Herrschaft gelangen.
Welche Eigenschaften muss ein wahrer Philosoph laut Platon besitzen?
Der Philosoph muss eine feste Überzeugung seiner Tätigkeit haben, mit ganzem Herzen seinem Tun nachstreben und beständig in seinen Ausführungen sein. Er muss die Augen für die Wahrheit offen halten, die Unwahrheit erkennen und missachten. Des Weiteren ist Gedächtniskraft wichtig, sowie eine maßvolle und Wohlgefallen erweckende Sinnesart.
Warum fordert Platon die Philosophenherrschaft?
Platon fordert die Philosophenherrschaft, weil er den wahren Philosophen als einen gerechten Menschen definiert. Der Philosoph erkennt die Wahrheit und kann somit das Schöne, Gerechte und Gute erkennen und danach handeln. Er ist dem Göttlichen näher und kann nach diesem Vorbild handeln. Erst durch die Philosophenherrschaft kann eine Polis heilen und zur Glückseligkeit gelangen.
Was ist Platons Schlussgedanke zur Philosophenherrschaft?
Platons Vorstellung der Philosophenherrschaft beruht auf der Veranlagung des Philosophen selbst. Eine gerechte Polis muss von einem gerechten Menschen geleitet werden, und nach Platons Ausführungen ist der Philosoph eben dieser gerechte Mensch. Der Schlussgedanke räumt ein, dass die Argumente sehr weit hergeholt klingen und die "Idee des Guten" alles andere als eine stabile Theorie sei.
- Quote paper
- Markus Hofmann (Author), 2000, Wie begründet Platon die Philosophenherrschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98690