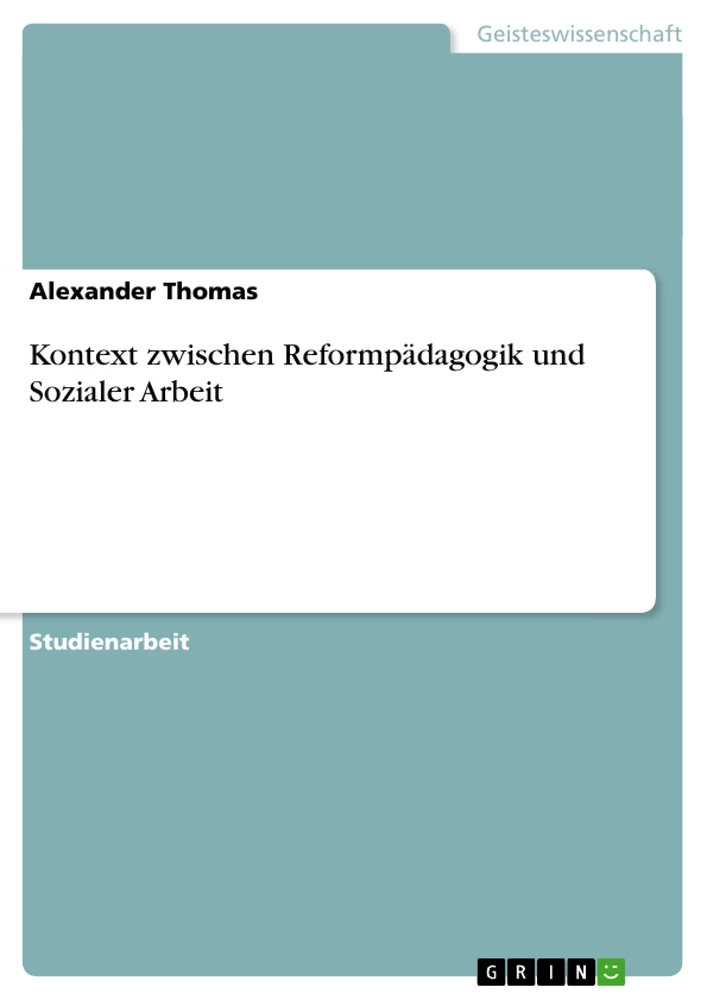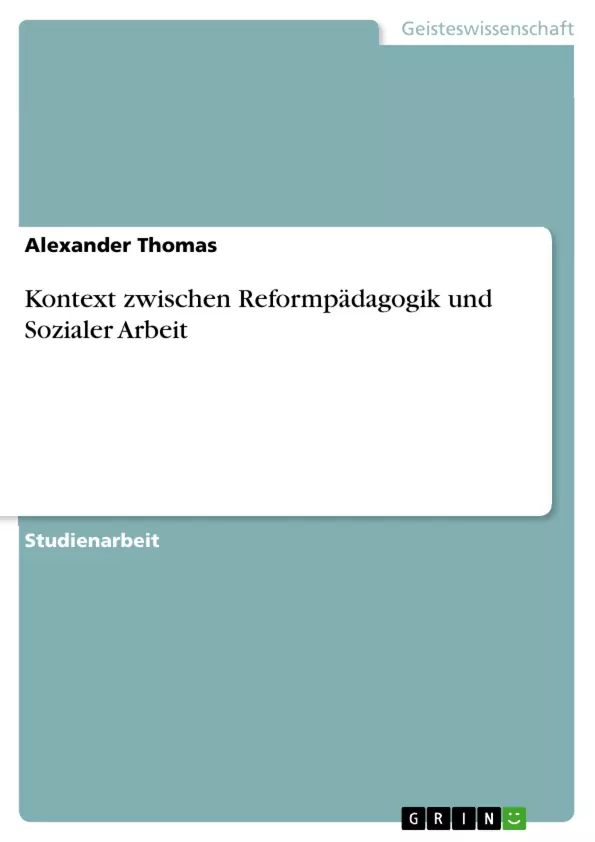In einer Zeit des Umbruchs, geprägt von Industrialisierung und sozialen Spannungen, erblühte die Reformpädagogik als eine revolutionäre Bewegung, die das Kind ins Zentrum des erzieherischen Denkens rückte. Diese tiefgreifende Analyse beleuchtet die vielschichtigen Einflüsse, die diese Bewegung formten, von der Bildungskritik eines Nietzsche, der die Verherrlichung der Vergangenheit anprangerte, bis hin zu den Forderungen der aufkeimenden Frauenbewegung nach Bildungschancen für Mädchen und Frauen. Im Fokus steht die Sozialpädagogik, verstanden als integraler Bestandteil der Reformpädagogik, die sich den drängenden sozialen Fragen der Zeit widmete. Die Arbeit untersucht die Entwicklung sozialpädagogischer Konzepte vor und nach dem Ersten Weltkrieg, wobei zentrale Figuren wie Natorp und Nohl gewürdigt werden, die mit ihren Ideen die Gemeinschaft und die soziale Verantwortung in den Mittelpunkt stellten. Einblicke in das hamburgische Jugendgefängnis Hahnhöfersand illustrieren beispielhaft, wie reformpädagogische Ansätze im Jugendstrafvollzug umgesetzt wurden, wobei die Förderung von Selbstdisziplin und die Vorbereitung auf ein Leben nach der Haft im Vordergrund standen. Die Studie verfolgt die wechselseitige Beeinflussung von Sozialpädagogik und Sozialarbeit und plädiert für eine ganzheitliche Sichtweise, die den Menschen in seinem sozialen Gefüge erfasst und die Bedeutung des ökosozialen Paradigmas für die Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit hervorhebt. Diese Auseinandersetzung mit den historischen Wurzeln und den konzeptionellen Grundlagen der Reformpädagogik bietet wertvolle Erkenntnisse für das Verständnis aktueller Herausforderungen und ermöglicht eine reflektierte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen sozialpädagogischen Handelns in einer sich wandelnden Gesellschaft. Tauchen Sie ein in die Ideale einer Bewegung, die bis heute nachwirkt und die Frage nach einer gerechteren und menschenwürdigeren Erziehung immer wieder neu aufwirft. Entdecken Sie die verborgenen Verbindungen zwischen sozialer Not, pädagogischen Innovationen und dem unermüdlichen Streben nach einer besseren Zukunft für Kinder und Jugendliche. Erfahren Sie, wie die Reformpädagogik die Sozialarbeit nachhaltig prägte und welche Lehren wir aus den historischen Experimenten für die Gestaltung einer zeitgemäßen Sozialpädagogik ziehen können. Eine fesselnde Reise durch die Geschichte der Pädagogik, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet.
I Einleitende Gedanken
Mit meiner Studienarbeit möchte ich mich mit dem Einfluss der Reformpädagogischen Bewegung auf die Sozialpädagogik beschäftigen. Üblicherweise wird der Anfang der Bewegung auf die Herausgabe des Buches von Ellen Key ,,Das Jahrhundert des Kindes" im Jahre 1900 datiert (vgl.: Scheibe, 1969, 3).Die Reformbewegung gilt als die ,,Bewegung vom Kinde aus", was schon die vordergründige des pädagogischen Ausgangspunktes darstellt. ,,Wie bis dahin die Gesellschaft, die Erwachsenen, die Sachwelt, die objektiven Werte, die Bildungsgehalte und Ziele die Pädagogik bestimmt hatten, so sollte nun der Heranwachsende bestimmend sein" (Scheibe, a.a.O., 57).
Klaus Plake spricht in seinem Buch Reformpädagogik von einem Paradigmenwechsel, ,,eine dramatische Richtungsänderung der Gedankenentwicklung" (Plake, 1991, 9), die ,,sich in der Zeit um 1890 ereignet" (Plake, a.a.O.). Vor dieser Zeit fand das Kind geringe Beachtung und galt als kleiner Erwachsener. Rousseau hatte zwar schon von der Phase der Kindheit und den alterstypischen Merkmalen gesprochen und Pestalozzi, Fröbel und andere haben diese Gedanken weitergeführt, es kam aber nicht zu einem Gesamtgesellschaftlichen umdenken. (vgl.: Scheibe, a.a.O., 58)
Weiterhin ist die Industrialisierung, dis sich zum Ende des 19. Jahrhunderts schon allgemein durchgesetzt hatte und ,,in eine Periode der allgemeinen Bedürfnisbefriedigung eintritt"(Plake, a.a.O.,11), ein wichtiger Begleitumstand für diese Bewegung. Klaus Plake geht davon aus, dass diese entstehende Industriegesellschaft die Vorraussetzung ist, damit die Reformpädagogik auf Resonanz stößt und es nicht wirklich neue Ideen sind, da eine andere Sicht auf das Kind als passender für die ,,Anforderungen der Zukunft empfunden werden" (Plake,a.a.O.,15). So begründet Plake die Umstände, dass es zu dem oben genannten Paradigmenwechsel kommen konnte, da die Ideen ja wie oben beschrieben schon da waren. (vgl.: Plake, a.a.O., 15ff) Der vorhergehenden Geringachtung des Kindes wurde eine Achtung des Kindes als Individuum entgegengesetzt. Das Kind wurde nicht mehr als böse angesehen sondern als gut und beschützenswert. (vgl.: Scheibe, a.a.O., 57-60).
Den Historischen Kontext möchte ich im ersten Kapitel aufzeigen um auf die ,,Wurzeln" (Dietrich, Geschichte der Pädagogik, 188), bzw. die Wechselwirkungen der Reformpädagogik mit der sozialen Bewegung, der Jugend- und Frauenbewegung (Scheibe a.a.O.,25) näher einzugehen.
Im zweiten Kapitel möchte ich näher auf die Sozialpädagogische Bewegung eingehen, wobei ich die sozialpädagogische Bewegung als Teil der Reformpädagogischen Bewegung sehe. In dieser Sichtweise beziehe ich mich auf das Buch von Wolfgang Scheibe, der die Sozialpädagogische Bewegung als eine eigene Richtung der Reformpädagogischen Bewegung sieht.
Zunächst möchte ich hier auf die Anfänge der Bewegung bis in zum ersten Weltkrieg eingehen. Danach möchte ich von der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik eingehen und im Anschluss daran möchte ich etwas zu den Reformen der Jugendführsorge berichten.
Im 3. Kapitel möchte ich als Beispiel näher auf das hamburgische Jugendgefängnis Hahnhöfersand eingehen um Beispielhaft zu zeigen, wie sich die Reformpädagogik durch praktische Versuche, auch auf den Jugendstrafvollzug auswirkte.
II Entwicklung und Konzepte der Reformpädagogik
1. Historischer Kontext
a) Bildungskritik
Durch die sich ausbreitende Technisierung, Industrialisierung und Verstädterung veränderte sich die Welt entscheidend. Die Bevölkerung vermehrte sich rapide, es gab immer mehr Großstädte. Die Arbeiterfamilien fristeten ein hartes Dasein. ,,Auf diesem Boden entstand die Kulturkritik", die sich gegen den naiven Fortschrittsglauben wandte und ,,den Weg für Schöpfungen des Innenlebens frei" machte (vgl.. Dietrich, a.a.O., 188/189) Die Bildungskritik war ein Teil der Kulturkritik im ausgehenden 19. Jahrhundert und wurde ,,getragen" von Julius Langbehn, Friedrich Nietzsche und Paul de Legarde (vgl.: Scheibe a.a.O.,5).
Sie bildete den Untergrund der gesamten späteren pädagogischen Bewegung ,, (die) bereits spezielle Akzente einer Bildungskritik enthielt" (Scheibe,a.a.O.,5).
Langbehn sah einen Verfall des geistigen Lebens des deutschen Volkes und nannte die Wissenschaft als Ursache. Der Wissenschaft stellte er die Kunst gegenüber und meinte, dass diese die Herrschaft des deutschen Geisteslebens wiedergewinnen sollte. Weiterhin stellte er dem in der Wissenschaft den Überhang bildenden Verstand das Gefühl als Gegensatz gegenüber. Im Verstand sah er eine Entfernung von der Wirklichkeit. Darüber hinaus plädierte er für eine Volksbildung die von der Kunst bestärkt wird (vgl.: Scheibe,a.a.O.,6-12).
Nietzsche richtet sich in seiner Kritik gegen eine ,,Bildung mit gegenwartsfernen Inhalten" durch ein Übermaß an Geschichte (vgl.: Scheibe,a.a.O.,13f).
Legarde richtet sich auch gegen die ,,Verherrlichung der Vergangenheit" (Scheibe, a.a.O.,21). Weiterhin ist er der Meinung, den Vorwurf der Erwachsen gegen die Kinder entkräftet er durch die Aussage, dass der Jugend deshalb der Idealismus fehle, weil die Erwachsenen einem fragwürdigen Idealismus huldigen (vgl.: Scheibe,a.a.O.,20-21).
b) Soziale Bewegung
Die Zeit vor dem ersten Weltkrieg war an vielen Stellen gekennzeichnet durch den Willen zur Befreiung von Umgangsformen, die nicht mehr den Umständen der Zeit gerecht wurden. In dieser Zeit entstanden die Reformhäuser, die Kleidungsreform und überhaupt die Lebensreform (vgl.: Scheibe, a.a.O.,28).
Ausgangspunkt für die soziale Bewegung ist der Strukturwandel ,,von der Tradition des Mittelalters" hin zur Industrialisierung. Mit dem technischen Fortschritt kam es zu einer ,,ungeheuren" Vermehrung der Bevölkerung, die zur Landflucht und Verstädterung führte. Der sich bildende Stand der Arbeiter entwickelte ein eigens Bewusstsein und führte so zur Arbeiterbewegung. Durch die sich entwickelnde Industrie entstanden die Unternehmer die Kapital anhäuften unabhängig von ,,Thron und Altar" (vgl.: Scheibe, a.a.O.28-30). Daraus
entwickelte sich eine unbeschreibliche soziale Not, ,,von der am stärksten die Arbeiterklasse betroffen war" (Scheibe,a.a.O.,30). Es gab deshalb lange Arbeitszeiten, die Frauen mussten zusätzlich arbeiten und Kinderarbeit war ebenfalls verbreitet(vgl.: Scheibe, a.a.O.,30).Es gab ein Überangebot an Arbeitskräften, was sehr niedrige Löhne zur Folge hatte. Dies führte zu einer hungernden Industriearbeiterschaft und zu rasch steigendem Wohlstand einer kleinen Schicht von Kapitaleignern (vgl.: Marburger,1981,19). Es ergab sich das Problem der sozialen Verwahrlosung, was politisch als die soziale Frage bezeichnet wurde. Daraufhin begannen sich die Arbeiter an zu organisieren in einer eigenständigen Arbeiterpartei. Da die Bewegung immer mehr Anhänger fand wurde die Organisation der Sozialdemokraten durch die Sozialistengesetze 1878 verboten und erst 1890 wieder aufgehoben. Die andere Antwort des Staates waren das Krankenversicherungsgesetz (1883), das Unfallversicherungsgesetz (1884 und das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz (1889), all dies konnte jedoch nicht verhindern, dass die Anhängerschaft der Sozialdemokraten wuchs (vgl.: Marburger,a.a.O.,22- 23). Zwischen 1895 und dem ersten Weltkrieg gab es zwar einen großen wirtschaftlichen Aufschwung, dementsprechend stiegen auch die Löhne etwas an, jedoch war die Arbeiterschaft weiterhin gesellschaftlich und politisch Diskriminiert und weitgehend Rechtlos und Abhängig im Arbeitsprozess. (vgl.: Marburger, a.a.O.,24-25)
,,Zugleich wurde die soziale Frage auch unter einem erzieherischen Aspekt gesehen" (Scheibe,a.a.O.,31).
Hier waren vorwiegend die Kirchen, die Träger einer sozialen, pädagogischen Hilfe wurden. ,,Johann Hinrich Wichern (1808-1881) hatte sie ins Leben gerufen mit dem Ziel, das Volk mit dem Gedanken der sozialen Verantwortung zu durchdringen (Scheibe,a.a.O.,31). Sein Hauptaugenmerk galt der Jugenderziehung, diese ging er durch die Gründung des ,,Rauen Hauses" in Hamburg praktisch an.
Auf katholischer Seite war Bischoff Freiherr von Keller (1811-1872) Gründer einer christlichsozialen Bewegung (vgl.:Scheibe,a.a.O.,31)
c) Frauenbewegung
Die Wurzeln der Frauenbewegung liegen in der Französischen Revolution. In Deutschland beginnt sie aber erst mit der ArbeiterInnenbewegung 1835. Später teilt sich die Frauenbewegung in eine bürgerliche und eine proletarische.
Die Ziele der Frauenbewegung waren erstens, dass Frauen auch Berufe erlernen konnten, was Ihnen bisher mit Ausnahme des Lehrerinnenberufs, verwehrt war. Zweitens sollte den Frauen das Wahlrecht und der Zugang zu öffentlichen Ämtern erschlossen werden. Drittens wollten die Frauen auch die Möglichkeit an Universitäten studieren zu können, was voraussetzte, dass ein höheres Schulwesen für Mädchen erschlossen werden musste (vgl.:Scheibe,a.a.O.,32-33). Das Frauenstudium setzte sich gegen allen Wiederstand der Männer durch. Die Frauenbewegung wirkte sich am meisten auf die Sozialpädagogik aus (vgl.:Scheibe,a.a.O.,36- 37). Alice Salomon ist Mitbegründerin eines Jahreskurses zur beruflichen Ausbildung in der Wohlfahrtspflege (vgl.: www.asfh-berlin.de/,Link-Geschichte der ASFH, Berlin 21.07.1999), woraus sich die noch heute Bestehende Fachhochschule entwickelte. Alice Salomon beschäftigte sich stark mit der methodischen Frage der Sozialen Arbeit und war so maßgeblich daran beteiligt ein Selbstverständnis der Sozialen Arbeit zu begründen. Diese Arbeit wurde vorwiegend von Frauen geleistet.
Das Leitbild der Frauenbewegung ging allerdings über die Emanzipationsbewegung hinaus. Die Verschiedenartigkeit der Geschlechter sollte nicht als Konkurrenz sondern als Bereicherung der Kulturarbeit gesehen werden (vgl.: Scheibe, a.a.O., 34-35).
d) Jugendbewegung
Die Jugendbewegung entstand in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch Wanderungen von Gymnasiasten - sie zählte somit zu der bürgerlichen Bewegung. Es wurden unter anderem der Wandervogel und viele andere Vereinigungen gegründet. Zu den Wesenszügen möchte ich hier einen Teil der Meißner-Formel zitieren: ,,Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein" (Scheibe, a.a.O.: 40). Es ging aber auch um Selbstgestaltung, Unabhängigkeit und Jugend als Abgrenzung von Erwachsen sein, das heißt Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen. Außerdem ging es um Gemeinschaftserleben, und um Naturerleben. Pädagogisch wichtig war auch die Erziehung in Gemeinschaft durch Selbsterziehung (vgl.: Scheibe, a.a.O.,37-50).
e) Psychologie
Im letzten Drittel des letzten Jahrhunderts beginnt mit Wilhelm Wundt die Psychologie als Erfahrungswissenschaft. Dadurch begannen auch Beobachtungen von Kindern und Jugendlichen und es wurde klar, dass auch Kinder ,,Willensprozesse, schöpferische Akte produktive Gestaltungsprozesse usw. vorhanden sind. Dies hatte eine veränderte Einstellung den Kindern gegenüber zur Folge. Deshalb findet man auch in der Psychologie Wurzeln der Reformpädagogik (vgl.: Dietrich, Geschichte der Pädagogik, 200/201).
2. Sozialpädagogische Bewegung
a) Vor dem ersten Weltkrieg
Helga Marburger bezeichnet Natorp als den hervorragendsten Vertreter der Sozialpädagogik in der Zeit um die Jahrhundertwende bis vor dem ersten Weltkrieg (vgl.: Marburger a.a.O., 26). In dieser innenpolitisch angespannten Lage (siehe ,,soziale Bewegung"), setzte eine breite sozialpädagogische Diskussion ein, die sich mit der sozialen Frage beschäftigte. Es wurde davon ausgegangen, dass die Individualpädagogik seit der Aufklärung die Ursache für die gesellschaftliche Situation ist. (vgl.: Marburger, a.a.O., 24-26).
Zunächst möchte ich darauf eingehen, wie Natorp den Begriff Sozialpädagogik versteht. ,, Der Begriff Sozialpädagogik besagt also die grundsätzliche Anerkennung, dass ebenso die Erziehung des Individuums in jeder wesentlichen Richtung sozial bedingt sei," (Natorp, Sozialpädagogik, 98). Der Begriff soll also vordergründig auf die soziale Bedingtheit der Erziehung hinweisen. Es ist also nicht ein ,,abtrennbarer Teil der Erziehungslehre","sondern die konkrete Fassung der Aufgabe der Pädagogik überhaupt" (Natorp, a.a.O., 98). So wird die Sozialpädagogik der Pädagogik im gewissen Sinne gleichgesetzt. Natorp möchte der Individualpädagogik diese Sozialpädagogik entgegensetzten und sie nicht als Bestandteil der Pädagogik verstanden wissen. Diese Sichtweise wurde allerdings nicht von allen Pädagogen der damaligen Zeit geteilt. (vgl.: Marburger, a.a.O., 33-37). Für die Erziehung des Menschen ist für Natorp die Gemeinschaft fundamental. ,,Der Mensch wird zum Menschen allein durch menschliche Gemeinschaft." (Natorp, a.a.O., 90) Ohne Gemeinschaft würde der Mensch zum ,,Tier herabsinken" und Erziehung gäbe es gar nicht ohne Gemeinschaft (Natorp, vgl. a.a.O., 90). Natorp wendet sich aber nicht gegen die Individualität des einzelnen, ,,aber dieser (Individualismus d.V.) schließt Gemeinschaft nicht aus, sondern führt zwingend zu ihr hin" (Natorp, a.a.O., S. 92). Unter Gemeinschaft versteht Natorp: ,,dass man einen geistigen besitz gemein hat und zu gleichen Rechten genießt" (Natorp a.a.O., 95). Es geht also um Gemeischaft unter gleichen und nicht darum, dass sich der Einzelne ,,unter dem Einfluß des Andern steht. (Natorp, a.a.O., 95)
Diese Sozialpädagogik entstand um dem Egoismus dieser Zeit etwas entgegen zu setzen. Die Bildung sollte demokratisiert werden und alle Schichten erreichen (Marburger, a.a.O., 37-38). Hier sei darauf hingewiesen, das der Begriff Sozialpädagogik schon von Diesterweg benutzt wurde. Auch ihm ging es dabei um die Lösung der ,,sozialen Frage" durch eine geregelte Bildung für alle um die Gefahr der ,,Pöbelherrschaft" abzuwenden. Auch den Pädagogen um die Jahrhundertwende ging es letztendlich darum die drohende Gefahr der Revolution vom Bürgertum abzuwenden. Die Sozialpädagogische Forderung nach Bildung für die unteren Schichten, entsprang laut Marburger mehr dem ,,Ausdruck des bürgerlichen Interesses an der Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsordnung" (Marburger, a.a.O., 42; vgl.: Marburger, a.a.O., 39-45). Auch Natorp geht es letztendlich nur darum (vgl.: Natorp, a.a.O., 366), wenn gleich er von einem sehr Idealistischen Bild der Gemeinschaft ausgeht, die nicht der damaligen gesellschaftlichen Realität entsprechen (vgl.: Marburger, a.a.O.44). Hier möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass Natorp nach dem zweiten Weltkrieg das Buch ,,Sozialidealismus" herausgebracht hat, in dem er wie Niemeyer schreibt mit dem Ersten Weltkrieg und dem Kaiserreich abrechnet (vgl.: Niemeyer, Klassiker der Sozialpädagogik, 89). Natorp beschreibt Idealismus als radikaler Umkehr und Erneuerung aus innerstem Lebensquell" (Natorp, Sozialidealismus, III). Seiner Meinung nach muss ,,der Idealismus sozial, der Sozialismus ideal werden" (Natorp, a.a.O., IV). Als Lösung all der von ihm dargelegten Missstände im Kaiserreich schlägt er folgendes vor. Die soziale Erziehung (,,als Erziehung durch Gemeinschaft zur Gemeinschaft") soll nicht an den Fortschritt gebunden sein. Die Erziehung muss führend sein ,,Staat und Wirtschaft folgend", ,,Wirtschaft und Staat sind ihrer Natur nach nur dienend" (vgl.: Natorp, a.a.O., 139). Der Staat müsse ,,durch umfassende allgemeine Organisation sozialer Erziehung dafür Sorge tragen", dass jeder mit Kopf, Herz und Hand bei seiner Arbeit sein kann. (vgl.: Natorp, a.a.O., 53)
b) Nach dem ersten Weltkrieg
Herman Nohl (1879-1960) wurde 1919 als (außerordentlicher) Professor an die Göttinger Universität gerufen, die 1922 in ein Ordinariat (auch für Pädagogik) umgewandelt wurde. Durch seine Kriegserfahrungen, das sozialpädagogische Engagement seiner (Stief-) Schwestern und durch den Eintritt Curt Bondys und Walter Hermanns in sein Seminar, wendet sich Nohl der Pädagogik und Sozialpädagogik zu. (vgl.: Niemeyer, Klassiker der Sozialpädagogik, 125) Niemeyer weist in seinem Buch auf Fragwürdigkeiten Nohls unter anderem auch in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus hin (vgl.: Niemmeyer, a.a.O., 127), dies soll hier aber nur erwähnt sein, ich möchte aber nicht näher darauf eingehen, da es ein in sich eigenes Thema wäre. Nohl war Hochschullehrer für Philosophie und die ,,Praxis" wandte sich an Ihn umbat um eine klärende Stellungnahme zu drängenden Fragen der Jugendwohlfahrt, was ,,ihn dann zu der Konzeption einer sozialpädagogischen Theorie führte (vgl.: Marburger a.a.O. 58). Zur Sozialpädagogik hat Nohl Vorträge gehalten, wobei ich hier als Beispiel den Vortrag ,,Die geistigen Energien der Jugendwohlfahrtsarbeit" vorstellen möchte. Nohl geht davon aus, dass der sozialen Not die während der Industrielen Revolution entstanden ist, als erste die geistige Energie entgegen trat, die Arbeiterbewegung.(vgl.: Thole/Galuske/Gängler, KlassikerInnen der Sozialen Arbeit, 121-122). Dieser Bewegung tritt als zweite geistige Energie die innere Mission entgegen, begründet von Wichern. Wichern möchte mit freier Liebestätigkeit den Menschen helfen. Nohl sieht bei Wichern eine Einseitigkeit durch den er den Anschluss an die humanistische Pädagogik verliert (vgl.: Thole/Galuske/Gängler, a.a.O., 122-124). Als dritte geistige Energie bezeichnet Nohl die Frauenbewegung, (einer Gemeinschaftkraft, der geistigen Mütterlichkeit, mit Rücksicht auf jeden, der Achtung vor dem Individuum) (vgl.: Thole/Galuske/Gängler, a.a.O., 124). Als vierte geistige Bewegung sieht Nohl, die sozialpolitische. Wieder eine mit neuem Gemeinschaftsbewusstsein, der staatlichen Verbundenheit (vgl.: Thole/Galuske/Gängler, a.a.O., 125). Nohl sah nun diese vier Energien verbunden mit der bürgerlichen Kultur (vgl.: Thole/Galuske/Gängler, a.a.O., 125). Erst die ,,Gemeinschaftskraft der jugendlichen Verbindungen" stellte sich gegen diese in ,,Genuss und Egoismus" versunkenen Welt (vgl.: Thole/Galuske/Gängler, a.a.O., 126). ,,In die Jugendwohlfahrtsarbeit gehen nun alle diese Bewegungen ein, die sozialistische, die innere Mission, die Frauenbewegung, die Sozialpolitik, die Jugendbewegung und die pädagogische Bewegung (vgl.: Thole/Galuske/Gängler, a.a.O., 126). Nohl geht es durch diese Arbeit vordergründig um die Höherbildung des Menschen (vgl.: Thole/Galuske/Gängler, a.a.O., 127). Zum Abschluss möchte ich ein Zitat aus dem Vortrag von Nohl bringen, der denke ich eine ganz grundlegende herangehensweise darstellt. ,,Aber wo ich mich pädagogisch um den anderen bemühe, muss er wissen: man will dich nicht werben für eine Partei, für eine Kirche, auch nicht für den Staat, sondern - der Unterschied ist so gering, wie wenn man die Hand umdreht, und ist doch entscheidend - diese Hilfe gilt zunächst und vor allem dir, deinem einsamen Ich, deinem verschütteten, hilferufenden Menschentum (vgl.: Thole/Galuske/ Gängler, a.a.O., 128).
Die Sozialpädagogik nach dem zweiten Weltkrieg, bezeichnet nach Gertrud Bäumer ,,alles was Erziehung, aber nicht Schule und nicht Familie ist" (Nohl/Pallat, Handbuch der Pädagogik Band 5, 3). Hier wird davon ausgegangen, dass in diesem Sinne sozialpädagogisches Handeln nur dann notwendig ist, wenn Schule und Familie nicht ausreichen oder versagen. Es ist also Erziehungsführsorge als ,,Nothilfe" (vgl.: Nohl/Pallat, a.a.O., 3). Daraus entwickelte sich allerdings ein ,,neues System mit einem neuen Träger, dem normalerweise - und nicht nur ausnahmsweise - gewisse Leistungen in dem Ganzen der von Familie, Gesellschaft und Staat getragenen Bildung des Nachwuchses zufielen" (Nohl/Pallat, a.a.O.: S.4). Die Ursache hier führ liegt in dem geänderten Wirtschaftssystem, wodurch sich das Familienleben änderte, durch den Kindergarten und Hort wurde versucht die Unzulänglichkeiten auszugleichen (vgl.: Nohl/Pallat, a.a.O., 14). Marburger macht hier auf die Parallelen zu der Entwicklung des Schulsystems, das auch zuerst Nothilfecharakter hatte und sich daraus zu einem eigenständigen Erziehungssystem entwickelte (vgl.: Marburger, a.a.O., 68-69).
C) Auswirkungen auf die Jugendfürsorge
Die Jugendführsorge war zu Beginn des 20. Jahrhunderts kein einheitliches System sondern es bestand aus vielen Einzelaktivitäten die nicht koordiniert wurden. Dies wurde durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) verbessert (vgl.: Marburger, a.a.O. 56-57). ,,Neben der gesetzlichen Vereinheitlichung aller Leistungen der öffentliche und privaten Jugendführsorge wurde durch das RJWG erstmalig ein öffentlich-rechtlicher Erziehungsanspruch geschaffen (Marburger, a.a.O., 57). Das Gesetz ist am 1. April 1924 in Kraft getreten (vgl.: Nohl/Pallat, Handbuch der Pädagogik, Band 5, 18). Die schon bestehenden Aufgaben der Jugendwohlfahrtspflege werden auf eine Behörde, das Jugendamt übertragen (vgl.: 18). Die theoretische Grundlage dieses Gesetzes ging aus der Reformbewegung hervor (vgl.: Marburger, a.a.O., 57 und Scheibe, a.a.O., 324). Diese Neuorganisation brachte ,,Abhilfe gegen die(se) rechtliche Zersplitterung im Bereich der Kinder- und Jugendführsorge (Marburger, a.a.O., 57). Das Jugendamt erfasste nicht nur die öffentliche Aufgaben sondern auch die private Tätigkeit der Jugendwohlfahrtspflege. Bei den Aufgaben werden die Jugendpflege und die Jugendfürsorge unterschieden. Unter Jugendpflege werden alle ,,Maßnahmen für die normale Jugend" verstanden wie z.B. Kindergärten, Grippen usw. (Hilfe bei den Aufgaben der Familie). Mit Jugendfürsorge werden Maßnahmen zusammengefasst, die bei ,,nicht normalen" Verhältnissen ,,vorbeugend, schützend oder heilend eintreten sollen" (vgl.: Nohl/Pallat, a.a.O., 18f). Eine andere Neuerung dieser Zeit ist das erste Jugendgerichtsgesetz (JGG), das am 1. Juli 1923 in Kraft getreten ist (Hasenclever, Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung seit 1900, 88). Dieses Gesetz war das Ergebnis einer Zusammen arbeit von Juristen und Sozialpädagogen und ,,führte zu einer neuen Beziehung des Strafrechts zur Erziehung" (vgl.: Scheibe, a.a.O., 342). ,,Das Alter der Strafmündigkeit wurde auf 14 Jahre festgesetzt" (Scheibe, a.a.O.,343). Es sollten, wenn möglich keine Strafen verhängt werden, wenn ,,Erziehungsmaßregeln" ausreichend erschienen. Für die Jugendlichen war nun auch ein eigenständiges Gericht zuständig, das Jugendgericht. Hier sollte der Jugendrichter auch eine Pädagogische Grundeinstellung haben (vgl.: Scheibe, a.a.O., 343). Wichtig für diese Entwicklung war die Erkenntnis, dass Straftaten mit einem Erziehungsdefizit zu tun haben können, und damit Erziehungsmaßnahmen sinnvoller sein können (vgl.: Herrmann, a.a.O., 24/25). Über die Jugendgerichtshilfe sind die Jugendämter in die Verfahren miteingezogen, wobei dies durch eine Kompromisslösung und §3 Nr.5 RJWG (Befreiung von der Jugendgerichtshilfe) eingeschränkt wird (Hasenclever, a.a.O., 90/91).
d) Synthese - Auswirkungen auf die ,,Soziale Arbeit"
Durch den Einfluss der Sozialpädagogischen Bewegung wurde die Sozialarbeit sozusagen pädagogisiert. Umgekehrt hatte die Sozialarbeit auch Einfluss auf die Sozialpädagogik, wobei sich die Dominanz abgewechselt hat. Heute liegt die Begriffliche Dominanz wohl bei der Sozialarbeit, allerdings geht ,,ein Vorteil für die einen zu Lasten der anderen". Albert Mühlum schlägt hier die pragmatische Lösung vor sich auf ,,Soziale Arbeit" zu einigen in dem beide Begriffe aufgehen um aus diesem Dilemma des ,,Gegeneinander" zu kommen (vgl.: Mühlum, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 2). Das heißt die Sozialpädagogik und die Sozialarbeit soll zusammen gefasst werden und eine eigenständige wissenschaftlich fundierte Disziplin mit eigener Theoriebildung zu werden (vgl.: Mühlum, a.a.O., 213). In der Zeit der Reformbewegung wurde klar, dass der Mensch in seinem sozialen Gefüge gesehen werden muss, Alice Salomon sprach deshalb von ,,Symptomen", die ein Mensch in sozialen Missständen entwickelt, welche von Krankheit unterschieden werden müssen (vgl.: Mühlum u.a., Umwelt Lebenswelt, 178). Dies zeigt meines Erachtens den Einfluss der Sozialpädagogik (,,vom Kinde aus" - ,,vom Menschen aus") auf die ,,Soziale Arbeit". Auch hier ist es meiner Meinung nach so, wie in der Methodengeschichte der Sozialarbeit, dass sich z.B. die Methoden Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit im einzelnen entwickelt haben und heute die drei Säulen der ,,Sozialen Arbeit" sind. Hier Das heißt, dass jede Methodenentwicklung für sich wichtig ist und im jeweiligen historischen Kontext gesehen werden muss und dies dann in die gesamte ,,Soziale Arbeit" bereichernd einfließt. Nun ist auch so, dass sich immer mehr eine ganzheitliche Sichtweise durchsetzt. Zuerst die systemisch holistische Denkweise, in dessen Tradition sich das Ökosoziale Paradigma entwickelte, welches durch die konsequente Einbeziehung von Raum und Natur über diese Ansätze hinausgeht. (vgl.: Mühlum u.a., a.a.O., 233). Von daher ist auch Mühlums Vorschlag um aus dem Dilemma zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik heraus zu kommen verständlich, denn sich daran weiter festzuklammern behindert die Entwicklung der ,,Sozialen Arbeit" zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Kategorie. Später schreibt Mühlum, dass in den 90er Jahren das ökosoziale Paradigma prägende Kraft gewinnt - die Beziehung von Ökonomie, Ökologie und Soziales und dies als ganzheitliches Denken Auswirkungen auf die ,,Soziale Arbeit" hat (Mühlum, a.a.O., 205-209). Ich denke, dass für diese Weiterentwicklung die Sozialpädagogische Bewegung wichtig war.
3. Beispiel: Das hamburgische Jugendgefängnis Hahnhöfersand
In der Zeit der Reformbewegung hatte die Sozialpädagogische Bewegung auch Auswirkungen auf die praktische Arbeit. Es wurde versucht die Theorien in der Praxis umzusetzen. Ein Beispiel dafür ist das nun folgende.
Walter Herrmann und Kurt Bondy haben von November 1921 bis Juli 1922 im Jugendgefängnis Hahnhöfersand als Hilfsaufseher gearbeitet. Das Zustandekommen wurde von Prof. Dr. Liepmann unterstützt (vgl.: Herrmann, das Hamb. Jugendg. Hahnhöfersand, 33,39,40). Ebenso wurde das Zustandekommen von dem Leiter Hahnhöfersand und dem Direkter der der Hamburger Gefängnisse unterstützt (vgl.:, Herrmann, a.a.O., 11). Das Gefängnis liegt auf einer Elbinsel unterhalb Hamburgs. Die Gefangenen waren 15-22 Jahre alt (vgl, Herrmann, a.a.O., 42-48). Herrmann und Bondy kamen aus der Jugendbewegung und wurden auch inspiriert von der Erziehungsanstalt Lindenhof unter der Leitung Karl Wilkers, in dem Herrmann auch gearbeitet hatte. ,,Die Grundeinstellung zu den Menschen" war die des ,,Kameraden zu dem der Hilfe braucht".(vgl.: Herrmann, a.a.O., 49). Die Jugendlichen waren in Gemeinschaftshaft, dies war Herrmann sehr wichtig um eine ,,pädagogische Atmosphäre", ,,gemeint ist eine ganz bestimmte Einstellung von Führer und Geführten zueinander" zu schaffen (Herrmann, a.a.O., 51). Herrmann teilt die Durchführung des Erziehungsgedankens in sieben Bereiche:
Arbeit, Unterricht, Seelsorge, Disziplin und Strafe, Selbstverwaltung, Überwindung erziehungsfeindlicher Einflüsse, Sorge für die Zukunft. Bei der Arbeit wird unterschieden in Erziehung zur Arbeit und Erziehung durch die Arbeit (vgl.: Herrmann,a.a.O.,52). Dem Unterricht wurden drei Aufgaben beigemessen, Kenntnisvermittlung, Gewöhnung an geistiges Arbeiten und ethische Beeinflussung. Die Seelsorge ging über das religiöse hinaus und es ging um alles ,,was mit der Beeinflussung des Gefühlslebens zusammenhing". Weiterhin ging es um die sinnvolle Ausnutzung der Freizeit durch z.B. gemeinsame Feste, Unterhaltungs- und Lesestunden (vgl.: Herrmann, a.a.O., 70). ,,Ziel der Erziehung zur Disziplin war die Selbstdisziplinierung, das freiwillige Sich einfügen in eine höhere Ordnung (Herrmann, a.a.O.,79). Hier wurde versucht durch Beispiel und Ermahnungen im Guten zu wirken. Wirkte dies nicht wurde auch Zwang und Strafe angewendet, wobei die Strafe keine ,,affektive Reaktion" sein sollte, ,,sondern mit ernster Überlegung und individualisierender Abstufung angewandt" wurde (vgl.: Herrmann, a.a.O., 80-82). Selbstverwaltung, heißt hier dass Herrmann und Bondy die Leitung behielten und versuchen die Gefangenen zur Mitarbeit zu erziehen. Ein wesentlicher Versuch hierzu war die Einrichtung des Innenrings, ,,ein Zusammenschluss eines Teils der Gruppe, der aufgebaut ist auf dem Gedanken der Gemeinschaft, der Selbsttätigkeit und der gegenseitigen Hilfe. (vgl.: Herrmann, a.a.O.,84-86). Bei der ,,Überwindung Erziehungsfeindlicher Einflüsse" ist zum einen die Vergangenheit vor dem ersten Strafvollzug gemeint, welche sich meist mit den Ursachen der Kriminalität deckt. Zum anderen ist hier die Wirkung der Fürsorgerziehung selbst gemeint (vgl.: Herrmann, a.a.O., 93-99). Hier sei vor allem auf den Nachteil der Gemeinschaftshaft hingewiesen, nämlich die Schlafsäle mit den Gefahren des Verbrechermilieus und die sexuelle Gefahr (vgl.: Herrmann, a.a.O., 99-103). Die Sorge für die Zukunft soll nicht mit der Entlassung beendet sein, sondern über den Zeitpunkt der Entlassung hinaus andauern (vgl.: Herrmann, a.a.O., 111-112). Dies soll nur eine kurze Darstellung der verschiedenen Bereiche sein und einen Einblick in diese Arbeit geben. Diese Arbeit war nur ein Versuch und als solcher auch gedacht (vgl.: Herrmann, a.a.O., 17). Ein Problem dieser Arbeit war, dass die Beamten nur zum Teil den Willen hatten gute Arbeit für die Häftlinge zu leisten, und selbst wenn, sie diesen hatten, fehlte Ihnen meist die Ausbildung (vgl.: Herrmann, a.a.O., 36-38). Auf das Problem der fehlenden Ausbildung geht Prof. Dr. Liepmann in seinem Vorwort noch näher ein, ein Grund für die schlechte Ausbildung liegt wohl auch darin, dass das deutsche Gefängniswesen aus reformatorischen Gesichtspunkten gegenüber dem amerikanischen Rückschrittlich war (vgl.: Herrmann, a.a.O., 3-14).
III Ausleitende Gedanken
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Reformpädagogik und Sozialpädagogik?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der reformpädagogischen Bewegung auf die Sozialpädagogik, beginnend mit der Veröffentlichung von Ellen Keys "Das Jahrhundert des Kindes" im Jahr 1900. Sie beleuchtet den Paradigmenwechsel in der Pädagogik, weg von der Erwachsenen- und Sachorientierung hin zu einer kindzentrierten Herangehensweise.
Welche historischen Kontexte werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Bildungskritik, die soziale Bewegung, die Frauenbewegung, die Jugendbewegung und die Entwicklung der Psychologie als wichtige historische Kontexte, die die Reformpädagogik beeinflusst haben.
Wie wird die Sozialpädagogische Bewegung eingeordnet?
Die Sozialpädagogische Bewegung wird als Teil der Reformpädagogischen Bewegung verstanden, wobei auf die Anfänge bis zum Ersten Weltkrieg, die Zeit der Weimarer Republik und die Reformen der Jugendfürsorge eingegangen wird.
Was ist der Kern der Bildungskritik im ausgehenden 19. Jahrhundert?
Die Bildungskritik wendete sich gegen den naiven Fortschrittsglauben, der durch Technisierung, Industrialisierung und Verstädterung entstanden war. Sie forderte die Freiheit des Innenlebens und kritisierte eine Bildung mit gegenwartsfernen Inhalten.
Welche Rolle spielte die soziale Bewegung?
Die soziale Bewegung entstand aufgrund des Strukturwandels durch die Industrialisierung, die zu Landflucht, Verstädterung und sozialer Not der Arbeiterklasse führte. Die Kirchen und später auch die Arbeiterbewegung selbst setzten sich für soziale und pädagogische Hilfe ein.
Welche Ziele verfolgte die Frauenbewegung?
Die Frauenbewegung kämpfte für den Zugang zu Berufen, das Wahlrecht, den Zugang zu öffentlichen Ämtern und die Möglichkeit, an Universitäten zu studieren. Sie wirkte sich besonders stark auf die Sozialpädagogik aus, indem sie die methodische Frage der sozialen Arbeit vorantrieb.
Was kennzeichnete die Jugendbewegung?
Die Jugendbewegung, wie der Wandervogel, strebte nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Gemeinschaftserleben und Naturerfahrung. Sie legte Wert auf die Erziehung in Gemeinschaft durch Selbsterziehung.
Wie veränderte die Psychologie die Sicht auf Kinder?
Die Psychologie als Erfahrungswissenschaft begann, Kinder zu beobachten und erkannte, dass auch sie Willensprozesse und schöpferische Fähigkeiten besitzen. Dies führte zu einer veränderten, positiveren Einstellung gegenüber Kindern.
Wie definierte Paul Natorp den Begriff Sozialpädagogik?
Natorp verstand Sozialpädagogik als die grundsätzliche Anerkennung, dass die Erziehung des Individuums in jeder wesentlichen Richtung sozial bedingt ist. Er sah sie nicht als abtrennbaren Teil der Erziehungslehre, sondern als konkrete Fassung der Aufgabe der Pädagogik überhaupt.
Was waren die Schwerpunkte von Hermann Nohls Sozialpädagogik?
Hermann Nohl betrachtete die Arbeiterbewegung, die innere Mission, die Frauenbewegung, die Sozialpolitik und die Jugendbewegung als geistige Energien, die in die Jugendwohlfahrtsarbeit einfließen. Ihm ging es vordergründig um die Höherbildung des Menschen.
Welche Auswirkungen hatte die Reformpädagogik auf die Jugendfürsorge?
Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) von 1924 vereinheitlichte die Leistungen der öffentlichen und privaten Jugendfürsorge und schuf einen öffentlich-rechtlichen Erziehungsanspruch. Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) von 1923 führte zu einer neuen Beziehung des Strafrechts zur Erziehung, indem es Erziehungsmaßregeln Vorrang vor Strafen gab.
Wie beeinflusste die Sozialpädagogische Bewegung die "Soziale Arbeit"?
Die Sozialpädagogische Bewegung pädagogisierte die Sozialarbeit, und umgekehrt. Albert Mühlum schlägt vor, sich auf "Soziale Arbeit" zu einigen, um aus dem Dilemma des "Gegeneinander" zu kommen und eine eigenständige wissenschaftlich fundierte Disziplin zu schaffen.
Was war das Besondere am hamburgischen Jugendgefängnis Hahnhöfersand?
Walter Herrmann und Kurt Bondy arbeiteten als Hilfsaufseher im Jugendgefängnis Hahnhöfersand und versuchten, reformpädagogische Ideen in der Praxis umzusetzen. Sie legten Wert auf Gemeinschaftshaft, Arbeit, Unterricht, Seelsorge, Disziplin, Selbstverwaltung und die Sorge für die Zukunft der Gefangenen.
Welche abschließenden Gedanken werden formuliert?
Die Arbeit betont, wie wichtig es ist, "Bewegungen" und "Konzepte" aus bestimmten Zeiten im jeweiligen historischen Kontext zu betrachten. Die anfängliche Sozialpädagogik war eine Antwort auf die Individualpädagogik, so wie diese wahrscheinlich eine Antwort auf die Pädagogik im Mittelalter war. Die ökologische Bewegung war Impulsgeber für das Ökosoziale Paradigma, welches wiederum an der Weiterentwicklung der "Sozialen Arbeit" beteiligt ist.
- Quote paper
- Alexander Thomas (Author), 2000, Kontext zwischen Reformpädagogik und Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98125