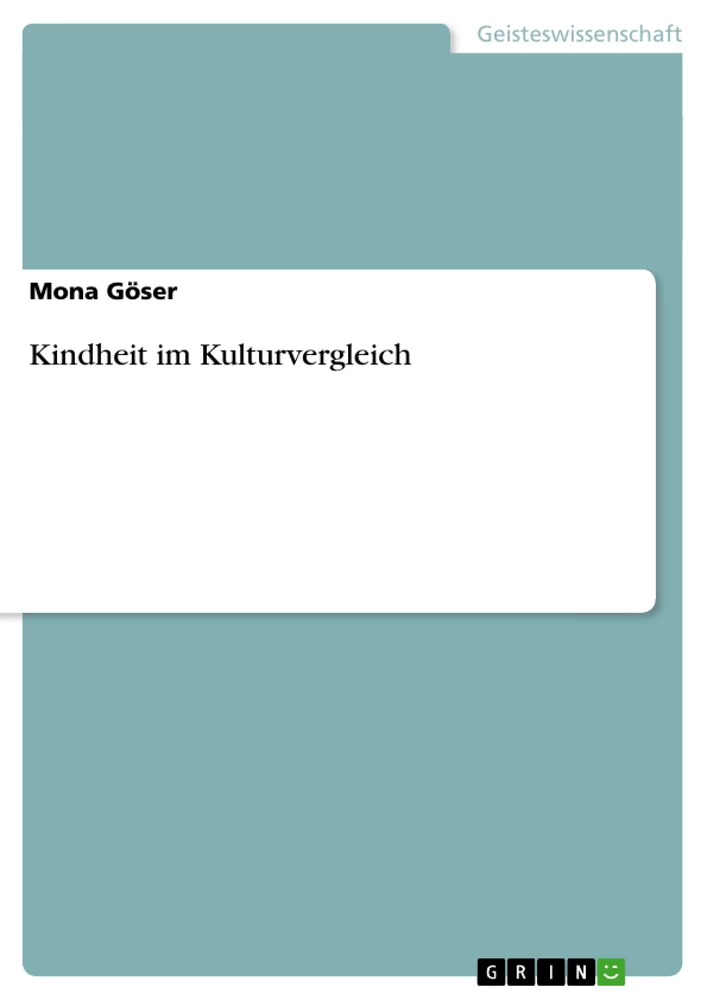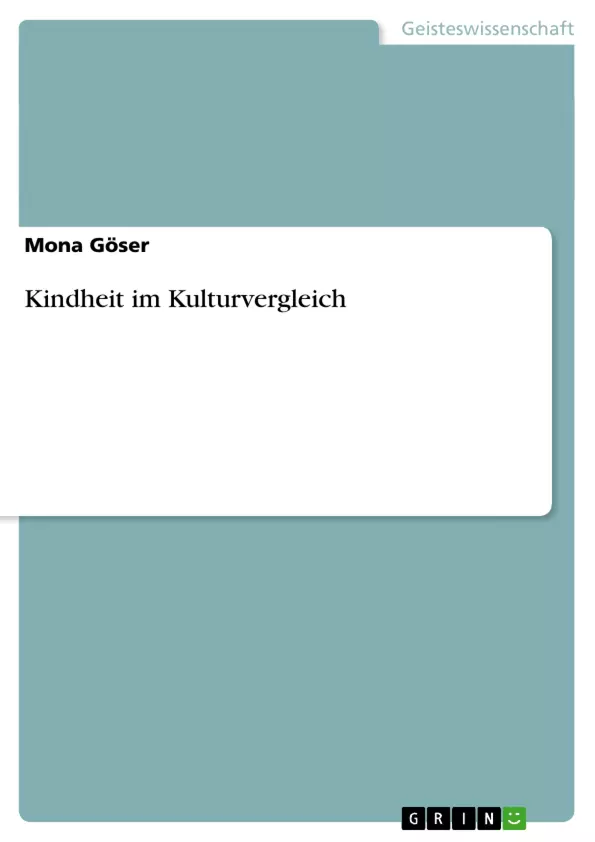Warum wird denn in der Sozialisationsforschung die kulturvergleichende Methode eingesetzt?
Die Sozialisationsforschung wird unter kulturvergleichender Perspektive betrieben, da die kulturellen Faktoren wesentliche Bedingungen der Sozialisation sind.
Die auf die Persönlichkeitsentwicklung einwirkenden Sozialisationsfaktoren sind in die Kultur eingebettet und werden unter diesen kulturellen Gegebenheiten vom Individuum wahrgenommen und verarbeitet.
Die kulturellen Besonderheiten sind aber nicht nur die Bedingungsfaktoren der Sozialisation sondern auch das Ergebnis des Sozialisationsprozesses.
Die Methode des Kulturvergleichs eröffnet der Sozialisationsforschung besonders günstige Möglichkeiten. Sie verhilft dazu, die Vielfalt von Sozialisationsphänomenen zu beschreiben, da die für die Persönlichkeitsentwicklung relevanten Faktoren, die Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung und ihre Ergebnisse erst im kulturellen Vergleich erkennbar werden. Außerdem hilft sie universelle und kulturspezifische Strukturen und Prozesse der Sozialisation zu beschreiben und zu erklären. Damit können ethnozentrische Deutungen und Theroien überwunden, Methoden zur Messung von Unterschieden verbessert und kulturangemessene Technologien entwickelt werden.
Da wir davon ausgehen, daß
a) jede Person ein aktives, handelndes Individuum mit eigenen Zielen ist
b) auf die Persönlichkeitsentwicklung viele Faktoren einwirken
c) jede Person Sozialisationsfaktoren aktiv und auf der Grundlage kultureller Deutungs-schemata - diese können adaptiert und verändert werden - verarbeitet und damit im Sozialisationsverlauf aktiv auf seine Umwelt einwirkt ( Dadurch verändern sich auch wieder die Bedingungen der Sozialisation, was sich natürlich auch auf das Individuum auswirkt.)
ergibt sich die Aufgabe, Bedingungen und Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung über den individuellen Lebenslauf und im historischen Vergleich zu erforschen.
Damit zeigt sich die Notwendigkeit, Kulturvergleiche über Sozialisationsbedingungen, -strukturen, und -prozesse in verschiedenen Kontexten und unter Berücksichtigung sozialen Wandels vorzunehmen.
Der Kulturvergleich will aber nicht ganze kulturelle Systeme beschreiben und vergleichen sondern die Varianz der dort repräsentierten Phänomene unter theoretischer Fragestellung erweitern.
Inhaltsverzeichnis
1. Warum gibt es die kulturvergleichende Sozialisationsforschung ?
1.1 Die Aufgaben der Sozialisationsforschung
1.2 Der Begriff der Kultur
1.3 Der Kulturvergleich
2. Möglichkeiten und Probleme des Kulturvergleichs
2.1 Methodische Vorteile des Kulturvergleichs
2.2 Methodische Probleme des Kulturvergleichs
3. Entwicklung in der Kindheit aus kulturvergleichender Sicht
4. Frühe Mutter-Kind-Beziehung im Kulturvergleich
4.1 Einführung
4.2 Mutterbindung
4.2.1 Bindungskonzept, Attachmentkonzept
4.2.2 Intrakulturelle Differenzen im Bindungsverhalten
4.2.3 Kulturelle Differenzen im Bindungsverhalten
4.3 Bedingungen für unterschiedliche Bindungsformen
4.4 Längerfristige Sozialisations-Effekte früher Mutter-Kind-Beziehungen
5. Film: Mütter und Kinder
5.1 Inhalt
5.2 Methodische Begründung
5.3 Auswirkungen des Methodenwechsels
1. Warum gibt es die kulturvergleichende Sozialisationsforschung ?
1.1 Die Aufgaben der Sozialisationsforschung
Die Sozialisationsforschung hat die Aufgabe, die Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung und die auf sie einwirkenden und von ihr beeinflußten kulturellen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren zu untersuchen. Wobei der Akzent eher auf soziologischen Ansätzen zur Beschreibung der Wirkungsanalyse sozio-struktureller Faktoren oder auf psychologischen Ansätzen zur Beschreibung und Erklärung intra- und interpersonellen Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung liegen kann.
1.2 Der Begriff der Kultur
Das Wort Kultur kann wie folgt definiert werden:
- von einer Gruppe verwendete Deutungs- und Handlungsmuster, Wissen, Sprach und Techniken zur Bewältigung von Anpassungsproblemen im Umgang der Menschen mit der Umwelt.
- Kulturmerkmale stehen in einem integrierten Zusammenhang, d.h. die Merkmale ergänzen und verstärken sich gegenseitig
- Kultur ist ein Teil der Menschen und sie ist von Menschen gemacht.
1.3 Der Kulturvergleich
Warum wird denn in der Sozialisationsforschung die kulturvergleichende Methode eingesetzt?
Die Sozialisationsforschung wird unter kulturvergleichender Perspektive betrieben, da die kulturellen Faktoren wesentliche Bedingungen der Sozialisation sind.
Die auf die Persönlichkeitsentwicklung einwirkenden Sozialisationsfaktoren sind in die Kultur eingebettet und werden unter diesen kulturellen Gegebenheiten vom Individuum wahrgenommen und verarbeitet.
Die kulturellen Besonderheiten sind aber nicht nur die Bedingungsfaktoren der Sozialisation sondern auch das Ergebnis des Sozialisationsprozesses.
Die Methode des Kulturvergleichs eröffnet der Sozialisationsforschung besonders günstige Möglichkeiten. Sie verhilft dazu, die Vielfalt von Sozialisationsphänomenen zu beschreiben, da die für die Persönlichkeitsentwicklung relevanten Faktoren, die Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung und ihre Ergebnisse erst im kulturellen Vergleich erkennbar werden. Außerdem hilft sie universelle und kulturspezifische Strukturen und Prozesse der Sozialisation zu beschreiben und zu erklären. Damit können ethnozentrische Deutungen und Theroien überwunden, Methoden zur Messung von Unterschieden verbessert und kulturangemessene Technologien entwickelt werden.
Da wir davon ausgehen, daß
a) jede Person ein aktives, handelndes Individuum mit eigenen Zielen ist
b) auf die Persönlichkeitsentwicklung viele Faktoren einwirken
c) jede Person Sozialisationsfaktoren aktiv und auf der Grundlage kultureller Deutungs- schemata - diese können adaptiert und verändert werden - verarbeitet und damit im Sozialisationsverlauf aktiv auf seine Umwelt einwirkt ( Dadurch verändern sich auch wieder die Bedingungen der Sozialisation, was sich natürlich auch auf das Individuum auswirkt.) ergibt sich die Aufgabe, Bedingungen und Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung über den individuellen Lebenslauf und im historischen Vergleich zu erforschen.
Damit zeigt sich die Notwendigkeit, Kulturvergleiche über Sozialisationsbedingungen, - strukturen, und -prozesse in verschiedenen Kontexten und unter Berücksichtigung sozialen Wandels vorzunehmen.
Der Kulturvergleich will aber nicht ganze kulturelle Systeme beschreiben und vergleichen sondern die Varianz der dort repräsentierten Phänomene unter theoretischer Fragestellung erweitern.
2. Möglichkeiten und Probleme des Kulturvergleichs
Die kulturvergleichende Sozialisationsforschung hat die folgenden Möglichkeiten.
- Sie kann die Bedingungen und Prozesse der Sozialisation in verschiedenen Kulturen systematisch erfassen.
- Sie kann theoretische Aussagen über Sozialisationsprozesse prüfen und gegebenenfalls modifizieren.
- Sie ist in der Lage, Methoden zur Erfassung von Sozialisation und Sozialisations- technologien zu verbessern.
Eine systematische Beschreibung der kulturellen Besonderheiten der Sozialisation in bestimmten Kulturen ist durch eine Analyse kulturinvarianter Sozialisationsphänomene zu ergänzen.
Die Möglichkeiten und Vorteile der kulturellen Sozialisationsforschung ergeben sich aus den grundlegenden methodischen Problemen der Sozialisationsforschung.
Eines dieser Probleme ist die Vielfalt von Variablen, die den Verlauf und die Ergebnisse der Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen, da sie nicht ausreichend empirisch kontrolliert werden können.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß die theoretisch interessierenden Einflußvariablen aus praktischen und ethischen Gründen schwer zu manipulieren sind. Außerdem sind Sozialisationsprozesse ihrer Natur nach nur in begrenztem Maße und nur für bestimmte eingeschränkte Fragestellungen unter experimentellen Bedingungen im Labor ökologisch valide meßbar.
2.1 Methodische Vorteile der kulturvergleichenden Sozialisationsforschung
Der Kulturvergleich kann Probleme der Validität von Meßverfahren erkenne und lösen, die Varianz theoretisch interessierender Variablen erweitern und die in unserer Kultur konfundierten Variablen entkonfundieren.
Die in einer Kultur gewonnenen Ergebnisse lassen sich nur schwer verallgemeinern, unter anderem weil die Varianz der Sozialisationsbedingungen und -phänomene eingeschränkt ist. Durch eine Varianzerweiterung von Bedingungen und Phänomenen werden Theorien härteren Tests ausgesetzt, da sich bestimmte Bedingungen nur durch Einbeziehung von anderen Kulturen bzw. historischen Epochen schaffen lassen. Der Kulturvergleich wird genutzt, um die Varianz der theoretisch interessierenden Anfangsbedingungen zu erweitern. Danach können einerseits generalisierbare und andererseits kulturspezifische Aussagen gemacht werden.
Im Kulturvergleich lassen sich Variable, die bei uns konfundiert sind isolieren, was nötig ist, um ihren Anteil an der aufzuklärenden Varianz der Sozialisationsprozesse und -ergebnisse festzustellen. Hier sind Kulturen nützlich, bei denen diese Variablen isoliert auftrete, also „natürliche“ ökologisch valide Bedingungen vorhanden sind.
Unter Einbeziehung des kulturellen Kontexts lassen sich Kulturen als Variablenmuster auffassen, die im Sinne eines experimentellen Vorgehens variiert werden können, um ihren Einfluß auf verschiedene interessierende Sozialisationsphänomene zu untersuchen. Die jeweiligen theoretischen Variablenmuster und ihre funktionale Bedeutung sind daher als kulturelle Variable zu erkennen, deren Funktion für den Sozialisationsprozeß zu untersuchen ist.
Daraus entsteht nun die Möglichkeit, Kulturen als Indikatoren für bestimmte theoretische Konstrukte zu verwenden, um so deren spezifische Erklärungsbeiträge zu prüfen. Hier ergibt sich die Forderung, die Bezeichnungen „Kultur“ oder „Nation“ durch den Begriff „Variable“ zu ersetzen, da dadurch über den formalen und deskriptiven Vergleich von Phänomenen in verschiedenen Kulturen hinaus die Möglichkeit einer Erklärung und Vorhersage von Sozialisationsphänomenen geschaffen wird.
Durch die Einbeziehung verschiedener Kulturen mit den Zielen der theoriegeleiteten Varianzvergrößerung, der Entkonfundierung von Variablen und der Validitätsverbesserung von Indikatoren wird eine möglichst strenge Hypothesenbildung möglich.
Der Kulturvergleich kann auch die Verknüpfung verschiedener theoretischer Ansätze und Analyseebenen und eine Verbesserung der Sozialisationstechnologien leisten.
2.2 Methodische Probleme der kulturvergleichenden Sozialisationsforschung
Es gibt aber auch einige methodologische und meßtheoretische Probleme der Sozial- und Verhaltenswissenschaft, die sich im interkulturellen Vergleich verschärfen. So müssen die beobachteten Phänomene so gemessen werden, daß sie vergleichbar sind. Hierfür muß eine Metasprache gegeben sein, die die notwendige Isomorphie zwischen Meßverfahren und Phänomenbereich sichert. Dies wird von der Verwendung reliabler, objektiver und valider Untersuchungsverfahren geleistet.
Hier treten nun zwei besondere Probleme auf:
1. Das gewählte Verfahren trifft auf eine Kultur zu, entspricht also ihren methodischen Bedürfnissen. Dies gilt aber nicht unbedingt für eine andere Kultur. Eine blinde Rückübersetzung und die Verwendung formal identischer Fragen, Skalen und Beobachtungseinheiten sind also keine Lösung zur Sicherung der Äquivalenz.
2. Die Sicherung funktionaler, konzeptioneller, linguistischer und metrischer Äquivalenz ist problematisch. Es lassen sich zwar mögliche Fehler bzw. kulturspezifische Tendenzen in ihrer Bedeutung und der Verwendung von Verfahren in Voruntersuchungen feststellen, die methodischen Kenntnisse allein reichen aber nicht aus, es sind immer auch empirische Kulturkenntnisse erforderlich.
Auch die Wahl der Stichproben ist problematisch.
Daher müssen geeignete Indikatoren für den Kulturvergleich entwickelt werden, wobei geprüft werden muß, ob die gewählten Indikatoren erlauben in verschiedenen Kulturen mit der gleichen Validität auf die Ausprägung des theoretisch interessierenden Merkmals zu schließen.
Es sollten daher multiple Indikatoren verwendet werden, deren Struktur in den Kulturen ähnlich ist und die das theoretische Konstrukt angemessen abbilden.
Es trete außerdem Probleme in der
- Äquivalenz (bei der Datenaufnahme und ihrer Interpretation
Es müssen ethnozentrische Fehler vermieden werden, wobei die Äquivalenz von Methoden und Konstrukten erforderlich ist und vielfältige Überlegungen und Vorstudien vorausgesetzt werden.)
- Organisation (z.B. die Art der Beteiligung ausländischer Kollegen, Amtsträger, und Probanden, die Klärung ethischer Fragen der Durchführung der Forschung,...)
- Anwendung und Technologie (müssen auf die Kultur abgestimmt sein) auf.
Literaturnachweis: Aus der Reihe „Der Mensch als soziales und personales Wesen“
Band 10: Sozialisation im Kulturvergleich (Hrsg: Gisela Trommsdorff)
Aus dem Aufsatz von G.Trommsdorff: „Kulturvergleichende Sozialisationsforschung“
3. Entwicklung in der Kindheit aus kulturvergleichender Sicht
Die meisten Untersuchungen zur Sozialisation und Entwicklung von Kindern sind bisher in westlichen Kulturen geführt worden. Diese Ergebnisse stehen aber nur für einen kleinen Teil der Menschheit, sind also nicht generalisierbar. Vor allem bei der Beantwortung grund- sätzlicher Fragen nach den Bedingungen der Entwicklung ist eine ethnozentrische Sichtweise problematisch. Hierzu gehört z.B. die Frage des Zusammenwirkens von biologischen und Umweltbedingungen und inwieweit das Individuum seine Entwicklung selbst gestaltet und ob diese Aktivität im Rahmen von und in Interaktion mit genetischen und kuturellen Bedingungen erfolgt.
Diese Fragen lassen sich nur im Kulturvergleich beantworten.
Daher wurden zahlreich Einzelstudien geführt, die die Vermutung nahe legen, daß das Verhalten der Menschen in verschiedenen Sozialisationskontexten unterschiedlich ist. Die daraus entstehenden Fragen, wie z.B. wie sich dieses Verhalten entwickelt, ob es stabil bleibt, oder sich mit der Zeit ändert, können ebenso erst im Kulturvergleich beantwortet werden, wobei die Entwicklung von Kindern verschiedener Kulturen im Längsschnitt über die Lebensspanne beobachtet werden muß.
Erst eine Verknüpfung der Frage nach den Ähnlichkeiten und Unterschieden in Entwicklungsphänomenen mit der Frage nach den universellen Prozessen der kognitiven, emotionalen, sozialen und motivationalen Entwicklung ist interessant. Diese Fragen aber können nur im Kulturvergleich beantwortet werden.
Allein die biologisch verankerten Prozesse in der Entwicklung in der frühen Kindheit lassen sich mit universellen Gesetzen belegen. Die weitere Entwicklung läuft jedoch nicht nur nach einem internen Programm ab, ist aber auch nicht nur plastisch und durch externe Bedingungen gestaltet. Das Kind kann seine Entwicklungschancen selegieren und somit seinen Entwicklung selbst gestalten.
Es wirken auch Umweltbedingungen, d.h. sozio-kulturelle Einflüsse auf das Denken des Kindes ein. Diese können universell gleiche intuitive elterliche Handlungsmuster, spezifische kulturelle Werte oder Erziehungstheorien sein. Sie enthalten die erwünschten Persönlichkeitsmerkmale und die Erziehungspraktiken zur Realisierung dieser. In dem Sinn, daß die Umweltbedingungen aber auch ökonomische oder ökologische Chancen für die Kinder darstellen können, untersuchen Super und Harkness die kindliche Entwicklung in kulturellen Nischen bzw. Kontexten. Dies geschieht auf folgenden Ebenen: · physische und soziale Alltagskontexte
- kulturell regulierte Erziehungsgewohnheiten · psychologische Besonderheiten des Erziehers Bei einer Erweiterung dieses Modells werden auch die Wechselwirkungen zwischen dem Kind und seiner sozialen Umwelt sowie dem ökologischen und kulturellen Kontext mit einbezogen. Danach sind Kinder so stark mit ihrer Umwelt verwoben, daß beide - Organismus und Umwelt - nicht mehr unabhängig von einander definiert werden können. Dies setzt der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie neue Aufgaben und methodische Grenzen.
Zu diesen Ansätzen der genetischen und/oder kulturellen Weitergabe von Entwicklungsfaktoren gibt es verschiedene Positionen.
1. absolutistischer Ansatz: Verhaltensunterschiede können durch nichtkulturelle Faktoren erklärt werde
2. universalistischer Ansatz: Erklärung der Unterschiede durch Kultur-Organismus- Interaktion
3. relativistischer Ansatz: unterschiedliches Verhalten kann mit Hilfe kultureller Faktoren erklärt werden.
Die Vor- und Nachteile dieser 3 Ansätze können erst im Kulturvergleich geklärt werden.
Da die Kinder bei der kulturvergleichenden Forschung nicht in einem experimentell kontrollierten Kontext aufwachsen - es wird kein Einfluß auf die Kinder und ihre Entwicklung genommen -, vermittelt diese Methode Vorteiele des wissenschaftlichen Experimentierens, ohne sich einem ethischen Problem auszusetzen.
Daher können durch „quasi-natürliche“ Experimente die verschiedenen Ausprägungen von Entwicklungsphänomenen und -bedingungen beobachtet werden.
Mit einer genauen Kulturkenntnis - diese ist nötig um kulturangemessene und funktional äquivalente Verfahren auszuwählen - kann eine Auswahl entsprechender kultureller Kontexte stattfinden, durch die sich die Varianz der in unserer Kultur gegebenen Phänomene und Bedingungen erweitern und die konfundierten Faktoren entzerren lassen.
Literatur: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie (ZSE) Heft 2/93 Aus dem Aufsatz von G. Trommsdorff: „Entwicklung in der Kindheit aus kulturvergleichender Sicht“
4. Frühe Mutter-Kind-Beziehung im Kulturvergleich
4.1 Einführung
Es gibt viele Untersuchungen, welche sich mit den verschiedenen Mutter-Kind-Beziehungen und deren Einflüsse auf die spätere Persönlichkeit des Kindes befassen. Es wird deutlich, daß die Erfahrungen, welche das Kind macht, eine große Bedeutung für dessen Persönlichkeitsentwicklung haben, da frühe Überzeugungen, Erwartungen und Motive eine Basis bilden, von der aus später Erfahrungen wahrgenommen und verarbeitet werden. Hierbei haben die Erfahrungen aus der Mutter-Kind-Beziehung eine Sonderstellung. Die Mutter ist die erste und normal auf lange Zeit wichtigste Erfahrungen vermittelnde Person, welche durch die Pflege und Betreuung des Kindes die erste Erfahrungswelt in vielfältiger Hinsicht gestaltet.
Die Bindungsforschung ging von folgendem theoretischen Ansatz aus: Zum einen gibt es ein in der Persönlichkeit biologisch verankertes Funktionssystem von best. Bedürfnissen und Verhaltensmustern und zum andern werden aus Bindungserfahrungen länger dauernde kognitive und motivationale Systeme, sogenannte „working models“, aufgebaut. Die Bindungsforschung macht deutlich, daß die Art der Mutter-Kind-Bindung grundlegende Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung beeinflußt und sie deckt viele Faktoren über die Rolle der Mutter-Kind-Beziehung auf.
4.2 Mutterbindung
4.2.1 Bindungskonzept, Attachmentkonzept
Als Attachment bezeichnet man ein spezielles motivationales System, durch welches das Kind ein Gefühl der Sicherheit gewinnt bzw. erhält. Es wird vor allem unter Angst, Müdigkeit, Krankheit und Streß aktiviert und motiviert dazu, die Nähe, den körperlichen Kontakt, die Hilfe, die Zuwendung und den Trost der Person mit spezieller, zuvor entwickelter Bindung (der Mutter), zu suchen. Hierbei fallen das subjektive Gefühl der Sicherheit des Kindes mit der tatsächlichen, von der Mutter gewährleisteten, Sicherheit zusammen. Nach Ainsworth liegen dem Attachment zwei Konzepte zugrunde:
- Attachment ist ein biologisch verankertes Motiv- und Verhaltenssystem, das besonders bei Gefahr anspricht und den Schutz der Mutter (oder einer anderen Vertrauensperson) suchen läßt. Dieses Vertrauen wird in den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes aufgebaut. Danach stellt sich bei allen Vertrauensperonen ein Sicherheitsgefühl ein. Ist bei dem Kind das Motivsystem befriedigt, das heißt, Vertrauen ist vorhanden, so getraut es sich seinen Explorationsbedürfnissen zu folgen, Neues und Unbekanntes zu erforschen. Es ist sich der Unterstützung der Attachment-Person sicher. Wurde das Motivsysytem nicht befriedigt, das heißt, es wurde kein Vertrauen aufgebaut, oder ist die Attachment-Person nicht da, so wird das Kind unsicher und wendet sich neuem nur ungern und unter Angst zu. Die Lern- und Übungsmöglichkeiten werden hierdurch eingeschränkt. Dies hat Konsequenzen für die weitere motorische, motivationale und kognitive Entwicklung.
- Durch das erste Konzept werden kognitive Systeme über die Umwelt und über das eigene Selbst entwickelt, welche man „working models“ nennt (Bowlby 1973). Das Kind entwickelt eigene Vorstellungen über die Gefährlichkeit der Welt und über die
Eigenschaften der zentralen Attachment-Person (z.B. hilfreich, verläßlich, feindselig). Es entwickelt Konzepte über sich selbst im Sinne eines Menschen, das heißt, es erkennt, daß es Liebe und Zuwendung gewinnen kann, oder aber dazu unfähig ist und somit in einer unbekannten, bedrohlichen Welt alleingelassen ist.
Die working models sind auch langfristig wirksam. Sie prägen die Verarbeitung weiterer Erfahrungen und sie bestimmen sogar noch beim Erwachsenen mit, da sie bei der Deutung von Unbekanntem und von Gefahren mitwirken, sowie die Einstellung und die Verhaltensweise gegenüber anderen Personen mitbestimmen.
⇒ Es wird deutlich, daß die Mutter-Kind-Beziehung langfristige Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes hat.
4.2.2 Intrakulturelle Differenzen im Bindungsverhalten
Das typische Bindungsverhalten des Kindes wird ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres deutlich und entwickelt sich aus Komponenten, welche bereits früher vorhanden waren. So schreit das Kind zum Beispiel wenn die Mutter den Raum verläßt, nicht aber, wenn dies jemand anderes tut. Das Bindungsverhalten ist ein komplexes, auf wenige AttachmentPersonen, welche Beruhigung und Sicherheit vermitteln, gerichtetes Verhaltenssystem. Dieses Verhalten ist bei allen Kindern vorhanden, jedoch nicht bei allen gleich ausgeprägt. Man unterscheidet drei verschiedene Typen von Bindungsverhalten:
Typ B: sicheres Bindungsverhalten (secure attached)
Typ A: unsicher-meidendes Verhalten (avoidant attached) Typ C: unsicher-ambivalentes Verhalten (resistant attached)
4.2.3 Kulturelle Differenzen im Bindungsverhalten
Eine wichtige Forschungsfrage war, ob die Formen und Bedingungen des Bindungsverhaltens als universell für alle Menschen anzusehen sind oder ob es kulturell bedingte Differenzen gibt. Tatsächlich zeigen in allen untersuchten Kulturen Kinder Bindung an eine oder mehrere Bezugspersonen. Auch die von Ainsworth unterschiedenen Bindungstypen finden sich überall. Und universell ist offenbar auch, daß ein Kind zu verschiedenen Personen verschiedene Bindungsarten entwickeln kann.
Darüber hinaus ergaben sich jedoch auch interessante Kulturunterschiede:
- Kinder zeigten nicht immer gleiche Formen von Bindungsverhalten im Alter von 9 - 12 Monaten. Die einen haben ein aktives Bindungsverhalten zur Mutter (z.B. zur Mutter laufen, sich an sie hängen), während die Kinder anderer Kulturen fast nur ein „Signal“- Bindungsverhalten zu ihrer Mutter haben (z.B. Lächeln, Schreien).
- Zum andern betreffen die Unterschiede das Phänomen der „ sicheren Basis zur Exploration “, d.h. die Formen des Explorationsverhaltens, das auftritt, wenn die Kinder sich durch Zuwendung sicher fühlen. Das eine Kind wird, solange die Mutter da ist, alles neue erkunden und sich dazu auch von der Mutter entfernen, während das andere in unmittelbarer Nähe der Mutter bleibt und nur die Gegenstände in seiner Reichweite erkundet.
- Ebenfalls kulturspezifisch ist das unterschiedlich häufige Auftreten von sicheren und unsicheren Bindungsverhaltens in Bezug auf die unter 4.2.2 genannten Bindungstypen: So wurde in den USA zum Beispiel am häufigsten Typ B beobachtet. In Norddeutschland trat am meisten Typ A auf, was wohl daran liegt, daß die deutschen Mütter zur Selbständigkeit erziehen wollen. In Japan wurde auf Grund dessen, daß japanische Kinder immer bei der Mutter sind und nie allein gelassen werden, am häufigsten Typ C beobachtet. Auch in Kibbuz trat Typ C am meisten auf, da es ein extrem fremdenfeindliches Volk ist.
⇒ Bindungsverhalten ist kulturabhängig.
4.3 Bedingungen für unterschiedliche Bindungsformen
Fragt man nach den Bedingungen, unter denen ein Kind eine spezifische Bindung an eine Person entwickelt bzw. unter denen unterschiedliche Bindungsformen entstehen, so werden zunächst die unterschiedlichen Arten der Betreuung und Erziehung des Kindes interessant. Nach der Attachment-Theorie müßte eine Bindung zu solchen Betreuungspersonen entstehen, die das Bindungs- und Sicherheitsbedürfnis erfüllen. Damit werden verschiedene Fragen relevant:
- Welche Bedeutung hat die direkte Versorgung ( Füttern, Wickeln,...)?
Es kommt nicht auf das Füttern an sich an, sondern auf den körperlichen und sonstigen Kontakt, da das Kind zu der Person Vertrauen bildet, welche die soziale und emotionale Betreuung des Kindes übernommen hat.
- Welche Bedeutung hat die Qualität und Häufigkeit des Körperkontakts?
In Bezug auf die Häufigkeit des Körperkontakts gibt es große Unterschiede. In manchen Kulturen ist das Kind in ständigem Körperkontakt mit der Mutter, während in westlichen Kulturen der durchschnittliche Körperkontakt bei 5,8 Minuten pro Stunde liegt. So schlafen zum Beispiel in Japan 80% aller Kinder bis zu ihrem 10. Lebensjahr mit einem Elternteil zusammen, während bei uns jedes Kind so schnell wie möglich ein eigenes Bett und bald auch ein eigenes Zimmer bekommt.
Auch in Bezug auf die Qualität gibt es kulturelle Unterschiede: Ist ein Kind viel im Körperkontakt mit seiner Mutter, so hält diese es zärtlich, das Kind reagiert positiv auf den Körperkontakt und es läßt sich problemlos absetzen. Ist ein Kind seltener im Körperkontakt zu seiner Mutter, so wird es oft aufgenommen und heruntergelassen manchmals auch in unpassenden Momenten. Darauf reagiert das Kind abwehrend. Wenn es aufgenommen wird, will es runter und wenn es abgesetzt wird, will es wieder hoch.
⇒ Körperkontakt scheint für den Säugling die Form mütterlicher Responsivität zu sein, die am besten geeignet ist, dem Kind zu emotionaler Entspannung zu verhelfen.
- Welche Bedeutung haben andere, vielleicht komplexere Variablen, die bildungsrelevant sind (Responsivität)?
Mit Responsivität ist die Feinfühligkeit, Regelmäßigkeit und Schnelligkeit gemeint, mit der die Mutter auf Signale des Kindes reagiert. Sie hängt von kulturbedingten und individuellen Gegebenheiten sowie von ökologischen Faktoren ab, wie z.B. der Kinderzahl, der Anzahl der sich um das Kind kümmernden Personen, und ob die Mutter gerne Mutter ist oder nicht. Mangelnde Responsivität in den ersten drei Monaten führt zu einer Bindungsunsicherheit bei dem Kind. Ein ständiger Austausch zwischen Mutter und Kind, sowie eine gegenseitige Anpassung tragen wesentlich zur emotionalen Sicherheit, geistigen Bewältigung der Umwelt und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes bei.
All diese Fragen sind wichtig, um die Bedingungen für die unterschiedlichen Bindungsformen zu erkennen. Es gibt jedoch noch weitere Faktoren, welche die Bindungsform beeinflussen.
So prägt das Kind zum Beispiel durch erbgenetisch bedingtes Verhalten nicht undirektional die Mutter-Kind-Beziehung. Es bilden sich zwischen Mutter und Kind Interaktionszirkel. Das heißt, das Kind beeinflußt durch sein Verhalten die Mutter und umgekehrt. Das Kind hat demnach selbst wesentlichen Anteil am Zustandekommen eines Interaktionszirkels, in welchen eine ganze Vielzahl von Variablen mit eingebunden sind. Ein Beispiel für einen negativen Interaktionszirkel ist folgender:
Kind schreit viel und Mutter wird nicht immer prompt auf ist schwer zu beruhigen Schreien reagieren.
Kind erfährt weniger freudige Zuneigung.
⇒ Bei der Persönlichkeitsentwicklung kommt es auf viele Variablen an, nicht auf eine Einzelvariable in der Sozialisation.
4.4 Längerfristige Sozialisations-Effekte früher Mutter-Kind-Beziehung
In diesem Gebiet gibt es relativ wenige Untersuchungen, da sie sehr aufwendig sind. Diese Untersuchungen sind fast alle intrakulturell, man vermutet jedoch, daß auch kulturspezifische Unterschiede längerfristige Auswirkungen haben. Einige der Untersuchungsergebnissen weden im folgenden genannt:
- Warmherzige, aufmerksame, anregende, „nicht restriktive“ mütterliche Betreuung fördert die intellektuelle Entwicklung.
- Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Art der Mutter-Kind-Beziehung im Alter von 4 Jahren und dem IQ der Kinder zwei Jahren später.
- Kinder im Alter von fünf Jahren, welche eine sichere Beziehung zu ihrer Mutter haben, können konzentrierter spielen, soziale Konflikte selbständiger lösen und haben im allgemeinen weniger Probleme im Kindergarten.
- Die frühe Mutter-Kind-Beziehung beeinflußt die spätere Liebesbeziehung zwischen zwei Erwachsenen.
- Die frühe Mutter-Kind-Beziehung beeinflußt die spätere Beziehung zu den eigenen Kindern.
Literaturnachweis: Aus der Reihe „Der Mensch als soziales und personales Wesen“
Band 10: Sozialisation im Kulturvergleich (Hrsg: Gisela Trommsdorff)
Aus dem Aufsatz von Hans Joachim Kornadt unter Mitarbeit von Brigitte Husarek: „Frühe Mutter-Kind-Beziehung im Kulturvergleich“
5. Film: Mütter und Kinder Aus der Reihe: Familie Mensch Mit Prof. Dr. Irenäus Eibl-Eibesfeldt
5.1 Inhalt
Der Titel des Films bezieht sich auf die familiale Veranlagung, die im Kulturvergleich näher untersucht wird. Anhand von drei verschiedenen Kulturen wird gezeigt, daß es bei der Mutter und bei dem Kind kulturunabhängige, angeborene Verhaltensmuster gibt. Folgende drei Kulturen wurden verglichen:
1.Yanomami: Urwaldindianer aus noch unberührtem Regenwald an der Grenze von Venezuela und Brasilien am oberen Orioko, welche sich auf der Stufe der Jäger und Sammler befinden.
2. Himba: Rinderhirten aus dem sogenannten Kaokoland Namibias im Südwesten Afrikas
3. Deutsche
Bei allen drei Kulturen wurden folgende angeborene Verhaltensmuster beobachtet:
Angeborenes Verhalten bei der Mutter:
- Mutter sucht Zwiegespräch mit ihrem Kind: Die Gesicht zu Gesicht Orientierung, sowie die typische Babysprache (eine Oktave höher) sind bei allen Kulturen zu beobachten. Auch hält jede Mutter ihr Kind instinktiv ca. 30 cm von ihrem Gesicht entfernt. Das ist genau die Entfernung, auf welche die Kinder scharf sehen.
- Die Mütter lassen den Konflikt bei einem Fehlverhalten des Kindes nicht übermäßig anwachsen, sondern trösten ihr Kind nach einer Weile
- Der Augengruß: Anhaben der Augenlieder für 1/6 Sekunde um das Kind zu erheitern
- Die Mutter himmelt ihr Kind an, sie liebt es, sie küßt ihr Kind und versucht es zum Lachen zu bringen
- Stirnfalten ziehen - drückt Verärgerung aus Angeborenes Verhalten bei den Kindern:
- Lächeln: Schon früh beginnen die Kinder zu lächeln. Dies haben sie nicht gelernt, sondern dies ist ihnen angeboren. Es belohnt die Mutter für ihre Bemühungen und festigt somit die Bindung zwischen Mutter und Kind.
- Blickkontakt: Das Kind richtet seien Augen in die Richtung der Schallquelle. Dieses Verhalten wurde auch bei blinden und tauben Kindern beobachtet. Dies ist ebenfalls eine Belohnung für die Mutter, wenn ihr Kind sie anschaut und festigt somit die Bindung.
5.2 Methodische Begründung
Anhand dieses Films wird unserer Meinung nach die kulturelle Sozialisationsforschung am Beispiel der Mutter-Kind-Beziehung ( die wir als Schwerpunktthema gewählt hatten) sehr gut erklärt.
Wir haben uns für den Einsatz dieses Filmes während unseres Vortrags entschieden, da unserer Meinung nach alle bisherigen Beiträge in diesem Seminar für die Teilnehmer schwer verständlich waren. Dies lag zum einen an den vielen Fremdwörtern und Fachbegriffen, die den Referenten einen freien Vortrag fast unmöglich machten und den Teilnehmern das Zuhören erschwerte, und zum anderen an der dadurch entstehenden Unruhe der Studenten und Studentinnen.
Unsere Hoffnung war, daß die Aufmerksamkeit und das Interesse der Studenten/innen durch den Methodenwechsel auf das Thema unseres Vortrags gelenkt wird. Außerdem waren wir der Meinung, daß durch den Film unser doch recht theoretischer, komplexer und schwer verständlicher Vortrag anschaulich wird.
Auch hatten wir uns erhofft, daß von den sehr schönen, anschaulichen und leicht verständlichen Beispielen eine rege Diskussion im Anschluß ausgelöst wird.
5.3 Auswirkungen des Methodenwechsels
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß alle von uns angestrebten und erhofften Ziele des Methodenwechsels erreicht wurden.
Uns fiel auf, daß während unseres mündlichen Vortrags eine große Unruhe unter den Studenten/innen herrschte. Dies lag wohl einerseits daran, daß in den ersten Minuten die Thesenblätter noch durch die Reihen gingen und andererseits an den vielen Fachbegriffen, die uns ein freies Sprechen und den Zuhörern das Verständnis des Themas erschwerten. Wir glauben, daß das Interesse der Studenten/innen am Thema geweckt wurde, sobald der Film begann, da es sehr schnell ruhig wurde.
Aus einigen Kommentaren unserer Kommilitonen anschließend an den Film wurde deutlich, daß der Film zum Verständnis der Thematik sehr viel beigetragen hatte. Dadurch wurde eine rege Diskussion möglich.
Wir wurden in unserer Entscheidung auch durch die Rückmeldungen von Studenten/innen des Seminars nach der Veranstaltung bekräftigt und können daher den Einsatz eines Films für ein Referat sehr empfehlen, wenn dieser wie in unserem Fall sehr gut zur gewählten Thematik paßt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der kulturvergleichenden Sozialisationsforschung?
Die Sozialisationsforschung hat die Aufgabe, die Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung und die auf sie einwirkenden kulturellen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren zu untersuchen.
Wie wird der Begriff Kultur in diesem Kontext definiert?
Kultur wird definiert als von einer Gruppe verwendete Deutungs- und Handlungsmuster, Wissen, Sprache und Techniken zur Bewältigung von Anpassungsproblemen im Umgang der Menschen mit der Umwelt. Kulturmerkmale stehen in einem integrierten Zusammenhang und sind von Menschen gemacht.
Warum ist der Kulturvergleich in der Sozialisationsforschung wichtig?
Der Kulturvergleich wird eingesetzt, weil kulturelle Faktoren wesentliche Bedingungen der Sozialisation sind. Er hilft, die Vielfalt von Sozialisationsphänomenen zu beschreiben, universelle und kulturspezifische Strukturen zu erkennen und ethnozentrische Deutungen zu überwinden.
Welche Möglichkeiten bietet der Kulturvergleich in der Sozialisationsforschung?
Der Kulturvergleich ermöglicht die systematische Erfassung von Sozialisationsbedingungen und -prozessen in verschiedenen Kulturen, die Prüfung und Modifizierung theoretischer Aussagen und die Verbesserung von Methoden zur Erfassung und Beeinflussung von Sozialisation.
Welche methodischen Probleme gibt es beim Kulturvergleich?
Zu den Problemen gehören die Vergleichbarkeit der Messungen, die Sicherstellung funktionaler, konzeptioneller, linguistischer und metrischer Äquivalenz, die Stichprobenwahl und die Vermeidung ethnozentrischer Fehler.
Was sind die drei Ansätze zur Erklärung von Entwicklungsfaktoren in der Kindheit aus kulturvergleichender Sicht?
Die drei Ansätze sind: 1. der absolutistischer Ansatz (Verhaltensunterschiede können durch nichtkulturelle Faktoren erklärt werden), 2. der universalistischer Ansatz (Erklärung der Unterschiede durch Kultur-Organismus-Interaktion), 3. der relativistischer Ansatz (unterschiedliches Verhalten kann mit Hilfe kultureller Faktoren erklärt werden).
Welche Bedeutung hat die frühe Mutter-Kind-Beziehung für die Persönlichkeitsentwicklung?
Die Erfahrungen aus der Mutter-Kind-Beziehung haben eine große Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, da frühe Überzeugungen, Erwartungen und Motive eine Basis bilden, von der aus spätere Erfahrungen wahrgenommen und verarbeitet werden.
Welche verschiedenen Typen von Bindungsverhalten gibt es?
Es gibt drei Typen: Typ B (sicheres Bindungsverhalten), Typ A (unsicher-meidendes Verhalten) und Typ C (unsicher-ambivalentes Verhalten).
Sind Bindungsformen universell oder kulturell bedingt?
Es gibt universelle Aspekte (Bindung an Bezugspersonen, Vorhandensein der Bindungstypen), aber auch kulturelle Unterschiede in den Formen von Bindungsverhalten, der "sicheren Basis zur Exploration" und der Häufigkeit der Bindungstypen.
Welche Faktoren beeinflussen unterschiedliche Bindungsformen?
Zu den Faktoren gehören die Art der Betreuung und Erziehung, die Qualität und Häufigkeit des Körperkontakts, Responsivität (Feinfühligkeit, Regelmäßigkeit und Schnelligkeit der Reaktion auf kindliche Signale) und erbgenetisch bedingtes Verhalten des Kindes.
Was sind längerfristige Auswirkungen der frühen Mutter-Kind-Beziehung?
Die frühe Mutter-Kind-Beziehung kann die intellektuelle Entwicklung, die Fähigkeit zur Konfliktlösung, das Verhalten im Kindergarten, spätere Liebesbeziehungen und die Beziehung zu eigenen Kindern beeinflussen.
Was zeigt der Film "Mütter und Kinder"?
Der Film untersucht die familiale Veranlagung im Kulturvergleich und zeigt angeborene Verhaltensmuster bei Müttern und Kindern in verschiedenen Kulturen (Yanomami, Himba, Deutsche).
Welche angeborenen Verhaltensweisen sind bei Müttern im Film zu sehen?
Mütter suchen das Zwiegespräch mit ihrem Kind, lassen Konflikte nicht übermäßig anwachsen, zeigen den Augengruß, himmeln ihr Kind an und ziehen Stirnfalten (als Ausdruck von Verärgerung).
Welche angeborenen Verhaltensweisen sind bei Kindern im Film zu sehen?
Kinder lächeln und suchen Blickkontakt.
- Arbeit zitieren
- Mona Göser (Autor:in), 1999, Kindheit im Kulturvergleich, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97789