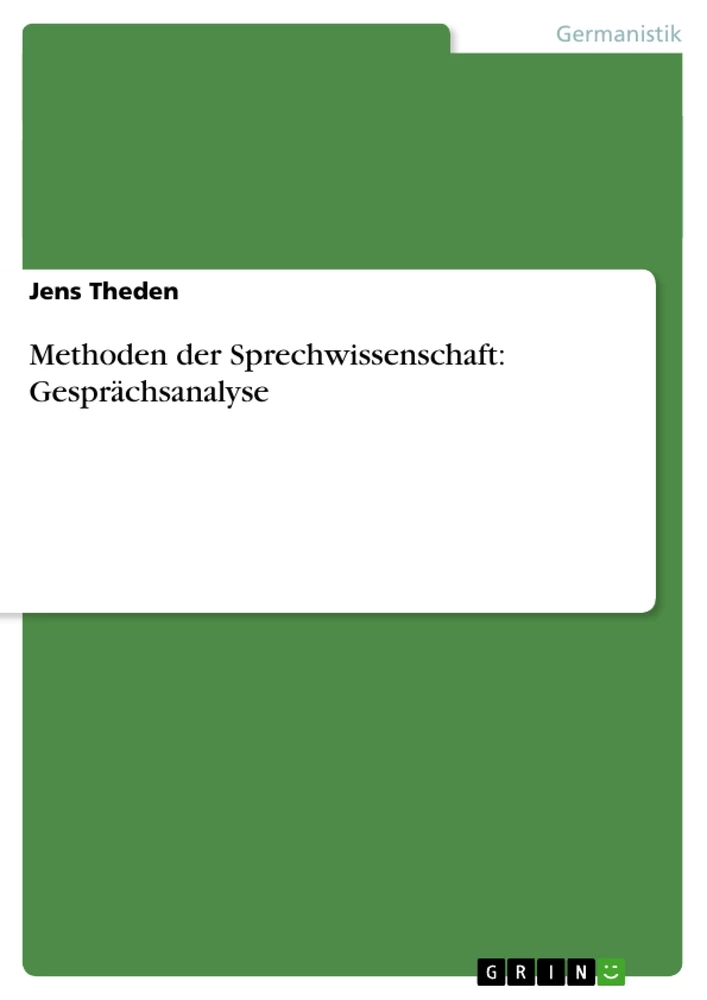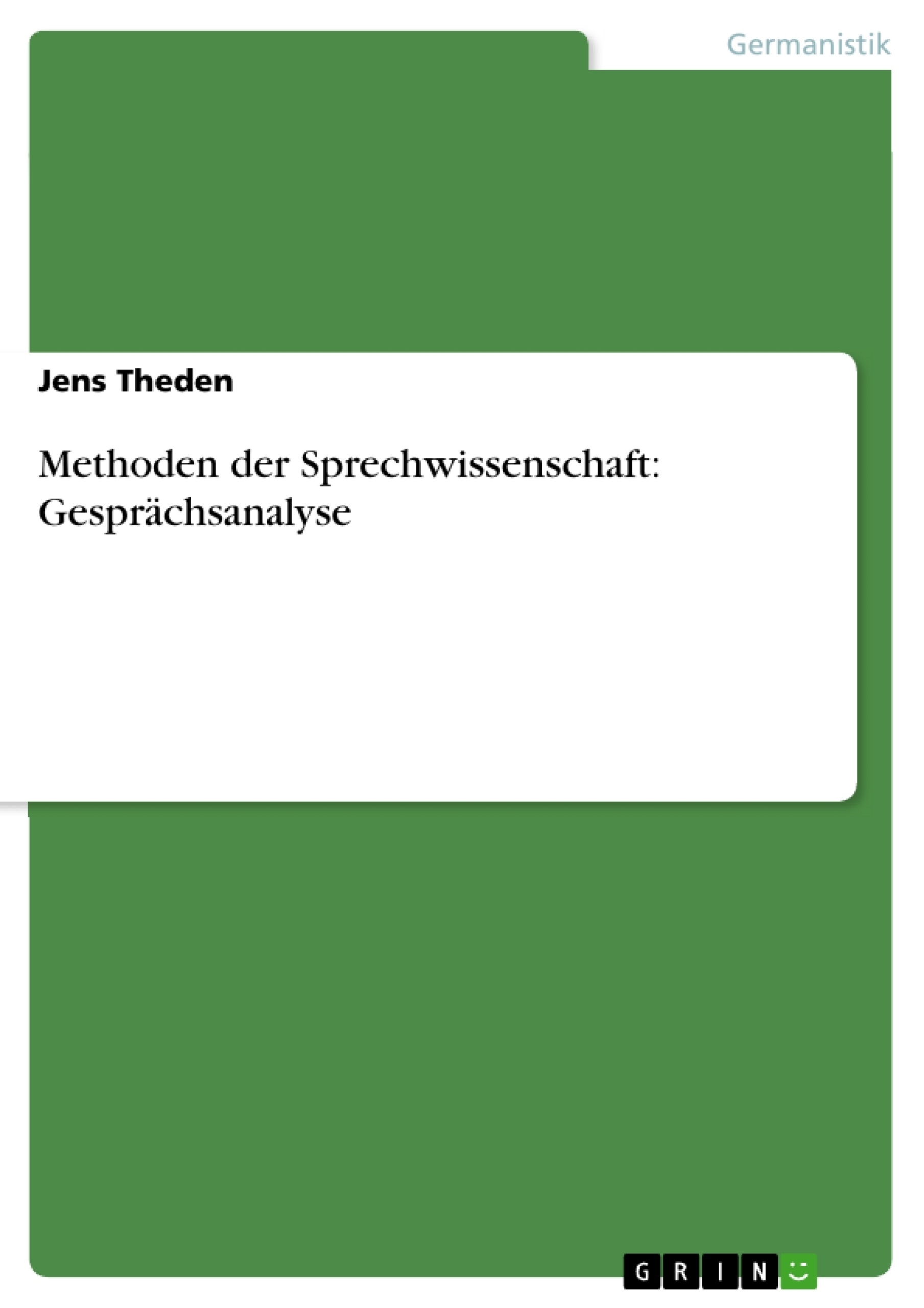Was verraten uns Gespräche wirklich über uns selbst und die Welt, die wir gemeinsam erschaffen? Dieses Buch entschlüsselt die verborgenen Mechanismen alltäglicher Unterhaltungen und eröffnet dem Leser eine faszinierende Perspektive auf die Gesprächsanalyse, ein interdisziplinäres Feld, das linguistische Präzision mit sprechwissenschaftlicher Tiefenschärfe verbindet. Im Zentrum steht die Frage, wie wir durch Sprache Sinn konstruieren, Beziehungen gestalten und soziale Realität verhandeln. Anhand fundierter Methoden, von der Paraphrase und Handlungsbeschreibung bis zur detaillierten Kontextanalyse und der Erforschung interaktiver Konsequenzen, wird der Leser Schritt für Schritt in die Kunst der Gesprächsanalyse eingeführt. Dabei werden sowohl linguistische Merkmale als auch nonverbale Verhaltensweisen berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der kommunikativen Dynamik zu zeichnen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Gesprächsverhaltensschema (GVS), einem Instrument zur systematischen Beobachtung und Auswertung von Gesprächen, das vielfältige Interpretationsansätze ermöglicht. Der Leser lernt, Gesprächsbeiträge zu analysieren, Interaktionsmuster zu erkennen und Hierarchien zu entschlüsseln, die sich im verbalen Austausch manifestieren. Doch dieses Buch geht über die reine Analyse hinaus: Es zeigt, wie die gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden können, um Kommunikationsprozesse zu verbessern, Konflikte zu lösen und ein tieferes Verständnis für die eigenen Gesprächsgewohnheiten und die der anderen zu entwickeln. Es ist somit sowohl für Studierende und Forschende der Sprach- und Kommunikationswissenschaft als auch für Praktiker in den Bereichen Beratung, Therapie und Konfliktmanagement ein unverzichtbarer Leitfaden, um die Macht der Sprache in ihrer ganzen Komplexität zu verstehen und zu nutzen. Tauchen Sie ein in die Welt der Gesprächsanalyse und entdecken Sie die verborgenen Botschaften, die in jedem Wort, jeder Pause und jeder Interaktion stecken. Erfahren Sie, wie Sie Gespräche nicht nur führen, sondern auch verstehen und gestalten können, um erfolgreicher zu kommunizieren und zwischenmenschliche Beziehungen zu vertiefen. Dieses Buch ist Ihr Schlüssel zu einer neuen Dimension des Verstehens, ein Kompass in der komplexen Landschaft menschlicher Interaktion, der Ihnen hilft, sich selbst und andere besser zu verstehen. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten, die in jedem Gespräch verborgen liegen.
Methoden der Sprechwissenschaft: Gesprächsanalyse
Jens Theden
- aus linguistischer Sicht
- Gespräch als Grundeinheit menschlicher Kommunikation; sich über etwas verständigen
- gegenseitiges Anzeigen der Interpretation des Gesagten · Ansatz der GA (Rekonstruktion dieser Interpretation
- Ziel der GA: Prinzipien, nach denen sich Gesprächspartner richten, darstellen
- Analyse nach bestimmten Gesichtspunkten (aus Deppermann 1999):
I. Paraphrase und Handlungsbeschreibung:
- vorläufiges Klarmachen: Worum geht es in der Gesprächspassage? Wer spricht worüber? Wozu dienen die Äusserungen der Gesprächsteilnehmer?
- Welche Art von sprachlicher Handlung wird vollzogen (Frage, Antwort, Stellungnahme, Vorwurf etc.)? Mit welchen Aufgaben oder Anforderungen befassen sich die Interaktanten?
II. Äusserungsgestaltung und Formulierungsdynamik:
- Art und Weise des Sprechens: Welche linguistischen Merkmale kennzeichnen die Äusserungen ? Welche Merkmale und Formen sind besonders auffällig? · Beschreibung des nonvokalen Verhaltens: In welchem Verhältnis stehen vokale und nonvokale Kommunikation?
- Untersuchung der Reihenfolge der Beiträge: Welche Position innerhalb des Beitrags nimmt ein fokales Element ein? Welche besondere Funktion kann diese Position haben?
III. Timing:
- zeitliche Verhältnisse zwischen Äusserungen: Wer spricht wann?
- Sprecherwechsel: Wer folgt auf wen? Wann entsteht Schweigen, wie wird es aufgelöst und interpretiert?
IV. Kontextanalyse:
- Verständnis des Gesagten auf Grund der Gesprächssituation: Was wird als relevanter Kontext aufgerufen? Was geht der fokalen Äusserung bzw. Sequenz voran? An welche Äusserung knüpft die fokale Äusserung an, und welches Verhältnis wird zu ihr hergestellt?
V. Folgeerwartungen:
- Welche Folgeerwartungen sind mit der fokalen Äusserung verbunden? Erlegt sie dem nächsten Sprecher Handlungszwänge auf? Welche Anschlussmöglichkeiten bestehen nach der fokalen Äusserung? Welche Verpflichtungen geht der Sprecher mit seiner Äusserung ein?
VI. Interaktive Konsequenzen:
- Kern der GA, Gesprächsteilnehmer zeigen, wie sie was interpretieren oder verstehen: Vereindeutigen spätere Beitragselemente die Interpretation früherer? Führen sie zu Modifikationen, Korrekturen und Klärungen?
- Wie reagieren folgende Sprecher auf vorangegangene Beiträge? Geben sie zu erkennen, wie sie den Vorgängerbeitrag interpretieren, und wenn ja, welcher Art ist die Interpretation?
- Welchem Interpretationsprinzip, welcher Regel folgt die Reaktion?
- Zeigt der Produzent der fokalen Äusserung an, wie er die Reaktion seiner Gesprächspartner verstanden hat und ob er mit ihr einverstanden ist?
VII. Sequenzmuster und Makroprozesse:
- einzelne Sequenz Gesprächsaufgaben zuordenbar: Mit welchen Teilaktivitäten wird eine Interaktionsaufgabe bearbeitet, was tragen sie zur Aufgabenbewältigung bei? · Welche Funktion hat ein fokales Element jeweils?
- Bildet sich im Gesprächsverlauf eine makroprozessuale Gestalt heraus?
- Analyseziele: ,,Wie" und ,,Wozu" von Gesprächsprinzipien oder -praktiken (Wie und wozu macht der das so oder sagt der das?) Warum und wozu wird gerade in diesem Moment diese Äusserung in dieser Art und Weise gemacht? Zur Lösung welcher (momentaner oder übergeordneter) Aufgaben oder Probleme kann diese Element dienen oder beitragen? Welche Funktionen können sich mit diesem Element verbinden?
Wie bewältigt ein Teilnehmer die Gesprächsaufgabe?
- GA ist Funktionsanalyse: Herstellen von Bezügen und Systematik in den Äusserungen (bzw. dahinterstehenden Prinzipien) und deren Funktionen
- aus sprechwissenschaftlicher Sicht sprechwissenschaftliche Hermeneutik
- Gespräch auf zwei Positionen beruhend, deren Inhaber gemeinsam etwas tun wollen
- Voraussetzung für Gemeinsamkeit: Sinnkonstitution (aus verschiedenen Vorverständnissen)
- Sinn produziert von mind. 2 Individuen durch und in Kommunikation bzw. durch und in Interaktion und Intersubjektivität
- Gespräch besteht aus Sinn produzieren, vermitteln und verstehen · ständiges gegenseitiges Interpretieren
- ,,Sinn ist nicht zu beobachten, sondern zu verstehen." (Geißner 1981, S. 129)
- Ausgangspunkt für sprechwissenschaftliche Hermeneutik: alltägliche Sinnkonstitution nachvollziehen, jedoch mit Methode
- wichtig zu wissen: Hermeneutiker ist zwangsläufig subjektiv
- Begründung: Warum versteht Hermeneutiker so wie er versteht? (· Objektivierung)
GVS
- Instrument zur Gesprächsbeobachtung und -analyse
- soziologischer Hintergrund: Soziogramm von Moreno (kann der GVS-Beobachtung vorausgehen), Gesprächsbeobachtung nach Bales,
- GVS als Grundlage für versch. Interpretationsansätze, universal einsetzbar
- Aufzeichnung von Name, zeitl. Verlauf, verbale Beiträge in Stichpunkten (siehe GVS- Grafik)
- sofortige Auswertung nach Gespräch:
- Auszählen der Gesamtbeiträge (unabhängig von Sprecher) · Aussagen über Beteiligung, Lebhaftigkeit, etc.
- Verteilung der Beiträge auf Einzelne: gleiche Verteilung · gleiche Bemühungen aller Teilnehmer bezugs Aufgabe; ungleichmässige Verteilung · Dominanz · Reihenfolge der Sprecher aufeinander · Beziehungen untereinander (In-Group- Strukturen); Reihenfolge lässt Schlüsse auf evtl. Hierarchien schliessen · Gesprächsbeiträge auf Zeitabschnitte: Wer hat wann wieviel gesprochen? Wer beginnt das Gespräch? Wer beendet es?
- vielfältige weitere Möglichkeiten der Auswertung und Erweiterung des GVS (als Grundlage und Ansatzpunkt der GA)
- direkt nach Gespräch erst Vorauswertung und Vorinterpretation, dann Auswertung und
Besprechen mit gesamter Gruppe: Was kann man daraus lesen? Bieten von
Interpretationsmöglichkeiten, Kopplung mit Feedback, empfohlenes Schema:
- GVS sagt / zeigt Folgendes: ...
- Was sagt die Gruppe dazu?
- Was sagen Sie als Betroffener dazu? · Wollen Sie das verändern?
- Wie wollen Sie das verändern? · Wie kann die Gruppe helfen? · Wie kann ich helfen?
- mögliche Erweiterungen: gewählten Leiter hervorheben, nonverbale Kommunikation, Sitzordnung, Blickkontakte, Anhäufungen oder Wiederholungen bestimmter Verhaltensweisen
- immer nur subjektive Beobachtung möglich, jedoch wird diese durch Auswertung in Gruppe relativiert
- Fazit
- linguistischer Schwerpunkt vor allen auf Rekonstruktion der Gesprächsprinzipien bzw. - praktiken, sprechwisschenschaftlicher auf Sinnerfassung und -interpretation (GVS zielt primär auf Rollenverhalten)
- Kenntnis der linguistisch ausgerichteten Analyse und ihrer Methoden kann
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Methoden der Sprechwissenschaft: Gesprächsanalyse"?
Der Text behandelt Methoden der Gesprächsanalyse (GA) aus linguistischer und sprechwissenschaftlicher Sicht. Er beleuchtet das Gespräch als grundlegende Einheit menschlicher Kommunikation und konzentriert sich auf das gegenseitige Anzeigen der Interpretation des Gesagten.
Welche Analysegesichtspunkte werden nach Deppermann (1999) vorgestellt?
Es werden folgende Gesichtspunkte genannt: Paraphrase und Handlungsbeschreibung, Äusserungsgestaltung und Formulierungsdynamik, Timing, Kontextanalyse, Folgeerwartungen, Interaktive Konsequenzen sowie Sequenzmuster und Makroprozesse.
Was beinhaltet die Paraphrase und Handlungsbeschreibung im Rahmen der Gesprächsanalyse?
Es geht um die vorläufige Klärung des Gesprächsinhalts, die Identifizierung der Gesprächsteilnehmer und deren Aussagen sowie die Bestimmung der Art der sprachlichen Handlung (Frage, Antwort, Vorwurf etc.) und der damit verbundenen Aufgaben.
Was wird unter Äusserungsgestaltung und Formulierungsdynamik verstanden?
Dieser Punkt befasst sich mit der Art und Weise des Sprechens, linguistischen Merkmalen, auffälligen Formen sowie der Beschreibung des nonvokalen Verhaltens und dessen Verhältnis zur vokalen Kommunikation. Zudem wird die Reihenfolge der Beiträge untersucht.
Was ist bei der Analyse des Timings zu beachten?
Es geht um die zeitlichen Verhältnisse zwischen Äusserungen, Sprecherwechsel, Schweigen, dessen Auflösung und Interpretation.
Was bedeutet Kontextanalyse im Rahmen der Gesprächsanalyse?
Es wird das Verständnis des Gesagten aufgrund der Gesprächssituation analysiert, wobei der relevante Kontext, vorangegangene Äusserungen und die Beziehung zur fokalen Äusserung berücksichtigt werden.
Was sind Folgeerwartungen?
Es handelt sich um die Erwartungen, die mit einer Äusserung verbunden sind, ob sie Handlungszwänge für den nächsten Sprecher auferlegt und welche Anschlussmöglichkeiten bestehen.
Was sind interaktive Konsequenzen?
Hier geht es um die Art und Weise, wie Gesprächsteilnehmer das Gesagte interpretieren und verstehen. Spätere Beiträge können frühere Interpretationen vereindeutigen, modifizieren, korrigieren oder klären. Die Reaktionen der Sprecher auf vorangegangene Beiträge zeigen, wie sie diese interpretieren, und folgen bestimmten Interpretationsprinzipien.
Was wird bei Sequenzmustern und Makroprozessen untersucht?
Es wird untersucht, wie einzelne Sequenzen Gesprächsaufgaben zugeordnet werden können und welche Funktion ein fokales Element jeweils hat. Außerdem wird betrachtet, ob sich im Gesprächsverlauf eine makroprozessuale Gestalt herausbildet.
Was ist das Ziel der Analyseprinzipien in Bezug auf Gespräche?
Die Analyse zielt darauf ab, das "Wie" und "Wozu" von Gesprächsprinzipien oder -praktiken zu verstehen, warum eine Äußerung in diesem Moment auf diese Weise gemacht wird und zur Lösung welcher Aufgaben oder Probleme sie beitragen kann.
Was bedeutet Gesprächsanalyse (GA) als Funktionsanalyse?
Es geht um das Herstellen von Bezügen und Systematik in den Äusserungen und den dahinterstehenden Prinzipien sowie deren Funktionen.
Was ist die sprechwissenschaftliche Hermeneutik?
Es ist ein Ansatz, der auf der sprechwissenschaftlichen Sichtweise basiert und das Gespräch als Interaktion zwischen zwei Positionen betrachtet, deren Inhaber gemeinsam etwas tun wollen. Voraussetzung ist die Sinnkonstitution aus verschiedenen Vorverständnissen. Der Sinn wird von mindestens zwei Individuen durch Kommunikation, Interaktion und Intersubjektivität produziert.
Was ist der Ausgangspunkt für die sprechwissenschaftliche Hermeneutik?
Der Ausgangspunkt ist, die alltägliche Sinnkonstitution nachzuvollziehen, jedoch mit einer Methode. Es wird betont, dass der Hermeneutiker zwangsläufig subjektiv ist.
Was ist die GVS (Gesprächsverhaltensskala)?
Die GVS ist ein Instrument zur Gesprächsbeobachtung und -analyse, das auf dem Soziogramm von Moreno und der Gesprächsbeobachtung nach Bales basiert und als Grundlage für verschiedene Interpretationsansätze dient.
Wie wird die GVS angewendet?
Die GVS beinhaltet die Aufzeichnung von Namen, zeitlichem Verlauf und verbalen Beiträgen in Stichpunkten. Nach dem Gespräch erfolgt eine sofortige Auswertung, bei der die Gesamtbeiträge ausgezählt und die Verteilung der Beiträge auf Einzelne analysiert werden.
Welche Interpretationsmöglichkeiten bietet die GVS?
Die GVS ermöglicht Aussagen über Beteiligung, Lebhaftigkeit, Dominanz, Beziehungen untereinander (In-Group-Strukturen) und mögliche Hierarchien. Zudem können Gesprächsbeiträge auf Zeitabschnitte analysiert werden.
Wie wird die GVS in der Gruppe besprochen?
Nach der Vorinterpretation wird die Auswertung mit der gesamten Gruppe besprochen. Es werden Interpretationsmöglichkeiten angeboten, mit Feedback gekoppelt und ein Schema empfohlen, das aufzeigt, was die GVS sagt/zeigt, was die Gruppe dazu sagt, was die Betroffenen dazu sagen und wie Veränderungen angestoßen werden können.
Welche Erweiterungen der GVS sind möglich?
Mögliche Erweiterungen sind die Hervorhebung des gewählten Leiters, die Einbeziehung nonverbaler Kommunikation, die Berücksichtigung der Sitzordnung, Blickkontakte sowie Anhäufungen oder Wiederholungen bestimmter Verhaltensweisen.
Was ist das Fazit des Textes?
Der Text betont, dass der linguistische Schwerpunkt vor allem auf der Rekonstruktion der Gesprächsprinzipien liegt, während der sprechwissenschaftliche Schwerpunkt auf der Sinnerfassung und -interpretation liegt. Die GVS zielt primär auf das Rollenverhalten. Kenntnisse der linguistisch ausgerichteten Analyse können die sprechwissenschaftliche Analyse bereichern, indem die Aufmerksamkeit auf Sprache und Sinnkonstitution verschmelzen und sich ergänzen.
- Arbeit zitieren
- Jens Theden (Autor:in), 2000, Methoden der Sprechwissenschaft: Gesprächsanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97686