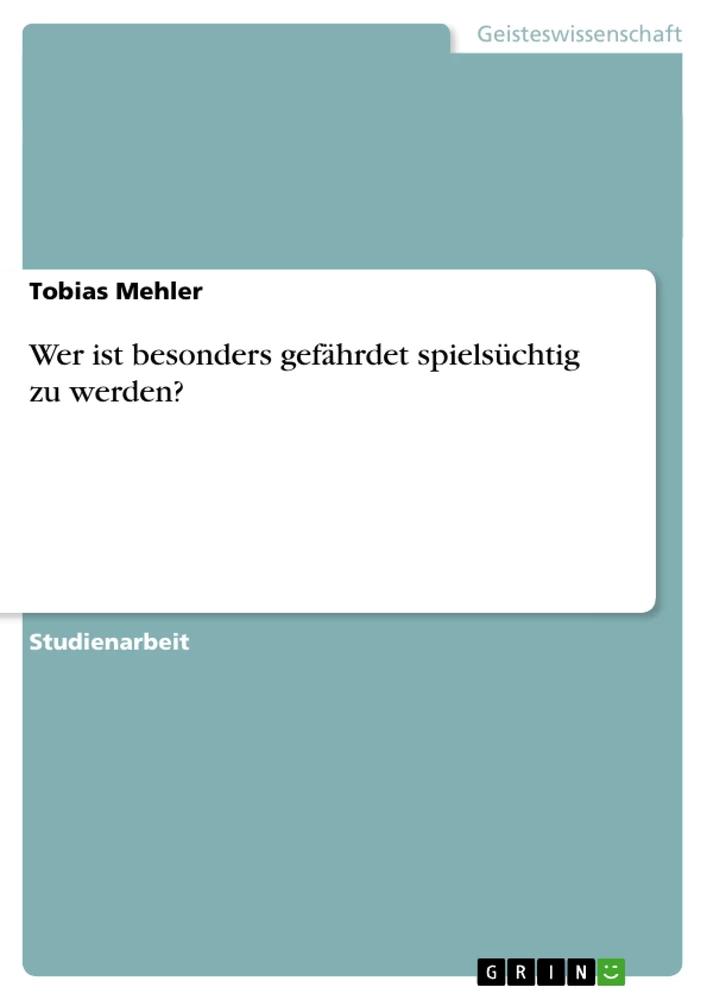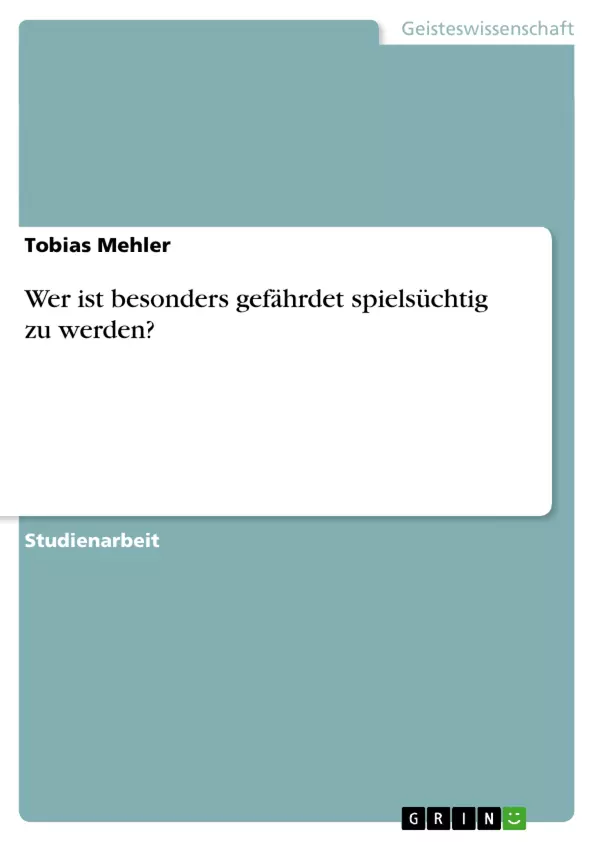Der in der Bevölkerung verankerte Begriff „Spielsucht“ sowie der im klinischen und wissenschaftlichen Kontext gebräuchliche Fachausdruck „pathologisches Spielen“ kennzeichnen ein Erscheinungsbild, das sich folgendermassen beschreiben lässt:
Zentraler Lebensinhalt der Betroffenen ist das Glücksspiel, es dominiert und strukturiert ihr Denken, Fühlen und Handeln. Persönliche Interessen, das soziale Umfeld und berufliche Verpflichtungen werden vernachlässigt.
Nach der nosologischen Zuordnung innerhalb der Klassifikationssysteme psychischer Störungen (ICD-10, DSM-IV) zählt pathologisches Spielverhalten zu den Störungen der Impulskontrolle, die durch destruktives Verhalten infolge unkontrollierbarer Impulse gekennzeichnet sind.
Pathologisches Spielverhalten kann im Rahmen von akuten Lebenskrisen, affektiven
Störungen oder Persönlichkeitsstörungen auftreten.
Der Personenkreis, der besonders gefährdet ist, ein süchtiges Spielverhalten zu
entwickeln, soll mit den unterschiedlichsten Einflussfaktoren innerhalb eines komplexen Systems dargestellt werden. Den vielschichtigen Ursachen süchtigen Spielverhaltens wird das Drei-Faktoren-Modell am ehesten gerecht. Die süchtige Bindung an die Droge Glücksspiel ist nach diesem Modell ein Ergebnis der Wechselwirkungen von Merkmalen des Individuums, der Umwelt sowie der Droge (Tretter 1998). Dieses Modell dient der Integration verschiedener Konstellationen der Anfälligkeit für Drogeneffekte und von Erklärungsansätzen zur Entwicklung einer süchtigen Bindung. Die spezifischen Eigenschaften der drei Faktoren Individuum, Sozialfeld und Glücksspiel stehen miteinander in intensiver Wechselwirkung und wirken sich im Einzelfall in unterschiedlichem Ausmass und unterschiedlicher Kombination aus. Dies kann zu einem mehr oder weniger ausgeprägten süchtigen Spielverhalten führen.
Ein umfassendes Konzept, das die unterschiedlichen Bedingungsfaktoren in einen
widerspruchsfreien theoretischen Erklärungszusammenhang bringt, existiert jedoch
derzeit noch nicht.
Als erstes sollen die Charakteristika spielsuchtgefährdeter Personen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Charakteristika spielsuchtgefährdeter Personen
- 1.1 Persönlichkeitsstruktur
- 1.2 Geschlecht
- 1.3 Genetische und neurobiologische Bedingungen
- 1.4 Angststörungen und affektive Störungen
- 1.5 Soziodemographische Faktoren
- 2. Soziales Umfeld spielsuchtgefährdeter Personen
- 3. Psychotrope Wirkung von Glücksspielen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Faktoren, die zur Spielsucht beitragen. Ziel ist es, den komplexen Zusammenhang zwischen individuellen Merkmalen, sozialem Umfeld und den Eigenschaften des Glücksspiels selbst darzustellen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der verschiedenen Risikofaktoren und deren Wechselwirkungen.
- Persönlichkeitsmerkmale spielsuchtgefährdeter Personen
- Der Einfluss des sozialen Umfelds auf die Entwicklung von Spielsucht
- Die psychotrope Wirkung von Glücksspielen
- Das Drei-Faktoren-Modell der Spielsuchtentstehung
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Spielverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff „Spielsucht“ und „pathologisches Spielen“, beschreibt das zentrale Charakteristikum – die Dominanz des Glücksspiels im Leben Betroffener – und ordnet es nosologisch ein. Sie führt das Drei-Faktoren-Modell ein, welches die Wechselwirkungen zwischen individuellen Merkmalen, Umwelt und der Glücksspieldroge betont, um die vielschichtigen Ursachen zu erklären. Die Einleitung betont die Komplexität des Themas und die fehlende umfassende Theorie.
1. Charakteristika spielsuchtgefährdeter Personen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene individuelle Risikofaktoren für Spielsucht. Es untersucht die Rolle der Persönlichkeitsstruktur, insbesondere die externe Kontrollüberzeugung und Impulsivität, unter Berücksichtigung von Längs- und Querschnittstudien. Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen Impulsivität und Spielsucht, betonen aber die Uneinheitlichkeit der Forschungsergebnisse und die Schwierigkeit, kausale Zusammenhänge zu etablieren. Die Diskussion umfasst auch psychopathologische Auffälligkeiten wie erhöhte Werte auf den Skalen „Psychopathie“ und „Depression“, sowie psychoanalytische Interpretationen, die frühkindliche Störungen und ungelöste ödipale Konflikte als Ursachen hervorheben.
1.1 Persönlichkeitsstruktur: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Persönlichkeitsmerkmale von Spielsüchtigen. Es werden unterschiedliche Studien vorgestellt, die auf einen Zusammenhang zwischen externaler Kontrollüberzeugung, Impulsivität und Spielsucht hinweisen. Gleichzeitig wird auf die Uneinheitlichkeit der Forschungsergebnisse und die Schwierigkeit, kausale Zusammenhänge zu belegen, hingewiesen. Die Bedeutung der Impulskontrolle wird hervorgehoben.
1.2 Geschlecht: Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss des Geschlechts auf Spielverhalten. Männer zeigen traditionell eine höhere Spielneigung, was mit typisch männlichen Attributen wie Machtstreben und Risikobereitschaft erklärt wird. Die zunehmende Emanzipation der Frauen wird als Faktor genannt, der traditionelle Geschlechterunterschiede im Spielverhalten verringert.
Schlüsselwörter
Spielsucht, pathologisches Spielen, Risikofaktoren, Persönlichkeitsstruktur, Impulsivität, externe Kontrollüberzeugung, soziales Umfeld, psychotrope Wirkung, Drei-Faktoren-Modell, Geschlecht, Längsschnittstudie, Querschnittstudie.
Häufig gestellte Fragen zur Spielsucht: Zusammenfassung der Forschungsarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht die Faktoren, die zur Entstehung von Spielsucht beitragen. Sie beleuchtet den komplexen Zusammenhang zwischen individuellen Merkmalen, sozialem Umfeld und den Eigenschaften von Glücksspielen selbst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die verschiedenen Risikofaktoren für Spielsucht und deren Wechselwirkungen darzustellen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Erläuterung des Drei-Faktoren-Modells der Spielsuchtentstehung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Persönlichkeitsmerkmale spielsuchtgefährdeter Personen, den Einfluss des sozialen Umfelds, die psychotrope Wirkung von Glücksspielen, das Drei-Faktoren-Modell und geschlechtsspezifische Unterschiede im Spielverhalten.
Welche Charakteristika spielsuchtgefährdeter Personen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Persönlichkeitsstruktur (insbesondere externe Kontrollüberzeugung und Impulsivität), das Geschlecht, genetische und neurobiologische Bedingungen, Angst- und affektive Störungen sowie soziodemografische Faktoren.
Welche Rolle spielt die Persönlichkeitsstruktur bei der Entstehung von Spielsucht?
Die Forschung zeigt einen Zusammenhang zwischen externaler Kontrollüberzeugung, Impulsivität und Spielsucht. Jedoch bestehen Uneinigkeiten in den Forschungsergebnissen bezüglich kausaler Zusammenhänge. Die Bedeutung der Impulskontrolle wird hervorgehoben.
Wie wird der Einfluss des Geschlechts auf das Spielverhalten betrachtet?
Traditionell weisen Männer eine höhere Spielneigung auf, was mit Machtstreben und Risikobereitschaft erklärt wird. Die zunehmende Emanzipation der Frauen führt jedoch zu einer Verringerung traditioneller Geschlechterunterschiede.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Entwicklung von Spielsucht, jedoch wird der genaue Inhalt dieses Kapitels in der Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben.
Was ist die psychotrope Wirkung von Glücksspielen?
Die Arbeit beschreibt die psychotrope Wirkung von Glücksspielen, jedoch wird der genaue Inhalt dieses Kapitels in der Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben.
Was ist das Drei-Faktoren-Modell der Spielsuchtentstehung?
Das Drei-Faktoren-Modell betont die Wechselwirkungen zwischen individuellen Merkmalen, Umweltfaktoren und den Eigenschaften der Glücksspiele selbst als vielschichtige Ursachen der Spielsucht. Es wird in der Einleitung eingeführt und im Laufe der Arbeit weiter erläutert.
Welche Arten von Studien werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Längs- und Querschnittstudien, um die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren und Spielsucht zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Spielsucht, pathologisches Spielen, Risikofaktoren, Persönlichkeitsstruktur, Impulsivität, externe Kontrollüberzeugung, soziales Umfeld, psychotrope Wirkung, Drei-Faktoren-Modell, Geschlecht, Längsschnittstudie, Querschnittstudie.
- Quote paper
- Tobias Mehler (Author), 2000, Wer ist besonders gefährdet spielsüchtig zu werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97007