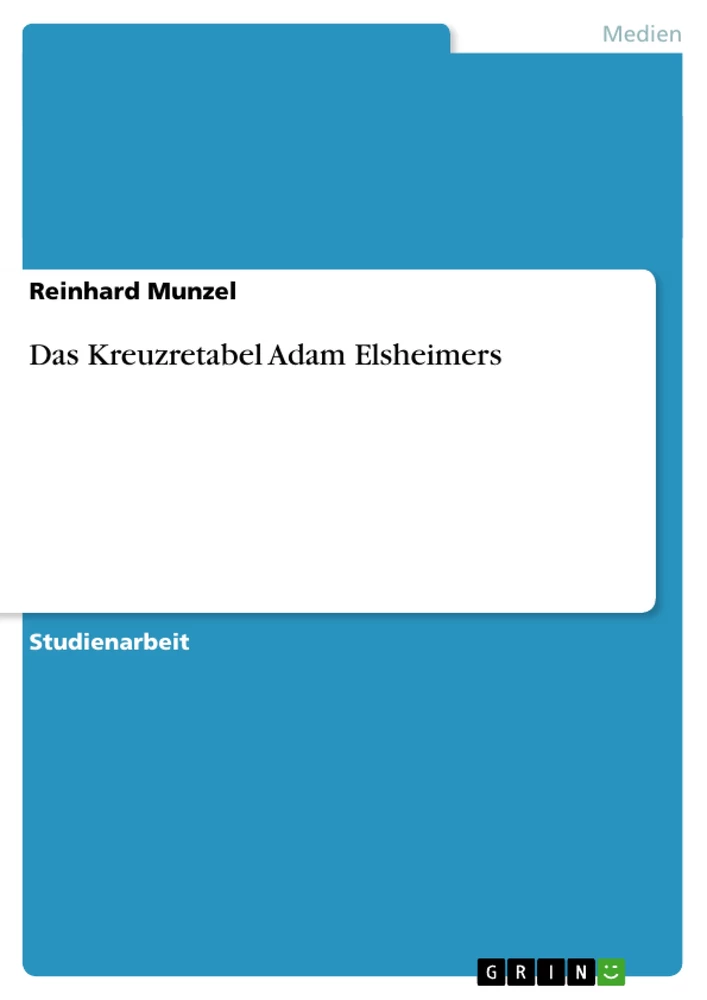Thema: Adam Elsheimer
Die sieben Tafeln des Kreuzaltares
Entstehung:
Für die Entstehung des Kreuzaltares gibt es keine exakte Zeitangabe; Keith Andrews geht von dem Zeitraum zwischen 1603 und 1605 aus, während Gottfried Sello den Zeitraum mit Els- heimers Konvertierung vom protestantischen zum katholischen Glauben (spätestens bei seiner Hochzeit 1606) in Verbindung setzt, da der Inhalt der Bildtafeln von ausgesprochen katholi- schem Inhalt sei. Paul Eich teilt Andrews Meinung, ebenso wie Christian Lenz. Es ist die Auf- tragsarbeit einer Privatperson - die geringen Maße des Werkes machen es für Kirchen oder Klöster uninteressant. Daher wird auch von einem Hausaltar gesprochen. Als Auftraggeber wird der in Rom lebende Spanier Giovanni Perez angesehen, in dessen Besitz sich der Altar im Jahre 1612 befand.
Der Weg von Rom nach Frankfurt:
Der Maler Agostino Tassi entdeckte das Werk 1612 bei Perez und war von seiner Schönheit derart angetan, daß er es in einem Brief Cosimo II., dem Großherzog der Toskana und passio- niertem Sammler zeitgenössischer Kunst empfahl. Dieser beauftragte seinen Gesandten in Rom, den Altar unter Mitwirkung des Malers Lodovico Cigoli in Augenschein zu nehmen. Letzterem erschien er jedoch nicht würdig, der Sammlung des Großherzogs zugeführt zu wer- den und so verblieb er in Rom.
Sieben Jahre später jedoch suchte Cosimo II. unbedingt ein Werk Elsheimers, dessen Ruhm sich seit seinem Tode noch vergrößert hatte. Diesmal hatte der Gutachter keine Einwände und der Altar wurde der Sammlung des Großherzogs eingegliedert. Hier verliert sich die Spur. Erst im Jahre 1927 gelingt der Nachweis seiner Entstehung, und ab 1950 kauft das Städelsche Kunstinstitut in Frankfurt die Bildtafeln auf zum Teil recht abenteuerlichen Wegen nach und nach aus Privatbesitz auf. Da hauptsächlich aus englischen Beständen erworben wurde, wird vermutet, daß sie als Geschenk oder Mitgift einer Medici-Prinzessin in den Besitz der Herzöge von Norfolk gelangt sind. 1981 erwarb das Institut die letzte der sieben Einzeltafeln und ließ den Rahmen rekonstruieren, der anhand eines Briefes des römischen Gesandten an seinen Herren Cosimo II. in seinen Details bekannt war.
Bilderquelle:
Die im späten 13. Jahrhundert von Jacobus de Voragine verfaßte Sammlung von Heiligenle- genden, „Legenda aurea“, enthält das Kapitel, auf der die von Elsheimer dargestellte Suche der Kaiserin Helena nach dem Kreuz Christi basiert. Elsheimer selbst war das Werk höchst- wahrscheinlich unbekannt, es wurde ihm wohl von seinem Auftraggeber zugetragen, der sich vermutlich von einem Geistlichen hinsichtlich der Legendenwahl beraten ließ. Zudem wird vermutet, daß dem Künstler eine weitere Quelle vorlag, da es einige Abweichungen vom ur- sprünglichen Text in der Darstellung auf den Tafeln gibt. Dies kann jedoch auch aus der künst- lerischen Freiheit resultieren, die sich der Maler nahm. Da die „Legenda aurea“ eine späte Quelle ist, die sich auf eine recht beschränkte Auswahl von Urtexten bezieht, und die For- schung auf diesem Gebiet bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, ist noch mit weiteren Er- gebnissen hinsichtlich des tatsächlichen Ursprunges der Darstellung zu rechnen.
Im Anschluß an die Findung wird die Rückführung des Kreuzes nach Jerusalem durch den Kaiser Heraklius geschildert. Es wurde von den Persern bei der Plünderung der Stadt geraubt und gelangte erst nach dem Sieg des Kaisers wieder an seinen ursprünglichen Aufbewah- rungsort.
Das Mittelbild versammelt Gestalten des Alten und Neuen Testamentes um das Kreuz. Die zentrale Bildaussage ist jedoch die oft verkannte Marienkrönung, zu der sich die Darstellungen entwickeln. Hier wird auch die häufig erwähnte Parallele zwischen Helena und Maria deutlich. Beide sind niederer Abkunft (die eine Magd, die andere Schankwirtin), aus welcher Maria zur Gottesmutter, Helena als Mutter Konstantin zur Kaiserin erhöht werden. Eine weiterer Hin- weis ist ein durch die Rede des Kirchenvaters Ambrosius zum Tode des Theodosius 395 be- legtes Selbstgespräch Helenas, in dem sie die Verdienste Mariens um Christus aufzählt und ihr nacheifern möchte.
Das Motiv des Kreuzes ist besonders im Rahmen der zu Anfang des 17. Jahrhunderts einsetzenden Gegenreformation zu sehen, die sich dem Protestantismus widersetzt und sich besonders auf katholische Symbole wie das Kreuz und, damit verbunden, auf seine Findung, Rückführung und Erhöhung konzentriert. Dies ist natürlich für ein in Rom, im Epizentrum des Katholizismus entstandenes Werk ein hervorragender Bildinhalt.
Die Bilddarstellungen im Einzelnen:
Die Abreise
Das erste Segment links des Hauptbildes stellt die Abreise der Kaiserin Helena aus Rom dar. Die in Goldgewänder gekleidete Herrscherin betritt, gefolgt von ihrem Hofstaat, das Schiff, welches sie nach Jerusalem bringen soll. Die prächtige Archi- tektur im Hintergrund entspringt der Phantasie des Malers und soll vom Reichtum der Stadt zeugen. Im Hafen herrscht geschäftiges Treiben, Orientalen sind mit dem Beladen der Schiffe beschäftigt. Als einzige Figur, die, abgesehen von der Kaiserin, in mehreren Bildern zu sehen ist, entdecken wir den „Reisemarschall“ mit dem Federbusch inmitten der geschäfti- gen Seeleute.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Bewegung, die dieses Bild zu vermitteln scheint, entsteht aus einer Öffnung der gedrängten und scheinbar zielgerichte- ten Bewegung der Protagonisten in den diffusen Raum des Hintergrundes. Es entsteht eine Aufbruchstimmung, die her- vorragend mit der Aussage des Bildes einhergeht und sie ü- berzeugend verstärkt. In der diffizilen Ausarbeitung des Hin- tergrundes wird Elsheimers Talent als Landschaftsmaler sehr deutlich sichtbar.
Die Befragung Judas
Zur linken Seite sehen wir den bereits bekannten Reisebegleiter. In der Mitte kniet der durch Befragung und Folter gebrochene Judas, der bereit ist, die Fundstelle des Kreuzes bekanntzugeben. In der „Legenda aurea“ zeigt Judas zusätzlich seine Bereitschaft zur Kooperation, indem er die Röcke schürzt und zum Spaten greift, um bei der Grabung zu helfen. Zur Rechten steht Helena. Sie wird barfuß dargestellt, was wiederum eine Parallele zu Maria vermuten läßt. Helena steht bei dieser Abbildung vor einem verfallenen Torbogen. Die Darstellung dieses Elementes mit dem für römische Bauten typischen Flachziegel zeigt, wie exakt Elsheimer bei der Ausarbeitung der Details seiner Gemälde war.
Die Ausgrabung der Kreuze
Hier offenbart sich, mit welchem Enthusiasmus die Grabungen durchgeführt werden. Rechts steht Helena, begleitet von ihrem Reisebegleiter sowie dem Bischof von Jerusalem, Makarios, und begutachtet den Fortgang der Arbeiten. In der Bildmitte werden zwei jugendliche Männer dargestellt, dahinter wird ein bereits gefundenes Kreuz aus der Grube gezogen.
Die beiden Arbeiter sind für die Komposition des Bildes sehr wichtig, da sie der Darstellung mehr Tiefe und Volumen verleihen. In ihrer Darstellung zwar als abgeschlossene runde Form erkennbar, bilden sie doch den Hochpunkt einer parabelförmigen Bewegung, die im vorheri- gen Bild mit dem knienden Judas begann und die in dem sich aufrichtenden Jüngling der nächsten Tafel ihren Abschluß findet. Anhand von Röntgenbildern ließ sich feststellen, daß Elsheimer die Richtung des Hackenstiels nachträglich korrigierte, um dieser Bewegung mehr Kraft und Bedeutung zu geben. Nach der „Legenda aurea“ sollen die Kreuze in einer Zisterne nahe des Golgotha- felsens gefunden worden sein. Els- heimer geht auf diese Aussage mit der Darstellung römi- scher Gebäudereste ein, welche die logi- sche Fortsetzung der Ruinen der vorheri- gen Tafel bilden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kreuzprobe
Anhand eines Wunders wird das wahre Kreuz Christi identifiziert. Die Berichte der Legenden sind unterschiedlich. Einmal ist es, wie Elsheimer es zeigt, ein Jüngling, der durch die Berüh- rung des Kreuzes zum Leben erweckt wird, ein andermal wird eine todkranke Frau geheilt. Einer dritten Version zufolge identifiziert es der anwesende Bischof Makarios anhand der In- schrift „INRI“.
Einem zeitgenössischen Bericht zufolge sollen alle heiligen Stätten Jerusalems unter Hadrian mit heidnischen Tempeln überbaut worden sein. Dieser Theorie versucht Elsheimer Folge zu leisten, indem er die Handlung in einen geschlossenen Raum verlegt. Die Architektur wird anhand einer großen Säule links und der durch Pilaster gegliederten Wand im Hintergrund sichtbar. Zudem ist eine Frauenstatue in einer Wandnische dargestellt, welche die heidnische Göttin Venus symbolisiert. Dies wird anhand einer anderen Darstellung der Kreuzprobe durch Procacini deutlich, der bei seinen Wandmalereien im Chor der Chiesa di Santa Croce, Riva San Vitale, Venus explizit hervorhebt. Das Motiv des Jünglings, der sich an die Säule links klammert, hat Elsheimer vermutlich von Raphael übernommen.
Die R ü ckf ü hrung des Kreuzes
Hier zeigt Elsheimer, deutlich abgegrenzt von den vorhergehenden Motiven, die Rückführung des Kreuzes durch den Kaiser Heraklius. Als er es zu dem Bestimmungsort bringen will, dem Kalvarienberg vor der Stadt, wird er durch eine göttliche Erscheinung aufgehalten, die außer dem Kaiser keiner aus seinem Gefolge bemerkt. Hier streiten die Quellen, ob es sich um den bei der Kreuzprobe anwesenden Makarios oder den in der Gefangenschaft der Perser gestor- benen Bischof Zacharias handelt, der zur Zeit des Raubes in Jerusalem Kirchenoberhaupt war. Dem Maler gelingt es, durch das drängende, vorwärts treibende Element des Pferdes, dessen Kopf schon fast dem Bild entschwindet, viel Bewegung in das Bild zu bannen. Die zentrale Person ist der Kaiser (wohl auch aus Elsheimers Detailliebe heraus), während die eigentliche Hauptaussage, die Erscheinung, scheinbar in die Ecke gedrängt ist. In der Darstellung der kostbaren Gewänder zeigt sich die genaue und harmonische Arbeit des Künstlers.
Der Auszug
Heraklius, durch die Erscheinung zur Bescheidenheit gemahnt, zieht barfüßig und ohne Kopfbedeckung aus der Stadt Jerusalem aus. Ihm hinterdrein schreitet sein Gefolge, allen voran der Bischof Modestus mit dem kaiserlichen Turban in den Händen. Andächtig stehen die Bewohner am Straßenrand, nur spielende Kinder werden von ihrer Mutter zur Aufmerksamkeit gemahnt. Die Bedeutung, die die Rückführung für den katholischen Glauben hatte, zeigt sich in der Tatsache, daß der Feiertag (Tag der Kreuzerhöhung, 14. September), der aus diesem Anlaß eingeführt wurde, auch heute noch begangen wird.
Die geschickte Anordnung der Figuren in diesem und dem vorhergehenden Bild betont die Abgrenzung der beiden Legenden voneinander und macht deutlich, daß zwei Jahrhunderte zwischen den Geschehnissen liegen. Wiederum zieht der Kaiser von links nach rechts, weg von den anderen Darstellungen des Altars. Das im Hintergrund sichtbare Ziegelmauerwerk wirkt wie eine Korona, die um das Haupt des Herrschers liegt.
Die Erh ö hung des Kreuzes
Auf dem Mittelbild erkennen wir in Versammlung um das Kreuz Gestalten des Alten und Hei- lige des Neuen Testamentes. Im Vordergrund sind parabelförmig die Märtyrer und Bekenner der Kirche angeordnet. Im Hintergrund sehen wir die Väter des Alten Testaments. Um nur einige Personen herauszugreifen, ist rechts im Bild der heilige Georg zu erkennen, darunter Laurentius mit dem Rost als Zeichen seines Martyriums und Stephanus. Einige Historiker se- hen jedoch in der Georgsfigur den Auftraggeber des Bildes, da dessen Darstellung in religiö- sen Gemälden dieser Zeit durchaus üblich war. Der spärlich bekleidete Eremit ist Kardinal Hy- ronimus. Die Frauen in der Bildmitte stellen die Märtyrerin Katharina sowie die heilige Maria Magdalena dar, die zur Identifikation das Salbgefäß in den Händen hält. Bei den dunklen Ka- puzengestalten handelt es sich um die Ordensväter Benedikt, zu erkennen an seiner schwarzen Habit, und Franz von Assisi. Hinter dem heiligen Georg ist der Prophet Jonas auf dem Wal- fisch zu sehen, in einer Gruppe vereint mit König David mit der Harfe und einem jungen Mann mit einem Stock in der Hand, bei dem es sich vermutlich um Aaron handelt. Links des Kreuzes sind die Apostel und Evangelisten zu erkennen. Rechts oben sind Adam und Eva dargestellt, im Lichtkreis am oberen Bildende ist die Marienkrönung zu sehen, die darü- berschwebende Taube ist einer unsachgemäßen Reinigung zum Opfer gefallen.
Es liegt nahe, nach Vorbildern für Elsheimers Darstellung der Marienkrönung zu suchen; hierzu bieten sich beispielsweise Tintorettos „Paradiso“ oder Rottenhammers „Assumptio Mariae“ an. Diese Werke unterscheiden sich jedoch deutlich von diesem. So ist es Elsheimer gelungen, durch die ineinanderlaufenden, raum- greifenden Parabeln Dynamik in das Bild zu bringen, die den Vorgängerwerken fehlt. Die Trennung zwischen Altem und Neuem Testa- ment verstärkt sich durch die von ihm gerne genutzte Verschattung der Personen an der Trennlinie. Die harmonische Komposition der Parabeln umschlingt das Kreuz als Symbol Christi auf Erden wie einen Markierungspunkt, ein Magnet, der den Strom der Kirchenheiligen in eine Richtung lenkt, welche die Marienkrö- nung und die Darstellung Gottes und seines Sohnes zum Ziel hat, ebenso leiten einige „Pfei- le“, wie z.B. der Stab Aarons rechts des Kreuzes oder die Lichtstrahlen, die Blicke des Betrach- ters auf diesen Punkt. Der Bildinhalt zeigt letzt- lich auch die Erlösung der Menschheit durch Jesus, der auf Erden seinen Leib gab, um die Menschen zurück zu Gott und in das Himmel- reich zu führen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Parallelen:
Am Kreuzaltar sind einige Gemeinsamkeiten zu dem von Elsheimer noch in Frankfurt geschaffenen Marienaltar (z. Zt. in Berlin) erkennbar. Neben der ähnlichen Systematik der Darstellung der Lebensstationen Mariens fällt besonders der Aufbau des Zentralbildes ins Auge. Wieder ist das Bild deutlich mit Hilfe einer Schattenlinie in Vorder- und Hintergrund getrennt, allerdings ist der Aufbau noch wesentlich mehr gestapelt als beim Kreuzaltar. Auch die Anordnung der Tafeln ist etwas verändert worden. Es handelt sich jedoch ebenfalls um einen Hausaltar, der für eine Privatperson geschaffen wurde.
Kopien:
Der Kreuzaltar wurde in seiner Gesamtheit nicht kopiert, einzelne Tafeln jedoch fanden ihre Nachahmer. So ist eine Reproduktion des Mittelbildes aus dem Jahre 1642 bekannt, es ent- stand vermutlich im süddeutschen Raum. Ebenso existiert eine Zeichnung der Grabung, wel- che als Vorlage für ein Gemälde diente (zu erkennen an den durchstoßenen Konturlinien der Figuren). Da jedoch bereits die geänderte Stellung der Hacke dargestellt wird, ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß es sich um eine Zeichnung Elsheimers handelt.
Abschlie ß endes:
Elsheimer hat mit diesem Altar ein Werk geschaffen, mit welchem er sich deutlich von den Malern seiner Zeit abhebt. Die Dynamik seiner Bilder, besonders im Zentralbild, unterscheidet sich erheblich von den statischen Werken seiner Vorgänger. Hier geht Elsheimer neue Wege. Trotz seiner kurzen Schaffenszeit ist es ihm gelungen, einigen Einfluß auf die Arbeit der kommenden Generationen zu nehmen. Seine Gemälde überwältigen den Betrachter durch ihre tiefe Religiosität, obwohl es sich um kleine Formate handelt, ist die Detailfülle erstaunlich. Insbesondere die Verknüpfung der Inhalte des Alten und Neuen Testamentes im Zentralbild ist ihm hervorragend gelungen. Die in den Himmel aufgenommene Maria ist Symbol des Ein- tritts des Menschen in die göttlichen Hemisphären. Im Gegensatz zu anderen Malern verfällt Elsheimer nicht dem Reiz der Apokalypse, welche ob ihrer Dramatik sicher eine größere An- ziehung ausübt, sondern schafft ein Werk, das Trost spendet und die Menschen hoffen läßt.
Literaturverzeichnis:
- Andrews, Keith: Adam Elsheimer; dtsch. Ausgabe München 1985
- Drost, Dr. Willi: Adam Elsheimer; Potsdam 1933
- Eich, Paul: Das Kreuzretabel Adam Elsheimers aus: Spiegelungen; Mainz 1986
- Grotefund, Dr. H.: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 1960
- Lenz, Christian: Adam Elsheimer; Frankfurt 1977
- Sello, Gottfried: Adam Elsheimer; München 1988
- Städel-Jahrbücher; Frankfurt 1973 und 1983
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text über Adam Elsheimers Kreuzaltar?
Der Text befasst sich mit Adam Elsheimers Kreuzaltar, insbesondere mit seiner Entstehung, dem Weg von Rom nach Frankfurt, den Quellen der Bilddarstellungen und einer detaillierten Beschreibung der einzelnen Bildtafeln. Es werden auch Parallelen zu anderen Werken Elsheimers, Kopien des Altars und eine abschließende Bewertung seiner Bedeutung gegeben.
Wann und wo entstand der Kreuzaltar?
Es gibt keine exakte Zeitangabe für die Entstehung. Schätzungen datieren ihn zwischen 1603 und 1605. Er entstand in Rom im Auftrag einer Privatperson, vermutlich dem in Rom lebenden Spanier Giovanni Perez.
Wie gelangte der Kreuzaltar von Rom nach Frankfurt?
Der Maler Agostino Tassi entdeckte das Werk 1612 in Rom. Cosimo II., der Großherzog der Toskana, versuchte zunächst, es zu erwerben, was jedoch scheiterte. Erst später, nach Elsheimers Tod, gelangte der Altar in die Sammlung des Großherzogs. Im 20. Jahrhundert wurden die Bildtafeln nach und nach vom Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt aus Privatbesitz erworben.
Welche Quelle diente als Grundlage für die Bilddarstellungen?
Die Bilddarstellungen basieren auf dem Kapitel der „Legenda aurea“ von Jacobus de Voragine, in dem die Suche der Kaiserin Helena nach dem Kreuz Christi beschrieben wird. Es wird jedoch vermutet, dass Elsheimer eine weitere Quelle vorlag, da es einige Abweichungen vom ursprünglichen Text gibt.
Was zeigen die einzelnen Bildtafeln des Kreuzaltares?
Die Bildtafeln zeigen verschiedene Szenen im Zusammenhang mit der Findung des Kreuzes Christi durch die Kaiserin Helena: Die Abreise der Kaiserin aus Rom, die Befragung Judas, die Ausgrabung der Kreuze, die Kreuzprobe (Identifizierung des wahren Kreuzes), die Rückführung des Kreuzes durch Kaiser Heraklius, der Auszug des Kaisers aus Jerusalem und die Erhöhung des Kreuzes (Versammlung von Gestalten des Alten und Neuen Testamentes um das Kreuz).
Welche Bedeutung hat das Mittelbild des Kreuzaltares?
Das Mittelbild versammelt Gestalten des Alten und Neuen Testamentes um das Kreuz. Die zentrale Bildaussage ist jedoch die Marienkrönung, zu der sich die Darstellungen entwickeln. Es werden Parallelen zwischen Helena und Maria gezogen.
Welche Rolle spielt das Kreuz im Kontext der Gegenreformation?
Das Motiv des Kreuzes ist besonders im Rahmen der zu Anfang des 17. Jahrhunderts einsetzenden Gegenreformation zu sehen, die sich dem Protestantismus widersetzte und sich besonders auf katholische Symbole wie das Kreuz konzentrierte.
Gibt es Parallelen zu anderen Werken Elsheimers?
Es gibt einige Gemeinsamkeiten zu dem von Elsheimer noch in Frankfurt geschaffenen Marienaltar, insbesondere im Aufbau des Zentralbildes und der Anordnung der Tafeln.
Wurde der Kreuzaltar kopiert?
Der Kreuzaltar wurde in seiner Gesamtheit nicht kopiert, einzelne Tafeln jedoch fanden ihre Nachahmer. Es gibt eine Reproduktion des Mittelbildes und eine Zeichnung der Grabung.
Welche Bedeutung hat Adam Elsheimer als Künstler?
Elsheimer hat mit dem Kreuzaltar ein Werk geschaffen, mit welchem er sich deutlich von den Malern seiner Zeit abhebt. Die Dynamik seiner Bilder, besonders im Zentralbild, unterscheidet sich erheblich von den statischen Werken seiner Vorgänger. Seine Gemälde überwältigen den Betrachter durch ihre tiefe Religiosität und Detailfülle.
- Arbeit zitieren
- Reinhard Munzel (Autor:in), 1996, Das Kreuzretabel Adam Elsheimers, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96738