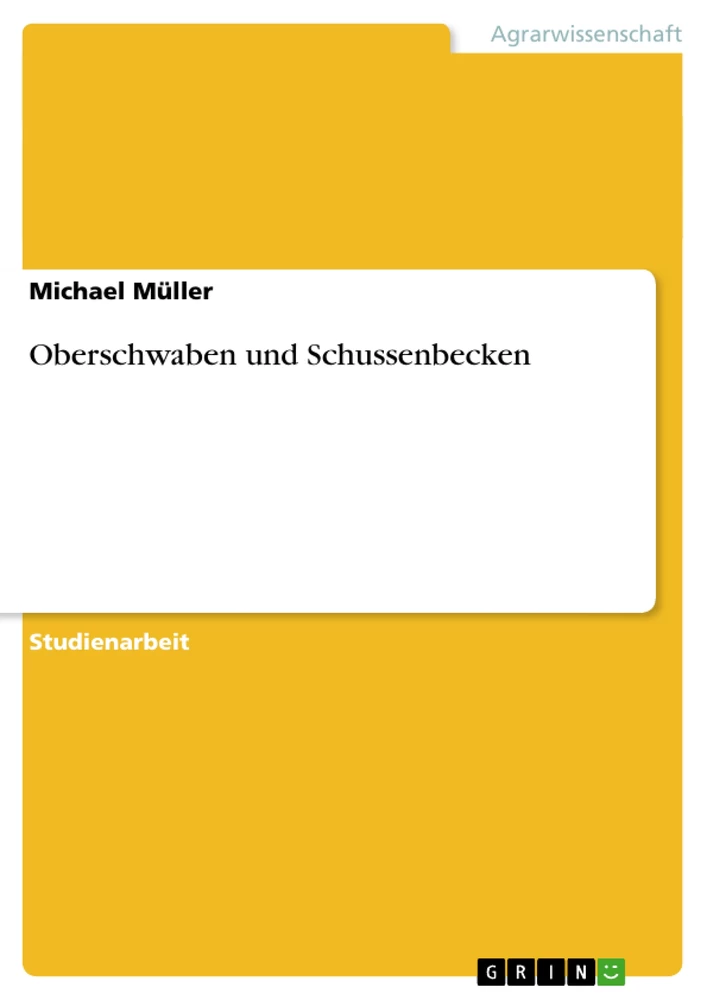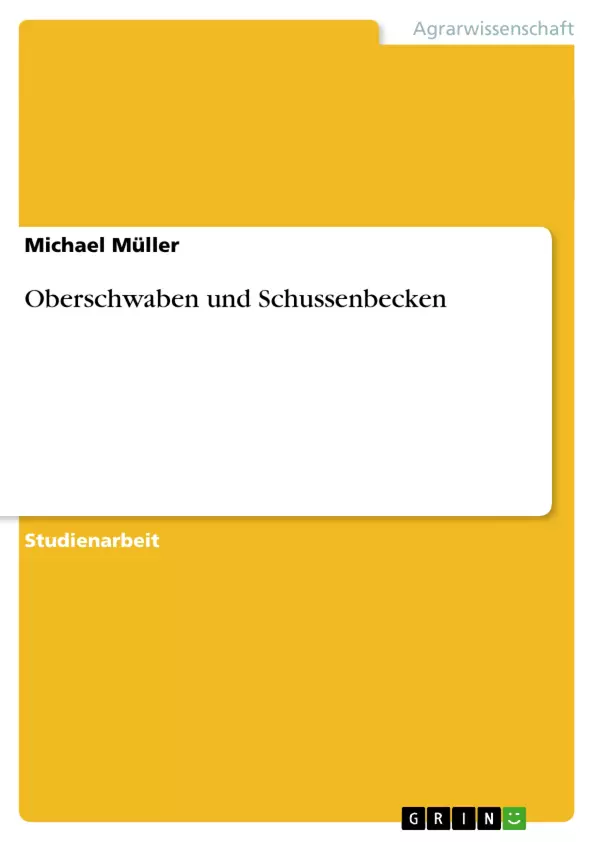1. Einführung:
1.1Klima: Die Jahresdurchschnittswerte bezogen auf die Temperatur und den Niederschlag werden unterteilt in Schussenbecken (vom Bodensee her sich langsam nach Norden verengend über Ravensburg bis nach Aulendorf etwa) und in hähere Lagen (umfaßt nahezu das ganze Gebiet drumherum wie z.B. Horgenzell, Wilhelmsdorf, Waldburg, Altdorfer Wald, Leutkirch, Isny etc.). hähere Lagen: Schussenbecken:
Niederschlag: bis 1200 mm bis 980 mm Temperatur: 7,2øC 8,3øC
Generell stark Fähnbeeinflußt mit hoher Luftfeuchtigkeit, sowie durch den Bodensee Seewinde (Luftströmungen die durch die unterschiedliche Erwärmung von Wasseroberfläche und Erdoberfläche hervorgerufen werden und durch den Luftmassenaustausch in Bewegung gebracht werden).
1.2 Zum Wasser: Im Norden etwa auf der Kreisgrenze zu Biberach verlaufend ist eine wichtige europäische Hauptwasserscheide, die die Wasserströme teilen und nördlich zur Donau hinführen und südlich hauptsächlich durch Argen, Schussen und Rotach zum Bodensee und somit zum Rhein hinführen.
1.3 Zur geographischen Charakteristik: Begrenzung im Osten durch den Allgäu, um im Süden durch den Bodensee. Die Landschaft ist weiterhin durch starke Höhenunterschiede gekennzeichnet von 413 m in der Schussenniederung (etwa auf Höhe von Meckenbeuren), über 773 m auf der Waldburg, 883 m auf dem Höchsten und bis zu 1118 m auf dem Adelegg (an der südöstlichen Landesgrenze zu Bayern).
1.4 Wald: Teilweise noch großflächig erhaltene Wälder wie der Tettnanger Wald oder der Altdorfer Wald, der mit 7000 ha zur größten zusammenhängenden Waldfläche Oberschwabens gehört.
1.5 Landwirtschaft: Aufgrund von Parabraunerden auf der zumeist Oberen Süßwassermolasse durchschnittliche Verhältnisse mit sehr viel Obstanbau und hauptsächlich im Bereich Tettnang Hopfenanbau (was erst durch das Bodenseeklima ermöglicht wird).
2. Das Pfrunger Ried (als Beispiel für die Entstehung von Mooren nach der letzten Eiszeit)
Das Pfrunger Ried ist mit einer Ausdehnung von ca. 9 km auf 3 km das zweitgrößte Moor in Südwestdeutschland. Von einer fläche von ca. 2600 ha sind etwa 780 ha als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt dort 7øC und der Jahresdurchschnittsniederschlag 850 mm (diese Werte beziehen sich etwa auf 1988). Durch die klimatischen Gegebenheiten handelt es sich also um einen Grenzbereichsstandort für Hochmoore. Es liegt auf etwa 610 m Hähe und begann seine Entwicklung zum jetzigen Hochmoor vor etwa 14000 Jahren (d.h. 12000 Jahre v. Chr.)
2.1 geologischer Hintergrund: (die Entstehung eines Gletscherstausees)
Die im Tertiär geformte Landschaft wurde in der Früheiszeit durch den von den Gletschern und Schmelz-wassern aus dem Alpenraum verfrachteten "Vorstoßschottern" stark verändert,da sie die Täler mit Geröll und Schutt verfüllten.
In der Zwischeneiszeit (Interglazial) erfolgte dann eine Reliefumkehr: Im Interglazial waren die klima-tischen Verhältnisse in etwa so wie heute; zu dieser Zeit wurden die eiszeitlichen Schotter durch Kalk-umlagerung zu Konglomeraten oder eiszeitlichen Nagelfluh verbacken. Dieses Material war fester als das Material was vorher die Seiten der Täler bildete (es handelte sich zumeist um tertiäre Sandberge) um somit konnte das Konglomerat einem folgenden Eisschub widerstehen und die tertiären Sandberge wurden aus-geräumt.
In der Mitte der Würm-Kaltzeit stößt eine Rheingletscherzunge bis Ostrach vor und erreicht dort ihre Maxi-malausdehnung. Der mitgeführte Gletscherschutt verschließt als Endmoräne das Tal. Diese bildete somit die nordwestliche Begrenzung für das noch entstehende Ried. Zur Bildung einer Endmoräne: Wenn ein Gletscher seine Maximalausdehnung erreicht hat so schmilzt er vorn und hinten kommt immer neues Eis hinzu. D.h. Schmelzen und neues gleichen sich aus und somit "steht der Gletscher praktisch auf der Stelle"
Durch das ständige Abschmelzen vorn werden immer die im Eis befindlichen Gesteinsbrocken an der Abschmelzstelle abgelagert. Diese ist dann die Würm I Endmoräne.
Derselbe Vorgang wiederholt sich in der Spätphase der Würm-Kaltzeit und dadurch entsteht bei Wilhelmsdorf eine weitere Endmoräne die Würm II Endmoräne. Zwischen den beiden Moränen kann sich das Schmelzwasser in einer Art Talsperre sammeln und das führt zum Aufstau des "Pfrungener Ursees".
2.2 Entstehung eines Moores in Oberschwaben (Pfrunger Ried)
Etwa 10000 v. Chr.: Unter den eiszeitlichen Sedimentschichten die hier ca. 70 m dick sind liegt tertiärer Pfohsandboden; dabei handelt es sich um mit Kalk verfestigte, knorrige und lagige Sandpartien, die in Aufschlüssen als Gesimse herauswittern. Auf der eiszeitlichen Sedimentschicht eingebettet in einen Gletscherstausee lagern sich See- und Beckentone aus den Trübstoffen der Gletschermilch in Form von einer Bänderung ab. Diese unter-schiedliche Bänderung spiegelt die unterschiedliche Sommer- und Wintersedimentation wieder. Den Lebenskreislauf eröffneten Algen.
Etwa 7000 v. Chr.: Es entsteht ein nährstoffarmer See, auf dessen Grund amorphe (d.h. form- und ge-staltlos) Seekreide oder "Kalkmudde" sedimentiert. Dieses fällt aus, wenn Wasserpflanzen Photosynthese betreiben: für die Photosynthese benötigen sie Kohlendioxid, das sie dem Calciumhydrogencarbonat entziehen; das Abfallprodukt dabei ist Seekreide. Auch mehr Nährsalze wurden durch Zooplankton (z.B. durch Armleuchteralge) eingebracht. Die Ablagerungen sind häufig durchsetzt von Ton- und Pflanzenbestandteilen sowie Schnecken- und Muschelschalen.
Etwa 5000 v. Chr.: Aus dem nährstoffarmen See ist ein nährstoffreicher See geworden. Dabei wird der Sauerstoffvorrat im Wasser aufgebraucht, so daß pflanzliche oder tierische Rückstände nicht mehr oder nur noch teilweise abgebaut werden können. Diese lagern sich dann als gallertartige Substrat - als Lebermudde oder Faulschlamm - auf dem Grund ab. Die Lebermudde gibt in diesen Zustand noch Faulgase und Nährstoffe ab. Der See ist übernährt d.h. eutroph. Das hat zur Folge, daß der See vom Seegrund und vom Ufer her zuwächst. Zur Verfüllung tragen auch hähere Tiere wie z.B. Mollusken, Amphibien und Fische bei.
Etwa 4000 v. Chr.: Der ursprüngliche See ist zugewachsen und verlandet. Es handelt sich jetzt um ein Flach- bzw. Niedermoor mit Sauergräsern, Orchideen, Seggen, Simsen und Seerosen: der Grundwasserspiegel ist hoch. Pfeifengraswiesen siedeln sich an, die wiederum die Grundlage für Bäume (in Form des Birkenbruchwaldes) bilden. Die Mineralstoffzufuhr aus der Umgebung ist gering.
Von 4000 v. Chr bis 1600 n. Chr.: Es hat sich ein Hochmoor entwickelt. Ein Rest von Wasser hat sich in einem Hochmoorkolk gesammelt. Das Hochmoor wir immer nährstoffärmer d.h. oligotroph. Es wachsen nur noch Torf- und Bleichmoose. Die Wachstumsvorraussetzungen sind schlecht: es ist sauerstoffarm, sauer (pH-Wert von 3!) und feucht. Die Torf- und Bleichmoose reichern sich im Boden als Torf an, dadurch entsteht die uhrglas-förmige Aufwölbung - ein typisches Merkmal für Hochmoore. Das Wasser wird immer knapper und auch die Moose brechen ihr Wachstum ab: es stellt sich eine Verheidung als eine der letzten Sukzessionsstufen mit Bergkiefern ein.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die klimatischen Unterschiede zwischen dem Schussenbecken und den höheren Lagen in der Region?
Im Schussenbecken beträgt der Jahresdurchschnittsniederschlag bis zu 980 mm und die Durchschnittstemperatur 8,3°C. In den höheren Lagen liegt der Jahresdurchschnittsniederschlag bei bis zu 1200 mm und die Durchschnittstemperatur bei 7,2°C.
Welche Rolle spielt der Bodensee für das Klima der Region?
Der Bodensee verursacht Seewinde (Luftströmungen, die durch unterschiedliche Erwärmung von Wasser- und Erdoberfläche entstehen) und beeinflusst das Klima durch hohe Luftfeuchtigkeit.
Wo verläuft die europäische Hauptwasserscheide in der Region?
Die Hauptwasserscheide verläuft im Norden, etwa auf der Kreisgrenze zu Biberach. Nördlich davon fließen die Wasserströme zur Donau, südlich zum Bodensee (über Argen, Schussen und Rotach).
Wie sind die Höhenunterschiede in der Region beschaffen?
Die Höhenunterschiede sind erheblich: von 413 m in der Schussenniederung bis zu 1118 m auf dem Adelegg.
Welche großen Waldgebiete gibt es in der Region?
Es gibt großflächig erhaltene Wälder wie den Tettnanger Wald und den Altdorfer Wald (mit 7000 ha die größte zusammenhängende Waldfläche Oberschwabens).
Welche landwirtschaftlichen Besonderheiten gibt es in der Region?
Aufgrund von Parabraunerden auf der Oberen Süßwassermolasse gibt es viel Obstanbau, und im Bereich Tettnang wird Hopfen angebaut (bedingt durch das Bodenseeklima).
Was ist das Pfrunger Ried?
Das Pfrunger Ried ist mit etwa 9 km x 3 km das zweitgrößte Moor in Südwestdeutschland. Etwa 780 ha von 2600 ha sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Wo liegt das Pfrunger Ried und wie sind die klimatischen Bedingungen dort?
Das Pfrunger Ried liegt auf etwa 610 m Höhe. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt dort 7°C und der Jahresdurchschnittsniederschlag 850 mm.
Wann begann die Entwicklung des Pfrunger Rieds zum Hochmoor?
Die Entwicklung begann vor etwa 14000 Jahren (12000 v. Chr.).
Wie entstand der Gletscherstausee, der zur Entstehung des Moores beitrug?
In der Früheiszeit wurden Täler mit Geröll und Schutt verfüllt. In der Zwischeneiszeit wurden eiszeitliche Schotter zu Konglomeraten verbacken. Eine Rheingletscherzunge erreichte in der Würm-Kaltzeit Ostrach und verschloss als Endmoräne das Tal. Schmelzwasser sammelte sich zwischen den Endmoränen und staute den "Pfrungener Ursee" auf.
Welche Sedimentschichten liegen unter dem Moor?
Unter den ca. 70 m dicken eiszeitlichen Sedimentschichten liegt tertiärer Pfohsandboden.
Wie erfolgte die Entwicklung vom See zum Moor?
Zuerst entstand ein nährstoffarmer See, dann ein nährstoffreicher See mit Ablagerung von Lebermudde. Der See verlandete und wurde zu einem Flach- bzw. Niedermoor. Schließlich entwickelte sich ein Hochmoor mit Torfmoosen.
Wie wurde das Pfrunger Ried durch den Menschen beeinflusst?
Ab dem 17. Jahrhundert wurde Torf abgebaut. Heute ist das Gebiet Naturschutzgebiet und wird renaturiert.
Welche seltenen Arten sind im Pfrunger Ried erhalten?
Es sind seltene Lebensräume für Sonnentau, Wasserschlauch, viele Insekten-, Vogel- und Pflanzenarten erhalten worden.
- Arbeit zitieren
- Michael Müller (Autor:in), 2000, Oberschwaben und Schussenbecken, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96207