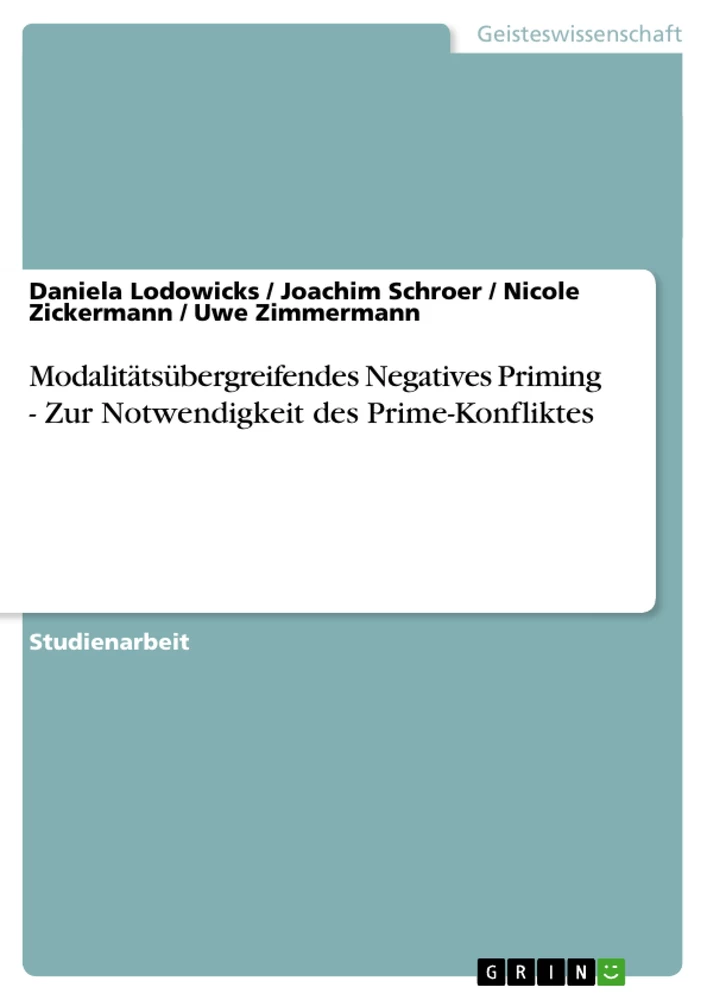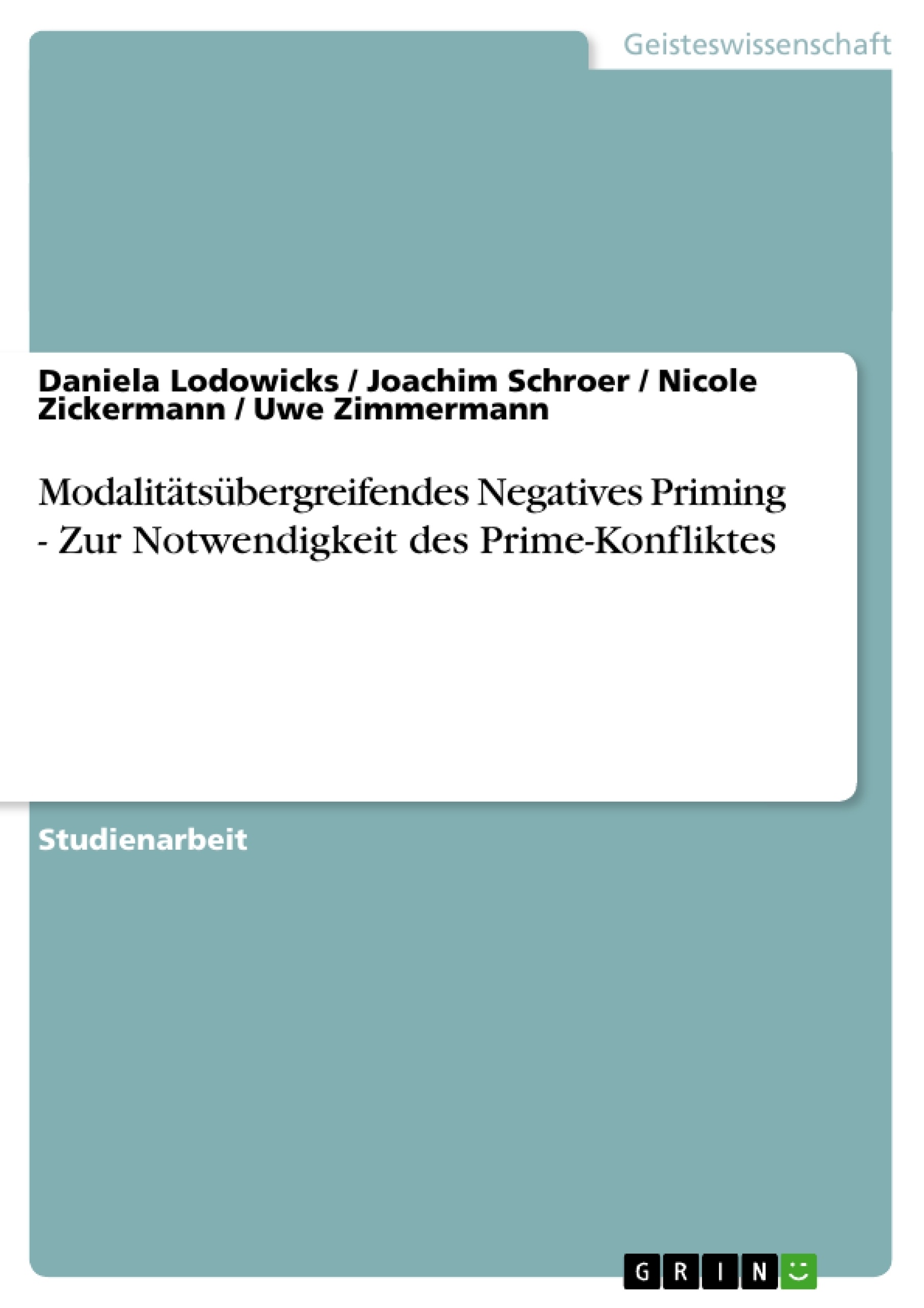Inhalt
Zusammenfassung
1. Einleitung
2. Theorien zum Negative Priming
2.1 Inhibitionstheorien
2.2 Episodic Retrieval
2.3 Negative Priming ohne mismatching
2.4 Fragmentarische Verarbeitung
3. Operationalisierung
3.1 Unabhängige und abhängige Variablen
3.2 Hypothesen
3.3 Versuchsplan
3.4 Versuchsmaterialien
4. Versuchsdurchführung
4.1 Versuchspersonen
4.2 Versuchsaufbau
4.3 Maßnahmen zur Präzisionserhöhung
4.4 Sicherstellung der CP-Validität
5. Versuchsauswertung
5.1 Auditiv/auditive Bedingung
5.2 Auditiv/visuelle Bedingung
6. Diskussion
7. Literatur
Anhang A: Auditiv/auditive Bedingung
Anhang B: Auditiv/visuelle Bedingung
Zusammenfassung
Die von Tipper und Cranston (1985) vorgeschlagene Erklärung zum Negative Priming-Effekt wurde in jüngster Zeit von Milliken, Joordens, Merikle und Seiffert (1998) kritisiert, indem er ein Modell der fragmentarischen Verarbeitung dem Hemmungsmodell von Tipper gegenüberstellt. Unter anderem geht Milliken davon aus, daß ein Konflikt im Prime Durchgang nicht notwendiger Bestandteil des Negative Priming-Paradigmas ist. Im nachfolgenden Experiment konnten wir Millikens Modell jedoch nicht bestätigen. Zusätzlich konnten wir Befunde replizieren, die eine postkategoriale Verarbeitung der Reize nahelegen.
1. Einleitung
Was genau versteht man unter selektiver Aufmerksamkeit? Auf unsere Sinne wirken in jeder Sekunde Millionen von Eindrü>Wie genau diese Mechanismen der selektiven Aufmerksamkeit wirken, hat auch schon viele Kognitionspsychologen interessiert und zu zahlreichen Untersuchungen angeregt. Dabei ist man auf interessante Ergebnisse gestoßen, u. a. wurde zum Beispiel der Negative Priming Effekt entdeckt, welcher bei der selektiven Aufmerksamkeit und auch bei unserer Untersuchung eine zentrale Rolle spielt.
Doch was ist Negative Priming und wie wird es untersucht? Der Negative Priming Effekt wird untersucht, indem eine Versuchsperson über mehrere Durchgänge hinweg auf die Identität eines Stimulus in Anwesenheit einer oder mehrerer Distraktoren1 reagieren soll. Die kritische Manipulation in solch einer Aufgabe liegt zwischen aufeinanderfolgenden Durchgängen: Die Versuchsperson muß auf den Ziel-Stimulus („ Target “) im laufenden Durchgang („ test “ bzw. „ Probe Trial “) reagieren, welcher im vorherigen Durchgang („ Prime Trial “) als Distraktor erschienen war. Reaktionszeit und Genauigkeit während solcher Testdurchgänge, in denen der Ziel-Stimulus der vorherige Distraktor war, werden mit solchen Kontrolldurchgängen verglichen, in denen weder der Ziel-Stimulus noch der Distraktor sich über Durchgänge wiederholen.
Der Negative Priming Effekt besteht in einer Verlängerung der Reaktionszeiten (und oft in einer Zunahme der Fehler) während dieser Testdurchgänge im Vergleich zu den Kontrolldurchgängen.
Ein inzwischen vielfach akzeptierter Erklärungsansatz des Negative Priming Effekts liegt darin, daß während eines bestimmten Zeitpunktes bei oder kurz nach der Zielstimulus- Auswahl im Prime Trial die aktivierte Repräsentation des Distraktors unterdrückt wird. Wird nun der vorherige Distraktor zum Zielstimulus im nächsten Testdurchgang, dauert es einige Zeit bis die Unterdrückung des Stimulus während des Prime Trials aufgehoben wird, welches die Reaktionszeit verlängert.
Wie genau die Unterdrückung des Distraktors zustande kommt wird kontrovers diskutiert. Im folgenden werden die Theorien von Tipper (1985), May, Kane und Hasher (1995), Tipper, Weaver und Milliken (1995) sowie Milliken, Joordens, Merikle und Seiffert (1998) erläutert, die den Hintergrund für unser Experiment liefern.
2. Theorien zum Negative Priming
Im folgenden Abschnitt greifen wir einige der Theorien auf, die bisher zu dem Thema Negative Priming veröffentlicht wurden. Wir berücksichtigen dabei jedoch nur aktuelle Theorien, die noch allgemein diskutiert werden.
2.1 Inhibitionstheorien
Schon vor dem Hintergrund des klassischen Stroop-Effektes (Stroop, 1935) entstanden einfache Hemmungs- oder Inhibitionstheorien, die eine allgemeine Hemmung desjenigen Reizes annahmen, der nicht beachtet werden sollte: In einer Priming-Versuchsanordnung sollte die Verarbeitung des relevanten und zu beachtenden Reizes (Reiz A) erleichtert werden; daneben sollte jedoch auch die interne Darstellung des nicht zu beachtenden Reizes (Reiz B, also des Distraktors) aktiv gehemmt werden, sobald Reiz A selektiert wird. Damit tritt der Effekt auf, daß im weiteren Verlauf Reaktionen auf eben solche Reize behindert werden, die intern wie Reiz A dargestellt werden. Eine Reihe von Studien, z.B. Lowe (1979) und Neill (1977, zit. nach Tipper ∓ Cranston, 1985) konnten diesen Effekt tatsächlich belegen.
Allerdings kam Lowe (1979) auch zu einem exakt entgegengesetzten Ergebnis, und zwar für den Fall, daß im Test Trial keine Selektion erforderlich war, wenn also z.B. nur ein einzelner Reiz präsentiert wurde, auf den reagiert werden sollte. Sogar in dem Fall, daß dieser Reiz mit dem Distraktor aus dem vorangegangenen Durchgang identisch war, trat nun positives (oder facilitatory) Priming auf, das zu einer Verkürzung der Reaktionszeit führte.
Dieser Befund läßt sich mit einer einfachen Hemmungshypothese nicht erklären, da diese die Hemmung des nicht beachteten Reizes schon während der Selektion annimmt, und zwar völlig unabhängig von der späteren Verarbeitung.
Tipper (1985) und Tipper und Cranston (1985) schlugen daher ein erweitertes Modell der Hemmung vor, in dem diese Umkehrung des Hemmungseffektes mit zwei unabhängigen Ebenen der Verarbeitung begründet wird. Nach ihrer Ansicht verlaufen Erregung und Hemmung getrennt voneinander. Nach Verarbeitung der sensorischen Eindrücke bleiben die Darstellungen der Reizeigenschaften aktiviert, und zwar sowohl für den ausgewählten als auch für den unterdrückten Reiz (Wahrnehmungsebene). Anschließend wird ein Reiz für die weitere Verarbeitung ausgewählt, dessen Eigenschaften weiter analysiert werden und schließlich zu einer Reaktion führen. Dieser Übersetzungsvorgang stellt die zweite Ebene (Reaktionsebene) im Modell von Tipper und Cranston dar; für ausgewählte Reize wird er aktiviert, für unterdrückte aber gehemmt.
Tipper und Cranston (1985) interpretieren den Befund von Lowe (1979) nun so, daß nach einem Selektionsvorgang sowohl der aktiv gehemmte Distraktor als auch der zu beachtende Reiz auf der Wahrnehmungsebene aktiviert sind, allerdings nur letzterer auch auf der Reaktionsebene. Nach ihrer Annahme nimmt die Hemmung des Distraktors auf der Reaktionsebene ab, falls für die Lösung des Experimentes keine Selektion erforderlich ist (wie es bei Lowe, 1979, der Fall ist), so daß die Aktivierung auf Wahrnehmungsebene die Hemmung auf der Reaktionsebene übertrifft und sich positives Priming einstellt. Mit Hilfe des Modells von Tipper und Cranston (1985) lassen sich also sowohl negatives als auch positives Priming erklären.
2.2 Episodic Retrieval
May, Kane und Hasher (1995) zeigten in ihrer Arbeit, daß die Theorie von Tipper zwar in einigen Fällen zutreffen kann, daß es aber Ausnahmen gibt, in denen sie nicht greift. Als Beispiel führen sie eine Untersuchung von Neill und Valdes (1992) und Neill, Valdes, Terry und Gorfein (1992) an, in welcher eine Alternative zu der Erklärung von Tipper postuliert wird. Neill und Valdes fanden heraus, daß mit zunehmenden Abstand zwischen Prime und Test Trial der Negative Priming Effekt abnimmt, allerdings ausschließlich bei interindividueller Variation. Sollte der Hemmungsmechanismus dazu dienen weitere Verarbeitung zu erleichtern, wie Tipper, Weaver, Cameron, Brehaut und Bastedo (1991) und Stoltzfus et al. (1993) postulieren, so sollte dies ohne Einfluß der Länge des Intervalls zwischen Durchgängen geschehen. Als alternative Erklärung des Negative Priming beschrieben Neill und Valdes die Theorie des Episodic Retrieval.
Die Erklärung des Negative Priming Effekts durch Episodic Retrieval basiert auf Logans (1988, zit. nach May, Kane und Hasher, 1995) Theorie der Automatisierung, welche zeigt, daß die Präsentation eines Stimulus automatisch ein Abrufen der letzten den Stimulus betreffenden Episode hervorruft. Diese hervorgerufene Episode enthält Informationen bzw. Zusätze (sogenannte tags) über den Stimulus und seine Attribute, einschließlich der Art der Reaktion auf den Stimulus (Antwort oder keine Antwort).
Zum Beispiel würde die Präsentation des Buchstaben „B“ als Target die neuste Episode betreffend den Buchstaben „B“ hervorrufen. Wenn „B“ im vorherigen Durchgang als Distraktor fungiert wird der „Ignoriere-Es“-Zusatz automatisch aktiviert. Dieser Zusatz steht im Konflikt mit der jetzigen Anforderung den Buchstaben zu benennen. Als Resultat verzögert sich die Antwort bis der Konflikt zwischen den zwei tags gelöst ist. Diese Verzögerung, die durch die zwei konkurrierenden Reaktionstendenzen ausgelöst wird, manifestiert sich als Negative Priming.
Im Gegensatz zu dem Hemmungsmechanismus nach Tipper et al., welcher vorwärts wirkt, indem er den Prime Distraktor hemmt, um zukünftige Reaktionen zu verhindern, funktioniert Episodic Retrieval rückwirkend: Die Präsentation eines Stimulus während des Test Trials induziert die Wiedererlangung einer vorherigen Episode, welche mit der neuen Ziel-Reaktion konkurriert.
Eine zentrale Annahme der Episodic Retrieval Theorie ist, daß vorherige Episoden mit variierender Wahrscheinlichkeit erfolgreich abgerufen werden. Somit ist das Ausmaß des Konfliktes nicht konstant. Eine Variable, welche die Abfrage-Wahrscheinlichkeit bestimmt, ist das Ausmaß, in dem der eine Durchgang zeitlich von früheren Durchgängen unterscheidbar ist. Ist das Intervall zwischen den Durchgängen (RSI) innerhalb einer Testsituation konstant, so sind alle Durchgänge gleich gut zu unterscheiden. Wird das RSI interindividuell variiert, so dürfte sich keine Veränderung zeigen; dies haben Tipper, Weaver, Cameron, et al. (1991) und Stoltzfus (1993) in ihrer Untersuchung auch gefunden. Variiert man aber das RSI innerhalb einer Testsituation, also intraindividuell, dann sind einige Durchgänge besser unterscheidbar als andere: ein kurzes Intervall zwischen Prime und Test Trial hat mit größerer Wahrscheinlichkeit eine erfolgreiche Abfrage zur Folge, welches zu einem größeren Konflikt, also zu einer größeren Konkurrenz zwischen den möglichen Reaktionen führt - und somit auch zu einem größeren Negative Priming Effekt. Das erklärt (entsprechend der Episodic Retrieval Theorie) eine Reduktion des Negative Priming mit zunehmenden Abstand zwischen Prime und Test Trial bei der intraindividuellen Variation (dies war der Ausgangspunkt von Neill und Valdes, 1992 und Neill et al., 1992 - siehe weiter oben).
Allerdings zeigen sich hier auch schnell die Grenzen der Episodic Retrieval Theorie. Wird das RSI intraindividuell variiert, so sagt die Episodic Retrieval Theorie voraus, daß mit Zunahme des Intervalls der Negative Priming Effekt graduell abnimmt. Dies ist jedoch nicht der Fall: Negative Priming ist zwar signifikant reduziert nach dem kürzesten RSI (gewöhnlich um die 500 ms), aber es bleibt relativ stabil zwischen 1000 und 8000 ms.
Außerdem sollte Negative Priming laut der Episodic Retrieval Theorie abnehmen, wenn zwischen dem Prime und Test Trial bestimmte Items intervenieren, da durch die Störung die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abrufs verringert wird. Doch auch dies ist nicht der Fall: Negative Priming bleibt über störende Durchgänge stabil, selbst wenn jene den Prime und Test Trials sehr ähneln.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Tatsache, daß Neill und Valdes (1992) und Neill et al. (1992) behaupten, daß Episodic Retrieval automatisch abläuft. Ist dies der Fall, dann sollten die Auswahlkriterien beim Experiment keinen Einfluß haben: negatives Priming sollte stattfinden, ungeachtet dessen, ob die Durchgänge einen Konflikt oder keinen Konflikt beinhalten. Jedoch zeigt sich, daß in Durchgängen ohne Konflikt eher eine Erleichterung der Reaktion als negatives Priming zu beobachten ist.
Außerdem problematisch im Sinne der Episodic Retrieval Theorie sind Durchgänge die eine „t arget-to-distractor “ - Bedingung enthalten, bei der also im Test Trial ein Stimulus Distraktor ist, welcher im Prime Trial Target war. Auch hier sollte sich laut Neill und Valdes (1992) und Neill et al. (1992) negatives Priming zeigen, da der neue Zusatz „benennen“ mit dem Zusatz „ignorieren“ im Konflikt steht. Es läßt sich aber zeigen, daß Versuchspersonen hierbei auch eher schneller als langsamer reagieren.
Durch diese und weitere Unstimmigkeiten kamen May, Kane und Hasher (1995) zu dem Schluß, daß die Episodic Retrieval Theorie sich nicht dazu eignet den Negative Priming Effekt umfassend zu erklären.
Nach dem Studieren der Experimente und Theorien von Tipper, Weaver, Cameron, Brehaut und Bastedo (1991) und Stoltzfus et al. (1993) und Neill und Valdes (1992), und durch zahlreiche Folgeexperimente kamen May, Kane und Hasher (1995) zu dem Ergebnis, daß es zwei Mechanismen gibt, die für negatives Priming verantwortlich sind: Inhibition und Episodic Retrieval.
2.3 Negative Priming ohne mismatching
Park und Kanwisher (1994) behaupteten, daß Negative Priming der Extrazeit entspricht, die benötigt wird, um bei räumlich-zeitlicher Korrespondenz von unterschiedlichen Prime- Distraktoren und Probe-Targets Prozesse zu gewährleisten, durch die neue Wahrnehmungscharakteristiken in das alte Objekt eingebaut werden. Tipper et al. (1995) erklärten zusätzlich, daß mismatching keine notwendige Bedingung für Negative Priming ist, sondern das eher ein objektbezogener Hemmungsmechanismus existiert.
Um diese These zu prüfen wurden drei Experimente durchgeführt. Im ersten Experiment, wurden sogenannte „ select-what-respond-where-tasks “ am Computer durchgeführt: Hierbei wurden auf dem Bildschirm die Stimuli (hier vier konzentrische Kreise) an vier möglichen Orten dargeboten. Es wurden in den Ringen jeweils zwei Kreise gezeigt und der Joystick sollte zum größeren Ring bewegt werden. Die Kreise hatten dabei sechs verschiedene Größen.
Hierbei zeigte sich, daß Negative Priming zu beobachten war, wenn der Prime-Distraktor und das Probe Target identisch waren. Dieses Ergebnis zeigt, daß Mismatching nicht verantwortlich ist, für die gefundenen Negative Priming Effekte. Ferner zeigte sich, daß wenn der Prime-Distraktor und das Probe Target nicht identisch waren, auch das Negative Priming nicht länger dauerte. Somit zeigt sich sogar ein Trend in die entgegengesetzte Richtung: Negative Priming war ein wenig länger, wenn der Prime-Distraktor und das Probe Target identisch waren. Diese Ergebnisse widersprechen der Sichtweise, daß Mismatching räumlich negatives Priming verursacht, aber es ist vereinbar mit der Annahme des objektbezogenen Inhibierungsmechanismus.
Das zweite Experiment war ähnlich aufgebaut. Hierbei wurden die Stimuli (hier Buchstaben) an vier möglichen Orten in drei verschiedenen Größen gezeigt. Auch hier galt es, den größeren Buchstaben anzuwählen. Die Ergebnisse zeigten, daß Buchstabenidentitäts- Mismatching nicht notwendig für negatives Priming ist.
Im dritten Experiment wurde ein Stimulus (hier der Buchstabe „X“) an vier möglichen Orten und in vier verschiedenen Farben gezeigt. Der mittlere Farbkasten entsprach der Ziel-Farbe. Hier zeigte sich Negative Priming gleichermaßen bei identischen Prime-Distraktoren und Probe Targets auch bei Trennung von Cues und Targets.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß diese Experimente bestätigen, daß Mismatching keine notwendige Bedingung für negatives Priming ist, ja daß es diesen Effekt sogar unter bestimmten Bedingungen schwächen kann. Auch im Buchstabenunterscheidungs-Paradigma ist Mismatching nicht notwendig, hat hier allerdings keinen Effekt auf negatives Priming. Mismatching kann einen additiven Effekt auf negatives Priming ausüben wenn der Cue vom Target und Distraktor getrennt wird.
2.4 Fragmentarische Verarbeitung
Milliken, Merikle, Joordens und Seiffert (1998) vertreten die These, daß Priming-Effekte ein Phänomen der „wiederhergestellten Erinnerung“ seien. Sie glaubten, daß ein Orientierungssystem, welches Widersprüche zwischen der wahrgenommenen Präsentation des gegenwärtigen Probes und der Erinnerung an dem vorausgegangenen Prime die Priming- Effekte verursache. Milliken et al. gehen in ihrer These davon aus, daß es bei wiederholten bzw. verwandten Probes zu langsameren Reaktionen kommt als bei einem unbekannten Kontroll-Probe. Sie erklären die langsameren Reaktionen auf Probes, die vorab als Prime zu ignorieren waren, durch einen entstandenen automatischen Wiedererkennungsprozeß, der die Versuchspersonen daran hindert, schneller zu reagieren. Sie erkennen den vorher dargebotenen Distraktor, welcher fragmentiert gespeichert wurde und bewerten diesen als „alt“. Eine weitere Theorie der Autoren besagt, daß es keinen Prime-Konflikt benötige, um Negative Priming zu zeigen.
Die Versuche 2A und 2B sind für die von Milliken et al. (1998) vorgenommene Modellprüfung zentral. Insgesamt 20 Versuchspersonen wurde gesagt, sie sähen als erstes einige Buchstaben, die auf dem Bildschirm unscharf aufflackern würden (Prime). Die Versuchspersonen wurden gebeten, ihre Aufmerksamkeit auf diese Buchstaben zu lenken, da dort später der Probe erscheinen würde. Erst am Schluß des Experiments wurden sie über die Anwesenheit des Prime-Wortes informiert. In diesen Experimenten gaben fast alle Versuchspersonen an, das Prime-Wort nicht erkannt zu haben. Trotzdem kam es auch hier zu signifikanten Negative Priming.
Eine wichtige These von Milliken et al. (1998) besteht in der Annahme, daß Negative Priming alleinig durch den Probe-Konflikt ausgelöst wird. Der Widerspruch ihrer Befunde zur bisherigen Forschung sowie methodische Mängel ihrer Experimente ließen einen Replikationsversuch sinnvoll erscheinen. Wesentliche Kritikpunkte bestehen allgemein in einer zu geringen Stichprobengröße und speziell in der Behauptung, der in den Experimenten 2A und 2B erwähnte maskierte Prime (Distraktor) führe aufgrund seiner fragmentarischen Verarbeitung zu Negative Priming im Probedurchgang. Nach der Inhibitionstheorie von Tipper und Cranston (1985) ließe sich der Negative Priming-Effekt durch eine Hemmung der Reaktionstendenz auf den Distraktor erklären, da die Versuchspersonen laut Instruktionen darauf nicht reagieren sollten. Daher erscheint es lohnend, diese beiden Theorien für einen Fall gegenüberzustellen, für den sie unterschiedliche Vorhersagen machen.
3. Operationalisierung
Dieser Bericht wird sich im Folgenden nur auf einen Teil des von unserer Gruppe durchgeführten Experimentes beziehen. Die andere Hälfte wird im Text von Bayuk, Chu, Girst, Hubel und Schorer (1999) behandelt, der jedoch im wesentlichen zu gleichen Ergebnissen kommt. Zunächst sei aber der komplette Versuchsplan dargestellt.
3.1 Unabhängige und abhängige Variablen
Den interessierenden Einflußgrößen entsprechend wählten wir drei unabhängige Variablen: Auf der ersten unabhängigen Variablen (UV A) wurden die Kombinationen der Sinnesmodalitäten visuell und auditiv zwischen Prime- und Probe-Durchgang variiert, so daß sich insgesamt vier Kombinationen ergaben, nämlich „visuell/visuell“, „visuell/auditiv“, „auditiv/auditiv“ und „auditiv/visuell“. Diese Kombinationen können auch als das Ergebnis zweier gekreuzter Variablen aufgefaßt werden, nämlich Prime-Modalität und Probe- Modalität, die jeweils die beiden Stufen visuell und auditiv unterscheiden. Wir verzichten hier jedoch auf diese Differenzierung, da unsere Arbeit sich aus ökonomischen Gründen nur mit zwei der vier Bedingungen beschäftigt, die in unserem (im Rahmen des Empiriepraktikums durchgeführten) Experiments erhobenen wurden, und damit keine vollständige Kreuzung mehr vorliegt.
In der zweiten Variablen (UV B) wurde im Prime-Durchgang auf der ersten Stufe ein Konflikt zwischen den beiden präsentierten Items hergestellt, auf der zweiten jedoch nicht. Auf den beiden Stufen der dritten Variable (UV C) wurde variiert, ob im nachfolgenden Probe-Durchgang ein Konflikt auftrat (C1 - Konflikt, C2 - kein Konflikt).
Als primäre abhängige Variable (AV) wurde jeweils die Differenz (in ms) der Reaktionszeiten im Prime- und im Probe-Durchgang ermittelt. Die Fehlerhäufigkeit stellt eine sekundäre abhängige Variable dar.
3.2 Hypothesen
Nachdem schon Tipper (1985) zeigen konnte, daß Negative Priming bei postkategorialer Verarbeitung, also nicht mehr auf Wahrnehmungs-, sondern auf einer höheren kognitiven Ebene stattfindet, nehmen wir für die UV A die Nullhypothese an, da die Darbietungsmodalität eben keinen Einfluß haben sollte.
Inhaltlich interessanter ist die UV B, also die Variation Prime-Konflikt vs. kein Prime- Konflikt. Nach Milliken et al. (1998) sollte hier kein Unterschied auftreten (vgl. hierzu
Abschnitt 2.4, Experiment 2). Ihre Untersuchung weist jedoch erhebliche methodische Mängel auf, insbesondere einen zu geringen Stichprobenumfang. Daher ergeben sich berechtigte Zweifel an der Interpretation im Sinne einer fragmentarischen Verarbeitung. Wir erwarten demzufolge einen Negative Priming-Effekt nach Tipper (1985).
Mit Hilfe der UV C (Probe-Konflikt vs. kein Probe-Konflikt) versuchten wir, einen weiteren Befund von Milliken zu entkräften (Milliken et al. (1998), Experimente 1 und 3), der einen wesentlichen Beleg für seine Theorie darstellt, nämlich daß alleinig der Probe-Konflikt Negative Priming verursacht. Unsere statistischen Hypothesen, die sich nur auf die beiden ersten der insgesamt vier in Abbildung 1 aufgeführten Stufen der UV A beziehen, lauteten also:
UV A: H0: m1 = m2
UV B: H1: m1 < m2
UV C: H0: m1 = m2
3.3 Versuchsplan
In der Hagerschen (1987) Terminologie sind die Faktoren B und C des kompletten 4x2x2- Versuchsplanes vollständig gekreuzt und im engeren Sinne meßwiederholt, allerdings sind sie hierarchisch dem Faktor A untergeordnet, wie es auch verdeutlicht wird. Nach der Kirkschen Terminologie stellt sich unser Versuchsplan als completely randomized hierarchical design (CRH p(qr)) dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Vollständiger Versuchsplan unseres Experimentes. Bei den Bezeichnungen der vier Stufen der UV A bedeutet jeweils „v“ eine visuelle und „a“ eine auditive Darbietung.
Bei der Auswertung werden aber nur die Stufen A1 und A2 des Gesamtplanes betrachtet, für die beiden anderen Stufen verweisen wir erneut auf die Arbeit von Bayuk, Chu, Girst, Hubel und Schorer (1999). Innerhalb dieser beiden Stufen des Faktors A ergeben sich bei vollständiger Kreuzung je vier Kombinationen der Faktoren B und C, die wir von NP1 bis NP4 numerierten, wie es in Abbildung 1 dargestellt ist.
3.4 Versuchsmaterialien
Die Präsentation der Reize und die Messung der Reaktionszeit erfolgten auf Apple PowerMacintosh (8600/200) Rechnern, die mit Farbmonitoren ausgestattet waren. Akustische Stimuli konnten mit Hilfe von handelsüblichen Knopfkopfhörern unabhängig voneinander auf je einem Ohr dargeboten werden. Weitere Hilfsmittel wie Trennwände und Ohrenschützer dienten der weiter unten erläuterten Erhöhung der CP-Validität.
4. Versuchsdurchführung
Unser Versuch fand von Anfang Januar bis Anfang Februar 1999 statt. Dabei war der von uns benutzte Experimentalraum schallisoliert.
4.1 Versuchspersonen
Geplant wurde unsere Untersuchung auf einen t -Test2 hin, mit dem die Unterschiede zwischen den erwarteten Negative Priming-Effekten unter je zwei Stufen des Faktors A verglichen werden sollten. Wie oben bereits angedeutet, ergaben sich diese Effekte aus der Differenz der Reaktionszeiten zwischen Prime- und Probe-Durchgängen.
Mit a = b = .05 und d = .8, was nach Cohen einen großen Effekt darstellt (zit. nach Bortz, 1993), ergab sich eine Zahl von 42 Versuchspersonen pro Bedingung, also 84 für den hier betrachteten Teil des Versuchsplans. Diese Zahl wurde von uns jedoch auf 90 aufgerundet, um beim eventuellen Ausfall einzelner Versuchspersonen nicht unter die Grenze von b = .05 zu gelangen. Der Wert von 42 Versuchspersonen pro Bedingung wurde mit dem Programm GPower (1992) ermittelt.
Den größten Anteil an den Versuchspersonen stellten Psychologiestudierende der Universität Trier. Das Durchschnittsalter betrug 22 Jahre. Die Probanden teilten sich in 33 % Männer und 67 % Frauen auf. Die Teilnehmer kamen auf Voranmeldung oder spontan und wurden je nach Reihenfolge ihres Erscheinens randomisiert einer der Modalitätsstufen (der UV A) zugewiesen.
4.2 Versuchsaufbau
Nach der Erfassung einiger statistischer Daten wurden die Versuchspersonen kurz von einem der beiden anwesenden Versuchsleiter in den Versuch eingewiesen; die eigentlichen Instruktionen wurden bereits per Computer erteilt. Zusätzlich standen die Versuchsleiter allerdings für Nachfragen zur Verfügung. Bei Beginn des Experimentes wurden die Versuchspersonen gebeten, die Kopfhörer und anschließend die Ohrenschützer aufzusetzen.
Als Kategorien für unsere visuellen und akustischen Stimuli wählten wir Tiere und Instrumente. Der Konflikt wurde sowohl im Prime- wie auch im Probe-Durchgang wie folgt hergestellt:
In einem visuellen Durchgang erfolgte zunächst die Präsentation eines einzelnen blauen oder roten Quadrates in der Mitte des Bildschirms; die jeweilige Farbe sollte anschließend beachtet werden. Danach wurden zwei verschiedenfarbigen Umrißzeichnungen (Tiere oder Musikinstrumente) dargestellt, von denen die Versuchsperson diejenige mit der vorher präsentierten Farbe des Quadrates beachten und darauf reagieren sollte.
In einem auditiven Durchgang hörte die Versuchsperson über den Kopfhörer zunächst ein Knacken auf einem Ohr. Es folgte auf jedem Ohr je ein Geräusch aus der Tier- oder Instrumentkategorie, wobei die Versuchsperson dasjenige beachten sollte, das auf eben dem Ohr präsentiert wurde, auf dem vorher das Knacken zu hören gewesen war.
In beiden Modalitäten sollten die Versuchspersonen anschließend eine Taste drücken, die das Geräusch bzw. die Zeichnung von Tier oder Instrument kategorisierte; damit wurde zum einen sichergestellt, daß die Versuchsperson das Signal überhaupt beachtete und zum anderen ließ sich damit die Reaktionszeit messen.
Auf einen Prime- folgte immer ein Probe-Durchgang. Um Reihenfolge-Effekte auszuschließen, wurde die Reihenfolge der Stimuli vollständig ausbalanciert. Da sich dadurch rechnerisch insgesamt 384 Durchgänge pro Versuchsperson ergaben, die sich nicht realisieren ließen, wurde diese Sequenz in zwei Sets (A und B) geteilt, von denen jedes 192 Durchgänge umfaßte. Die beiden Sets wurden den Versuchspersonen randomisiert zugeordnet.
Jede Versuchsperson durchlief 4 Blöcke mit je 48 Durchgängen, wobei sie nach jedem zwölften Durchgang eine Rückmeldung mit Fehlern und Reaktionszeiten im Vergleich zum Durchgang davor erhielt. dadurch sollte ihre Motivation auch im Laufe des Experimentes konstant gehalten werden. Der Motivationssteigerung diente auch eine Bestenliste, die am Ende des Versuchs präsentiert wurde.
4.3 Maßnahmen zur Präzisionserhöhung
Die ausgiebige Meßwiederholung über die Faktoren „Prime-Konflikt“ (UV B) und „Probe- Konflikt“ (UV C) trug wohl am meisten zur Präzisionserhöhung bei. Allerdings stellte auch das Einführen des Kontrollfaktors „Probe-Konflikt“ (UV C) eine geeignete Maßnahme dar.
4.4 Sicherstellung der CP-Validität
Die Ceteris-Paribus-Validität (CP-Validität) nach Hager (1987) wurde hauptsächlich durch die Randomisierung auf den unabhängigen Variablen B und C sowie das Ausbalancieren der Reizsequenzen sichergestellt. Daneben spielten aber auch konkretere Maßnahmen eine Rolle, die dazu dienen sollten, die Fehlervarianz zu verringern. So wurden zwischen den Computerplätzen Trennwände aufgestellt und zusätzlich zu den Kopfhörern noch Ohrenschützer verwendet, um die Ablenkung der Versuchspersonen zu minimieren. Jede Versuchsperson mußte einen Vortest absolvieren, der ihre generelle Eignung für das Experiment belegen sollte. Gleichzeitig diente er als Übung, um sie mit den Symbolen bzw. Klängen vertraut zu machen sowie die erforderlichen Reaktionen zu trainieren. Weiter wurden alle Instruktionen per Computer gegeben, so daß jede Versuchsperson identische Startbedingungen hatte. Mögliche störende Einflüsse aufgrund des unterschiedlichen Routinestandes der Versuchsleiter sollten dadurch vermieden werden, daß die Versuchsleiter selbst die Experimentalsituation vor Beginn des Experimentes erprobten.
5. Versuchsauswertung
Diese Auswertung berücksichtigt nur zwei der insgesamt vier Stufen der UV A. Für eine vollständige Übersicht über die Ergebnisse verweisen wir auf die Untersuchung von Bayuk, Chu, Girst, Hubel und Schorer (1999). In einem ersten Schritt errechneten wir aus den Rohdaten für jede Bedingungskombination die Differenz der Reaktionszeiten zwischen Negative Priming- und Kontrolldurchgängen.
5.1 Auditiv/auditive Bedingung
Die Modalität NP1 (weder Prime- noch Probe-Konflikt) ergab eine Reaktionszeitdifferenz von 68,99 ms (t (41) = -4,88, p < .001) und war damit hochsignifikant. Die Versuchspersonen zeigten Positiv Priming. Unter NP2 (kein Prime-, aber Probe-Konflikt) erhielten wir eine durchschnittliche Differenz der Reaktionszeiten von - 45,47 ms (t( 41) = -1.90, p = .0651) die nicht mehr zu einem signifikanten Ergebnis führte. Die Graphik (siehe Anhang A) zeigt aber deutlich die Tendenz zum Positiv Priming.
Die Bedingungen NP3 (Prime-Konflikt, kein Probe-Konflikt) (t (41) = 2,8, p < .01) mit einer durchschnittlichen verzögerten Reaktionszeit von 43,55 ms sowie NP4 (Prime- und Probe- Konflikt) (t (41) = 3,95, p < .001) und einer Verzögerung der Reaktionszeiten von durchschnittlich 66,840 ms ergeben jede für sich ein hochsignifikantes Negative Priming.
Der Standardschätzfehler ist ebenfalls in der Graphik (Anhang A) eingezeichnet. Da dieser eher gering ausfällt, stellen unsere Daten relativ gute Schätzer für die entsprechenden Populationsmittelwerte dar.
Mit einer Varianzanalyse ermittelten wir, wie sich die jeweiligen Prime-Konflikte bzw. Probe-Konflikte auf das Negative Priming auswirkten. Die Prime-Konflikt-Manipulation zeigte ein hochsignifikantes Ergebnis (F (1,41) = 35.82, p < .01). Dagegen wurde die ProbeKonflikt-Manipulation nicht signifikant (F (1,41) = 1.49, p = .23). Eine Wechselwirkung der beiden Bedingungen lag nicht vor (F (1,41) < 0.01, p =.99).
Diese Ergebnisse stärken das Vertrauen in unsere Hypothese, daß allein die Prime-Konflikt- Manipulation entscheidet, ob die Versuchspersonen Positive Priming oder aber Negative Priming zeigen.
5.2 Auditiv/visuelle Bedingung
Die unter dieser Modalität erzielten Ergebnisse waren nicht mehr ganz so eindeutig. Signifikantes Positive Priming wurde von den Versuchspersonen nicht mehr gezeigt. Die Bedingung NP1 zeigte mit einer durchschnittlichen verzögerten Reaktionszeit von 7.098 ms sogar im Gegensatz zur auditiv/auditiven Bedingung eher in eine Negative Priming-Richtung (t (41) = .814, p = .4205), ist jedoch nicht signifikant (siehe Anhang B). Ebenfalls nicht signifikant wurde das Ergebnis der NP2 Bedingung, die eine Erhöhung der durchschnittlichen Reaktionszeiten von -4.649 ms (t (41) = -.508, p = .6145) zur Folge hatte.
Die NP3-Bedingung erzeugte eine durchschnittliche Reaktionszeitdifferenz von 23.003 ms. Dies ist statistisch signifikant (t (41) = 2.338, p = .0244). Die Modalität NP4 ging einher mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Reaktionszeit um 25,663 ms und wurde nicht mehr auf dem 5%-Niveau signifikant (t (41) = 1.914, p = .0627).
Unter der Modalität bezüglich der Prime-Konflikt-Manipulation stellten wir mit Hilfe der Varianzanalyse ein signifikantes Ergebnis (F (1,41) = 4.392, p = 0.423) fest. Wie unter der auditiv/auditiv Modalität zeigte weder die Probe-Konflikt-Manipulation Signifikanz (F( 1,41) = .169, p = .6834), noch konnte eine Wechselwirkung der beiden Bedingungen nachgewiesen werden (F (1,41) = .537, p = .4677).
6. Diskussion
In unserer Untersuchung ließ sich erwartungsgemäß zeigen, daß Negative Priming nicht durch fragmentarische Verarbeitung zustande kommt, sondern vielmehr, wie schon von Tipper postuliert, durch Inhibition. Unsere Ergebnisse sprechen eindeutig dafür, daß es einen erheblichen Unterschied macht, ob im Prime Trial ein Konflikt besteht oder nicht. Dies steht im Widerspruch zur Theorie von Milliken et al. (1998), welche besagt, daß ein Konflikt im Prime Trial nicht ausschlaggebend für Negative Priming ist. Im Gegensatz zu Milliken konnte unsere Untersuchung keinen Negative Priming-Effekt feststellen, wenn der Konflikt ausschließlich im Probe- Durchgang vorhanden war; es zeigte sich im Gegenteil eine deutliche Tendenz zum positives Priming. Außerdem konnten wir replizieren, daß Negative Priming unabhängig von den verschiedenen Modalitäten auftritt. Somit wurden alle unsere Hypothesen bestätigt.
7. Literatur
Bortz, J. (1993). Statistik. Berlin: Springer.
Bayuk, P., Chu, X., Girst, O., Hubel, R. und Schorer, N. (1999). Intermodales Negative Priming. Trier: Universität Trier.
Hager, W. (1987). Grundlagen einer Versuchsplanung zur Prüfung empirischer Hypothesen in der Psychologie. In Luer, G., Allgemeine experimentelle Psychologie, 43-253. Stuttgart: Fischer.
Lowe, D. G. (1979). Strategies, context and the mechanisms of response inhibition. Memory ∓ Cognition, 7, 382-389.
Paul, F. ∓ Erdfelder, E. (1992). GPOWER: A priori, post hoc, and comprise power analyses for MS-DOS (2.0). Bonn, FRG: Bonn University, Department of Psychology. May, C. P., Kane, M.J. ∓ Hasher, L. (1995). Determinants of Negative Priming. Psychological Bulletin, 118, 35-54.
Milliken, B., Joordens, S., Merikle, P.M. ∓ Seiffert, A.E. (1998). Selective attention: A reevaluation of the implications of Negative Priming. Psychological Review, 105, 203-229.
Neill, W.T. ∓ Valdes L.A. (1992) Persistence of negative priming: Steady state or decay? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition , Vol 18, 565-576.
Neill, W.T., Valdes, L.A., Terry, K.M. ∓ Gorfein, D.S. (1992). Persistence of negative priming: II. Evidence for episodic trace retrieval. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 18, 993-1000.
Stoltzfus, E. R., Hasher, L., Zacks, R. T., Ulivi, M. S. ∓ Goldstein, D. (1993). Investigation of inhibition and interference in younger and older adults. Journal of Gerontology, 48, P179-P188
Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18, 643-662.
Tipper, S. P. (1985). The Negative Priming effect: Inhibitory Priming by ignored objects. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 37A, 571-590.
Tipper, S. P. ∓ Cranston, M. (1985 ). Selective attention and Priming: Inhibitory and facilitatory effects of ignored Primes. Quarterly Jounal of Experimental Psychology, 37A, 591-611.
Tipper, S. P., Weaver, B., Cameron, S., Brehaut, J. C. ∓ Bastedo, J. (1991). Inhibitory mechanisms of attentionin in identification tasks: Time-course and disruption . Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 17, 681-692.
Tipper, S. P., Weaver, B. ∓ Milliken, B. (1995). Spatial Negative Priming without mismatching: Comment on Park and Kanwisher (1994). Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21, 1220-1229.
Anhang A: Auditiv/auditive Bedingung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang B: Auditiv/visuelle Bedingung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Als Distraktoren versteht man in der Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie Reize, die dem zu beachtenden Reiz möglichst ähnlich, aber dennoch nicht zu beachten sind.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Studie zum Negative Priming?
Die Studie untersucht den Negative Priming-Effekt, ein Phänomen der selektiven Aufmerksamkeit, bei dem die Reaktionszeit auf einen Stimulus verlängert wird, wenn dieser zuvor als Distraktor ignoriert wurde. Die Studie vergleicht verschiedene Theorien, insbesondere die Inhibitionstheorie von Tipper und die Theorie der fragmentarischen Verarbeitung von Milliken, Joordens, Merikle und Seiffert, um zu verstehen, welche Mechanismen dem Negative Priming zugrunde liegen.
Welche Theorien zum Negative Priming werden in der Studie untersucht?
Die Studie untersucht hauptsächlich:
- Inhibitionstheorien (Tipper): Diese Theorien gehen davon aus, dass die Repräsentation eines Distraktors aktiv unterdrückt wird, um die Verarbeitung relevanter Stimuli zu erleichtern. Wenn der vorherige Distraktor später zum Zielstimulus wird, dauert es länger, bis die Unterdrückung aufgehoben ist.
- Episodic Retrieval (May, Kane und Hasher): Diese Theorie besagt, dass die Präsentation eines Stimulus automatisch die letzte Episode abruft, die diesen Stimulus betrifft, einschließlich Informationen darüber, wie auf ihn reagiert werden sollte (ignorieren oder reagieren). Ein Konflikt zwischen der aktuellen Anforderung und der abgerufenen Episode kann zu einer Verzögerung der Reaktion führen.
- Fragmentarische Verarbeitung (Milliken et al.): Milliken et al. argumentieren, dass Negative Priming durch die Wiedererkennung eines zuvor präsentierten, fragmentarisch gespeicherten Distraktors verursacht wird. Sie behaupten, dass ein Konflikt im Prime Trial nicht notwendig ist, um Negative Priming zu erzeugen.
Was war das Ziel des Experiments und was waren die Hypothesen?
Das Ziel des Experiments war es, Millikens Modell der fragmentarischen Verarbeitung zu überprüfen und die Rolle des Prime-Konflikts im Negative Priming-Effekt zu untersuchen. Die Hypothesen waren:
- Hypothese zur Darbietungsmodalität (UV A): Die Darbietungsmodalität (visuell oder auditiv) hat keinen Einfluss auf das Negative Priming.
- Hypothese zum Prime-Konflikt (UV B): Ein Prime-Konflikt ist notwendig für das Auftreten von Negative Priming, im Gegensatz zu Millikens Theorie.
- Hypothese zum Probe-Konflikt (UV C): Ein Probe-Konflikt allein verursacht kein Negative Priming.
Wie war das Experiment aufgebaut?
Das Experiment verwendete einen 4x2x2-Versuchsplan, wobei die folgenden Faktoren variiert wurden:
- UV A (Darbietungsmodalität): Kombinationen von visuellen und auditiven Reizen im Prime- und Probe-Durchgang (visuell/visuell, visuell/auditiv, auditiv/auditiv, auditiv/visuell).
- UV B (Prime-Konflikt): Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Konflikts zwischen den beiden präsentierten Items im Prime-Durchgang.
- UV C (Probe-Konflikt): Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Konflikts im Probe-Durchgang.
Die abhängige Variable war die Differenz der Reaktionszeiten zwischen Prime- und Probe-Durchgängen.
Was waren die Ergebnisse der Studie?
Die Ergebnisse der Studie unterstützen die Inhibitionstheorie von Tipper und widersprechen der Theorie der fragmentarischen Verarbeitung von Milliken. Die Studie zeigte, dass ein Prime-Konflikt notwendig ist, um Negative Priming zu erzeugen. Die Darbietungsmodalität hatte keinen signifikanten Einfluss auf den Negative Priming-Effekt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Negative Priming durch inhibitorische Mechanismen auf postkategorialer Ebene verursacht wird.
Was bedeutet "Postkategoriale Verarbeitung" in Bezug auf Negative Priming?
Postkategoriale Verarbeitung bedeutet, dass der Negative Priming-Effekt nicht nur auf der Wahrnehmungsebene (d.h., die unmittelbare sensorische Verarbeitung) stattfindet, sondern auf einer höheren, kognitiven Ebene. Das bedeutet, dass die Kategorisierung der Reize (z.B. als "Tier" oder "Instrument") und die damit verbundenen kognitiven Prozesse eine Rolle bei der Entstehung des Effekts spielen. Die Darbietungsmodalität spielt also keine Rolle, weil die Inhibition auf einer abstrakteren, kategoriellen Ebene stattfindet.
Was sind die wichtigen Schlüsselwörter im Zusammenhang mit dieser Studie?
Schlüsselwörter: Negative Priming, selektive Aufmerksamkeit, Inhibition, fragmentarische Verarbeitung, Prime-Konflikt, Probe-Konflikt, Darbietungsmodalität, postkategoriale Verarbeitung, Reaktionszeit, Experiment.
- Quote paper
- Daniela Lodowicks (Author), Joachim Schroer (Author), Nicole Zickermann (Author), Uwe Zimmermann (Author), 1999, Modalitätsübergreifendes Negatives Priming - Zur Notwendigkeit des Prime-Konfliktes, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95926