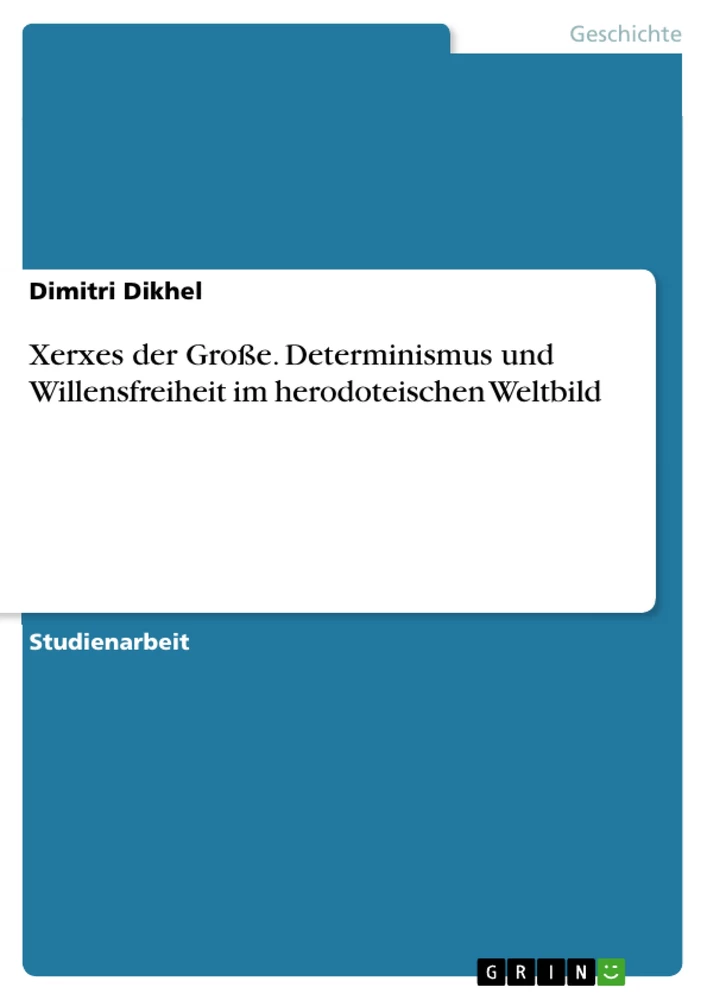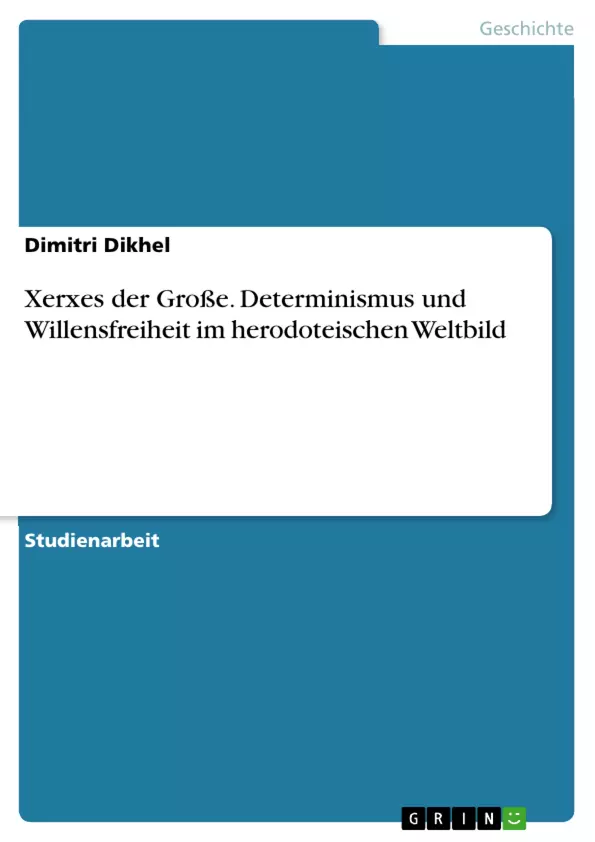In seinem 1978 erschienenen Buch „Orientalism“ schreibt der Literaturtheoretiker Edward W. Said, das westliche Verständnis vom Nahen Ostens sei weitreichend von Alexander dem Großen (356 bis 323 v. Chr.) und Herodot (485 bis 425 v. Chr.) geprägt. Das zeigt sich bereits durch die Verbreitung einer Anekdote aus den Historien, wonach Xerxes sich bei seiner Überfahrt nach Phrygien in eine Platane verliebt und sie mit Schmuck behängt haben soll. Obwohl es hierfür außerhalb der Historien keine Belege gibt, setzte sich diese Geschichte durch, sodass sie zum Beispiel auch bei Claudius Aelianus auftaucht, der dieses Ereignis ungläubig wiedergibt, und zweitausend Jahre später den Anfang von Händels biographischer Oper „Serse“ (1783) bildet. Die Motivationen und Absichten des Großkönigs anhand dieser Quellenlage ergründen zu wollen. ist problematisch.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Xerxes I.: Ein Überblick
- 3. Xerxes als Negativbeispiel in der antiken Literatur
- 4. Interpretation der göttlichen Zeichen in Herodots Darstellung der Perserkriege
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung des persischen Großkönigs Xerxes in Herodots Historien. Im Zentrum steht die Frage, wie Herodot die Figur des Xerxes nutzt, um Aussagen über persische Kultur, Politik und Machtverhältnisse zu treffen.
- Darstellung Xerxes in den Historien
- Interpretation göttlicher Zeichen in Herodots Erzählung
- Xerxes als Beispiel für Hybris und göttliche Strafe
- Die Perser als „Anderer“ im griechischen Weltbild
- Der Einfluss der persischen Geschichte auf die westliche Wahrnehmung des Nahen Ostens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung erläutert den Einfluss Herodots und Alexanders des Großen auf die westliche Wahrnehmung des Nahen Ostens und beleuchtet die Problematik der Quellenlage zur Person Xerxes. Sie stellt zudem die Bedeutung der „Rhetorik des Anderen“ in Herodots Darstellung der Perser dar.
2. Xerxes I.: Ein Überblick
Dieses Kapitel beleuchtet die Herkunft, Geburt und Thronfolge Xerxes. Es beschreibt den Umfang des Perserreiches unter Xerxes Herrschaft und die Vorgeschichte des Perserkrieges.
3. Xerxes als Negativbeispiel in der antiken Literatur
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung Xerxes in der antiken Literatur, insbesondere in den Tragödien von Aischylos. Es zeigt, wie Xerxes als Inbegriff des Tyrannen und der Hybris dargestellt wird.
4. Interpretation der göttlichen Zeichen in Herodots Darstellung der Perserkriege
Dieses Kapitel analysiert die Rolle göttlicher Zeichen in Herodots Erzählung und untersucht, wie diese zur Charakterisierung Xerxes und zur Legitimation des athenischen Sieges eingesetzt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Xerxes I., Herodot, Perserkriege, Hybris, „Rhetorik des Anderen“, göttliche Zeichen, antike Literatur, Perser, Griechenland, Orientalismus, und der Darstellung von „Barbaren“ in der antiken Literatur.
- Quote paper
- Dimitri Dikhel (Author), 2018, Xerxes der Große. Determinismus und Willensfreiheit im herodoteischen Weltbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/958316