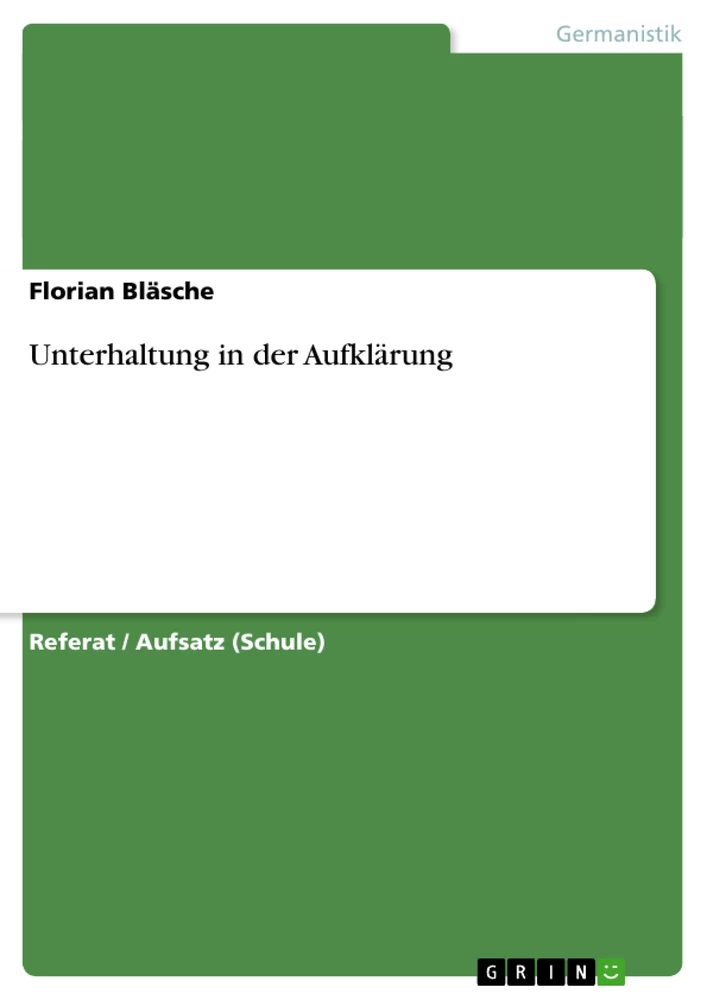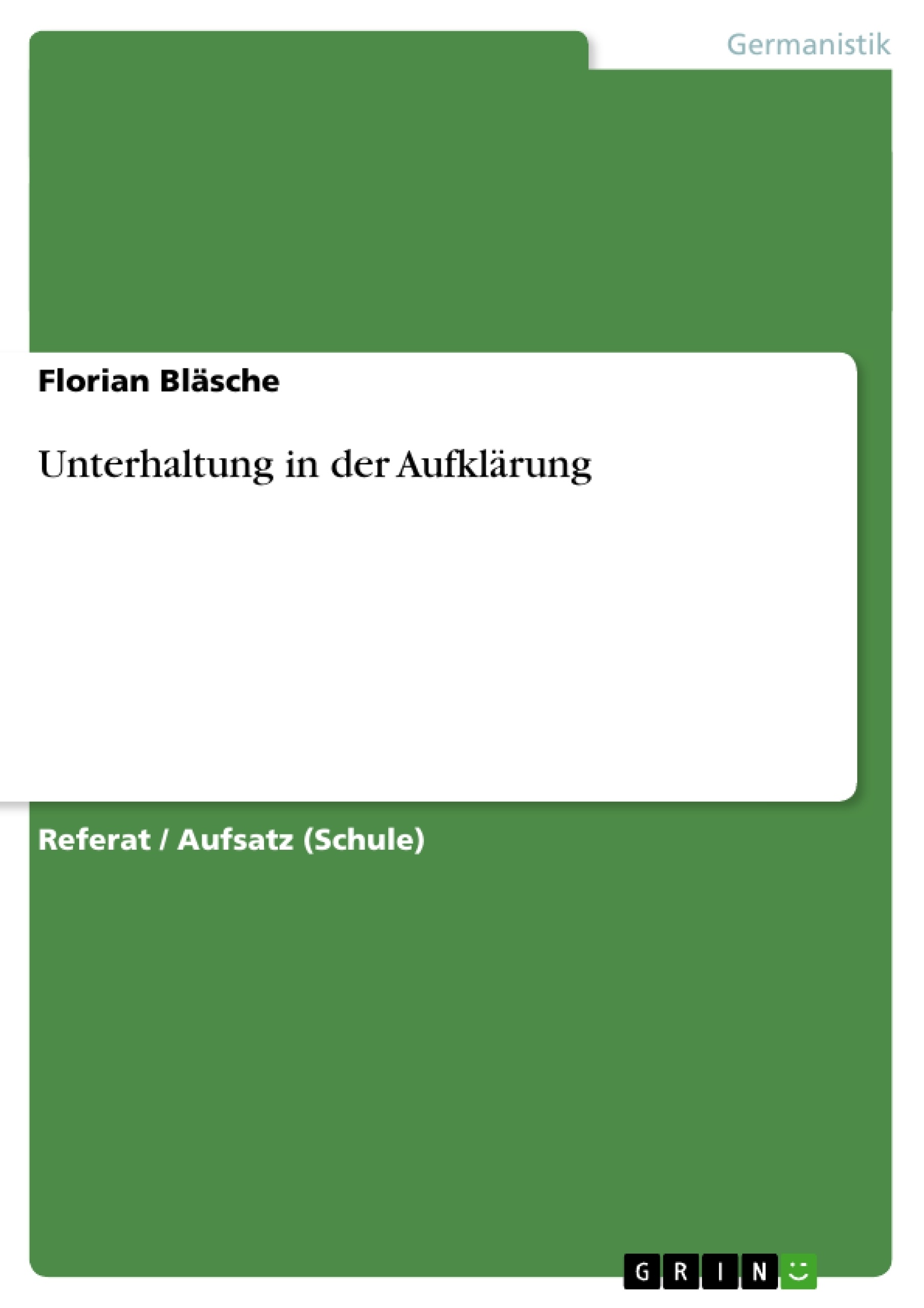Inhalt
1. Lesekulturen
1.1. Literatur in der Aufklärung
1.2. Der literarische Buchmarkt
1.3. moralische Wochenschriften
2. Theater in der Aufklärung
2.1. Überblick
2.2. Theater der Wanderbühnen
1. Lesekulturen
1.1. Literatur in der Aufklärung
Die höfisch geprägte Literatur des 17. Jahrhunderts war durch Volksferne, Realitätsverlust, Künstlichkeit und Motivarmut gekennzeichnet. Sie sprach deswegen, mit ihren „Haupt- und Staatsaktionen", verwirrenden Helden- und Schäferromanen und ihren schwülstigen erotischen Gedichte, immer weniger Menschen an, und wurde allmählich ersetzt. Die Fürsten entließen ihre Hofpoeten und Hofdichter, stattdessen wurden in den großen Handelsstädten, die sich neben den Höfen zu Kulturzentren entwickelten, neue eigenständige literarische Gesellschaften gegründet. Statt einem Fürsten traten nun bürgerliche als Geldgeber auf, die literarische Werke in Auftrag gaben, die dem Sinn der Aufklärung entsprachen. Dieser war, dass die Literatur den Zweck den Menschen zu bilden, zu erziehen, aber auch zu unterhalten hatte. Dazu sollte der Dichter ein gelehrter Mann sein und sich an Regeln halten, sich selbst kontrollierend durch den Verstand. Die verschiedenen Dichtungsgattungen wurden streng getrennt. Im Mittelpunkt der Dichtung standen Menschen, die sich durch ihren Willen und ihre Vernunft zu vollkommeneren Wesen entwickelten, genauso wie die Aufklärer es sich vorstellten. Nicht mehr das Lob des Fürsten und die Unterhaltung der höfischen Gesellschaft, sondern die Würdigung des bürgerlichen Lebens und die Aufklärung des bürgerlichen Lesers stand im Mittelpunkt der neuen Dichtung. Daher herrschte das Lehrgedicht, welches allgemeine Wahrheiten darstellte, die Fabel und satirische Darstellungen vor. Sehr beliebt waren auch der Reiseroman und später der Familienroman, welche Sittlichkeit und Tugend zu lehren versuchten. Der Aphorismus war in der Aufklärung auch eine beliebte literarische Ausdrucksform. Träger der Literatur waren die akademisch Gebildeten aus dem dritten Stand, besonders Theologen, Sprachgelehrte und Schulmänner. Viele Schriftsteller lösten sich aus der finanziellen Abhängigkeit der Fürsten und lebten als freie Schriftsteller. Die Schriftsteller hatten aber mit einer großen Schwierigkeit zu kämpfen, nämlich mit der Tatsache, dass die große Masse der Bevölkerung am Anfang des 18. Jahrhunderts weder lesen noch schreiben konnte, und die wenigen Bürger die es konnten, beschränkten ihre Lektüre auf die Bibel und sonstige religiöse Schriften. Noch um 1770 konnten nur 15 % der Bevölkerung lesen, 1800 waren es schon 25 %. Der Kreis jener die schöne Literatur lasen, war natürlich noch kleiner. Es musste daher erst ein breites Lesepublikum und eine literarisch interessierte Öffentlichkeit geschaffen werden.
1.2. Der literarische Buchmarkt
Entscheidend für die Entstehung des literarischen Marktes war der rasche Anstieg der Buchproduktion und der zahlenmäßig sprunghafte Anstieg der Schriftstelle r. Diese rasche Steigerung der Bücherzahlen machte es notwendig, die Buchproduktion und deren Vertrieb nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu organisieren. An Stelle des nach dem Gesetz des Tauschhandels(1450 bis ca. 1700) organisierten Buchhandels traten das moderne Verlagswesen und der moderne Buchhandel. Verlag und Sortiment, bislang in einer Person vereinigt, trennten und spezialisierten sich nun unabhängig voneinander auf die Herstellung bzw. den Vertrieb. Verleger beauftragten Druckereien mit der Herstellung von Büchern. Die Bücher kamen dann zu den sogenannten Sortimentsbuchhändlern. Erstmals gab es feste Preise und die Bücher konnten nun das ganze Jahr über den Buchhändler bezogen werden anstelle nur einmal im Jahr auf einer Buchmesse angeboten zu werden. Dies hatte aber Folgen für die Schriftsteller. Die Literatur wurde zur Kaufmannsware und der Schriftsteller zum Lohnschreiber. Die Schriftsteller waren generell abhängig vom Verleger und sie waren auch nicht Eigentümer ihrer Schriften. Der Verleger war Eigentümer und konnte mit den Werken willkürlich umgehen. Die Frage des geistigen Eigentums wurde aktuell durch das „Nachdruckunwesen.“ Ohne Rücksicht auf Autoren- und Verlegerrechte druckten Buchhändler beliebte und gefragte Bücher nach und verringerten somit den Gewinn des Verlegers und damit auch den des Autors. Dazu kam der starke Konkurrenzdruck unter den Autoren. Auf dem literarischen Markt konnten nur diejenigen Autoren überleben, denen es gelang sich dem Publikumsgeschmack anzupassen, oder Autoren, deren Werke durch Originalität in Inhalt und Form das Interesse der literarischen Kenner auf sich ziehen konnten. Nur ein kleiner Teil der Autoren produzierte deshalb nach seinem künstlerischen Gewissen.
Neben dem Buchhandel gab es, vor allem seit Mitte des Jahrhunderts ein ausgedehntes Zeitungs- und Zeitschriftenwesen. Es vermittelte nicht das Tagesgeschehen, denn dafür war die Herstellung und Verbreitung zu langsam, sondern gesellschaftliche, religiöse, moralische, ästhetische und literarische Ideen für das gebildete Publikum. Die einzelnen Nummern waren nicht im freien Verkauf erhältlich, sondern mussten abonniert werden.
1.3. moralische Wochenschriften
Ihre Anfänge haben die moralischen Wochenschriften in England und stammen von den „moral weeklies“ ab. Die Blütezeit dieses Journaltyps lag in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Blätter avancierten zum populärsten Sprachrohr der Aufklärung und wollten ein breites (bürgerliches) Lesepublikum erreichen. Ihr Ziel bestand darin, auf belehrende und unterhaltsame Weise bürgerliche „Tugend“ und „Moral“ zu fördern.
Die Blätter erschienen regelmäßig, meist anonym, von einem fiktiven Verfasser bzw. einer fiktiven Verfassergesellschaft. Die Erscheinungsdauer betrug durchschnittlich 2 Jahre. Die mittlere Auflagenhöhe lag bei etwa 500 Exemplaren, obwohl es vereinzelt auch Schriften mit einer Auflage von bis zu 6000 gab. Jede Nummer behandelt nur ein Thema. Auch wenn die einzelnen Themen aus verschiedenen Wissens- und Lebensbereichen stammen (Vernunft und Passion, Weltweisheit, Erziehung, Gesellschaft, Ästhetik, Sprache, Dichtung etc.), so dienen sie letztendlich nur dem einen Ziel; der Beförderung der menschlichen Tugend. Fragen zur Religion werden kaum thematisiert und über Politik wird gar nicht geschrieben. Die Themen werden zumeist in einem allgemeinen Rahmen abgehandelt, ein Aktualitätsbezug wird vermieden. Ohne an Relevanz zu verlieren konnten daher die Moralischen Wochenschriften in gebundener Form (in Jahrgangsbänden) nochmals erscheinen. Buntheit und Mannigfaltigkeit der gewählten Darstellungsform sorgen für Kurzweil. Briefe, Träume, Gedichte, Fabeln, Lieder, Epigramme, Dialoge, Beispielgeschichten wechseln einander ab. Plaudernd, spielerisch leicht werden in den Schriften die Themen dargeboten. Oft überwiegt jedoch ein lehrhafter Ton. Da die Schriften vorwiegend von und für bürgerliche geschrieben wurden, nimmt die Adelskritik einen großen Raum ein. Die Notwendigkeit einer sozialen Abgrenzung nach oben (und unten) wird immer wieder betont. Die Adligen werden verspottet und von dem Umgang mit niederen wird abgeraten, da sie zu ungebildet sind.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Journalwesens passiert es, das auch Frauen angesprochen werden. Man macht eine Abgrenzung zwischen Lesern und Leserinnen.
Die Impulse, die von den Wochenschriften ausgingen waren vielfältig. Zum einen förderten sie die Gründung von Lesegesellschaften, zum anderen wurden hier journalistische Strukturmerkmale und Elemente entwickelt, auf die spätere Journaltypen zurückgreifen konnten, wie zum Beispiel die Regenbogenpresse oder Leserbriefe. Schließlich ebneten sie den Weg für neue Gattungen und Genres wie Mädchenbuch, Frauenzeitschriften oder Unterhaltungsblätter.
2. Theater in der Aufklärung
2.1. Überblick
Das Theater war während der Aufklärung zweigeteilt. Zum einen gab es in den größeren Residenzstädten (München, Wien, Dresden, Prag) Hoftheater. Dort versuchten fest angestellte Schauspieler und Bühnenautoren, die Hofgesellschaft zu unterhalten. Diese Theater waren aber nur für die Adligen, weil den Bürgern für ungebildet und für Kultur nicht empfänglich dargestellt wurden. Den Adligen, Fürsten und Königen wiederum schrieb man die Fähigkeit zur Tragik zu. So gab es im Hoftheater zwei Spielarten; die Komödie, in der Bürger und Bauern verlacht wurden, und die Tragödie, in der staatspolitisch relevante Stoffe idealtypisch dargestellt wurden.
Zum anderen gab es auch Theater für die Bevölkerungsschichten, die Wanderbühnen.
2.2. Die Wanderbühnen
Wanderbühnen haben in Deutschland eine lange Tradition. Die ersten Schauspielertruppen kamen bereits Ende des 16. Jh. aus England nach Deutschland. Sie bringen Stücke der elisabethanischen Bühne (Shakespeare, Marlow) mit. Meist Stücke von wichtigen Personen und blutigen Schicksalen. Für die Vor- und Zwischenspiele hatte man einen sogenannten Hanswurst der zur Belustigung der Zuschauer da war. Die Hauptvorstellung war der fremden Sprache wegen auf viel Pantomime und wildes Gestikulieren angewiesen. Phantastische Gewänder, grelle Kulissen und grelle Schreie ersetzten den fehlenden Sinnzusammenhang und die sprachliche Ordnung. Gespielt wurde in Scheunen, auf Marktplätzen und, eher seltener, im Theater eines Hofes. Später kamen deutsche Schauspieltruppen hinzu, die sich aber anfangs, um das Interesse zu steigern, „englische Komödianten“ nannten. An der Qualität der nun in deutsch aufgeführten Stücke änderte sich bis zur Mitte des 18. Jh. nicht viel. Zerspielte Barockstücke und viel Improvisiertes standen auf dem Programm und die wichtigste Person war der Hanswurst, der nun die ganze Vorstellung improvisierend begleitete und „kommentierte“. Das Ansehen der Schauspieltruppen war nicht sehr hoch. Zum einen genoss man zwar die lustigen Stücke mit ihren derben Szenen und den Prügeleien, anderseits würden ihnen alle bürgerlichen Rechte verwehrt. Sie wurden auch alle von Vorurteilen verfolgt, wie das sie ihre Rechnungen nicht bezahlen, Unruhen in die Stadt bringen, Mädchen und Jungen verführen usw.
Dennoch erfuhren sie regen Zulauf aus bürgerlichen Kreisen. Verkrachte Studenten, arbeitslose Theologen oder abenteuerlustige Töchter und Söhne reicher bürgerlicher zogen gerne ein paar Jahre mit ihnen durchs Land. Sie vor allem waren es, die Theater und Schauspielerstand in Deutschland nach und nach zu Ansehen brachten.
Einige Menschen, wie zum Beispiel der Lehrer Johann Christoph Gottsched, versuchten später das Theater zu Reformieren und dem Publikum klassische Stücke näher zu bringen. Dies scheiterte letztendlich daran, dass es zu jener Zeit noch kaum geeignete deutsche Stücke gab und dass das regelmäßig aufgebaute klassische Drama beim Publikum gähnende Langeweile hervorrief.
Thesen
1. Aufklärung
1. Aufklärung war eine geistige Strömung, die gegen Aberglauben und Autoritätsdenken ankämpfte.
2. Es fanden Umwälzungen im Bereich Religion, Naturanschauung, Gesellschaft und Staatsordnung statt.
3. Emanzipation des Bürgertums und Säkularisierung begünstigten die Forschung in allen Bereichen.
4. Die Aufklärung propagierte selbstständiges und vernünftiges Denken.
5. Die neue Literatur des Bürgertums bezeugte die Widersprüche zwischen Herrschaft und Unterdrückung; sie diente als Symbol der Moral.
2. Kultur und ihre Ideale
1. Die Kunst richtet sich auch nach der rationalen Weltsicht.
2. Die Kunst setzte sich mit antiken Idealen und der Natur auseinander.
3. Darstellung des Schönen und Guten im Menschen dominierte, man wollte eine Moral vermitteln.
4. Kunst sollte dem Zweck und der Ordnung dienen, den abstrakten Begriff Vernunft veranschaulichen
5. Gegensätzliche Auffassung von Kunst rebellierte gegen derartige Konventionen, die Kunst solle vom Gefühl geleitet sein
6. Das Ergebnis war eine Synthese aus Verstand und Seele
3. Lesekulturen
3.1. Literatur in der Aufklärung
1. Die höfisch geprägte Literatur des 17. Jh. wurde durch die aufklärerische Literatur des 18. Jh. ersetzt.
2. Die Literatur sollte bilden, erziehen aber auch unterhalten.
3. Lehrgedichte, Fabeln und Satiren herrschten vor, aber auch Familien- und Reiseromane waren sehr beliebt.
3.2. literarischer Markt
1. Ein rascher Anstieg der Schriftsteller und somit auch der Bücher, machte es notwendig den Buchhandel zu organisierten.
2. Bücher waren nun das ganze Jahr über erhältlich und hatten erstmals feste Preise.
3. Der Inhalt der Literatur wurde durch Publikumsgeschmack bestimmt.
3.3.moralische Wochenschriften
1. Das Ziel der Wochenschriften bestand darin, auf unterhaltsame Weise bürgerliche „Tugend“ und „Moral“ zu fördern.
2. Weder Religion noch Politik werden thematisiert.
3. Die soziale Abgrenzung nach oben (Adel) und unten (gemeines Volk) wird immer wieder betont.
4. Erstmals in der Geschichte gibt es Hefte für Frauen.
4. Lyrik
1. Künstler übersetzen Werke des antiken Dichters Anakreon (5. Jh. vor Chr.)
2. Anakreontik war eine scherzhafte Dichtung in gehobener Sprache.
3. Anakreontik pries die Freuden des Lebens(Wein, Liebe, Freunde, Gesang, Natur), ohne sie jedoch zu thematisieren.
4. Äußerlichkeiten wurden in Übereinstimmung mit dem Original gebracht um dann eine Harmonie zwischen Form und Inhalt zu erzielen.
5.Theater
5.1.Überblick
1. Theater war zweigeteilt; zum einen gab es das Hoftheater für die Adligen, zum anderen die Wanderbühnen für das restliche Volk
4.1. Wanderbühnen
1. Stammen aus England und handeln meist von wichtigen Personen und blutigen Schicksalen
2. Die wichtigste Person war der „Hanswurst“, der die Vorstellung improvisierend begleitete und „kommentierte“.
3. Obwohl das Schauspiel sehr genossen wurde, war das Ansehen der Schauspieler sehr gering.
Bibliographie:
Zeman: Die deutsche anakreontische Dichtung
Grimminger: Die Ordnung, das Chaos und die Kunst
Lexikon der Literaturgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen von Lesekulturen und Theater in der Aufklärung?
Die Hauptthemen umfassen Lesekulturen in der Aufklärung, den literarischen Buchmarkt, moralische Wochenschriften, Theater in der Aufklärung (Hoftheater und Wanderbühnen), sowie eine kurze Übersicht über die Aufklärung, Kulturideale, Lyrik (Anakreontik) und Theater.
Was kennzeichnete die Literatur in der Aufklärung?
Die Literatur sollte bilden, erziehen und unterhalten. Lehrgedichte, Fabeln, Satiren, Familienromane und Reiseromane waren beliebt. Im Mittelpunkt stand die Würdigung des bürgerlichen Lebens und die Aufklärung des bürgerlichen Lesers.
Wie veränderte sich der literarische Buchmarkt in der Aufklärung?
Der Buchmarkt professionalisierte sich durch den Anstieg der Buchproduktion und der Schriftsteller. Verlagswesen und Buchhandel trennten sich. Es gab feste Preise und Bücher waren ganzjährig erhältlich. Der Publikumsgeschmack beeinflusste den Inhalt der Literatur, und es entstand das Problem des Nachdruckunwesens.
Was waren moralische Wochenschriften und welche Ziele verfolgten sie?
Moralische Wochenschriften waren ein Sprachrohr der Aufklärung, das bürgerliche Tugend und Moral auf unterhaltsame Weise fördern sollte. Sie thematisierten weder Religion noch Politik, sondern betonten die soziale Abgrenzung von Adel und gemeinem Volk. Sie waren auch die ersten Hefte, die sich speziell an Frauen richteten.
Welche Rolle spielte das Theater in der Aufklärung?
Das Theater war zweigeteilt: Hoftheater für den Adel und Wanderbühnen für das restliche Volk. Im Hoftheater wurden Komödien und Tragödien aufgeführt. Die Wanderbühnen, die aus England stammten, zeigten Stücke mit blutigen Schicksalen und wurden vom Hanswurst begleitet.
Was ist Anakreontik?
Anakreontik war eine scherzhafte Dichtung in gehobener Sprache, die die Freuden des Lebens (Wein, Liebe, Freunde, Gesang, Natur) pries, ohne diese jedoch zu thematisieren. Sie orientierte sich an Werken des antiken Dichters Anakreon.
Welche Thesen zur Aufklärung werden im Text genannt?
Die Aufklärung war eine geistige Strömung gegen Aberglauben und Autoritätsdenken. Es gab Umwälzungen in Religion, Naturanschauung, Gesellschaft und Staatsordnung. Die Emanzipation des Bürgertums und die Säkularisierung begünstigten die Forschung, und die Aufklärung propagierte selbstständiges und vernünftiges Denken.
Welche Bibliographie wird am Ende des Textes aufgelistet?
Zeman: Die deutsche anakreontische Dichtung Grimminger: Die Ordnung, das Chaos und die Kunst Lexikon der Literaturgeschichte Horst Albert Glasner; Deutsche Literatur: Eine Sozialgeschichte (4)
- Quote paper
- Florian Bläsche (Author), 2000, Unterhaltung in der Aufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95681